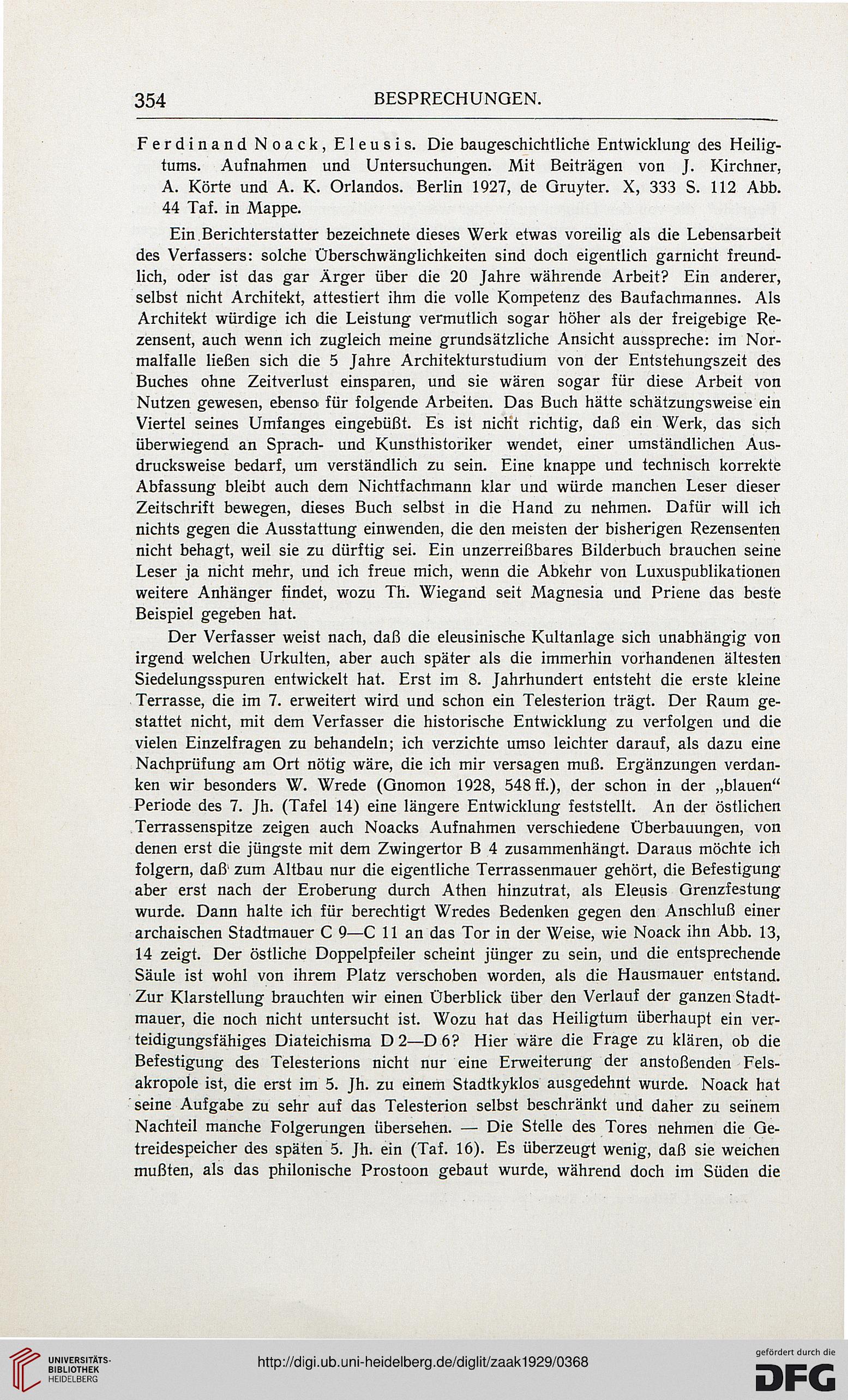354
BESPRECHUNGEN.
Ferdinand Noack, Eleusis. Die baugeschichtliche Entwicklung des Heilig-
tums. Aufnahmen und Untersuchungen. Mit Beiträgen von J. Kirchner,
A. Körte und A. K. Orlandos. Berlin 1927, de Gruyter. X, 333 S. 112 Abb.
44 Taf. in Mappe.
Ein Berichterstatter bezeichnete dieses Werk etwas voreilig als die Lebensarbeit
des Verfassers: solche Überschwänglichkeiten sind doch eigentlich garnicht freund-
lich, oder ist das gar Ärger über die 20 Jahre währende Arbeit? Ein anderer,
selbst nicht Architekt, attestiert ihm die volle Kompetenz des Baufachmannes. Als
Architekt würdige ich die Leistung vermutlich sogar höher als der freigebige Re-
zensent, auch wenn ich zugleich meine grundsätzliche Ansicht ausspreche: im Nor-
malfalle ließen sich die 5 Jahre Architekturstudium von der Entstehungszeit des
Buches ohne Zeitverlust einsparen, und sie wären sogar für diese Arbeit von
Nutzen gewesen, ebenso für folgende Arbeiten. Das Buch hätte schätzungsweise ein
Viertel seines Umfanges eingebüßt. Es ist nicht richtig, daß ein Werk, das sich
überwiegend an Sprach- und Kunsthistoriker wendet, einer umständlichen Aus-
drucksweise bedarf, um verständlich zu sein. Eine knappe und technisch korrekte
Abfassung bleibt auch dem Nichtfachmann klar und würde manchen Leser dieser
Zeitschrift bewegen, dieses Buch selbst in die Hand zu nehmen. Dafür will ich
nichts gegen die Ausstattung einwenden, die den meisten der bisherigen Rezensenten
nicht behagt, weil sie zu dürftig sei. Ein unzerreißbares Bilderbuch brauchen seine
Leser ja nicht mehr, und ich freue mich, wenn die Abkehr von Luxuspublikationen
weitere Anhänger findet, wozu Th. Wiegand seit Magnesia und Priene das beste
Beispiel gegeben hat.
Der Verfasser weist nach, daß die eleusinische Kultanlage sich unabhängig von
irgend welchen Urkulten, aber auch später als die immerhin vorhandenen ältesten
Siedelungsspuren entwickelt hat. Erst im 8. Jahrhundert entsteht die erste kleine
Terrasse, die im 7. erweitert wird und schon ein Telesterion trägt. Der Raum ge-
stattet nicht, mit dem Verfasser die historische Entwicklung zu verfolgen und die
vielen Einzelfragen zu behandeln; ich verzichte umso leichter darauf, als dazu eine
Nachprüfung am Ort nötig wäre, die ich mir versagen muß. Ergänzungen verdan-
ken wir besonders W. Wrede (Gnomon 1928, 548 ff.), der schon in der „blauen"
Periode des 7. Jh. (Tafel 14) eine längere Entwicklung feststellt. An der östlichen
Terrassenspitze zeigen auch Noacks Aufnahmen verschiedene Überbauungen, von
denen erst die jüngste mit dem Zwingertor B 4 zusammenhängt. Daraus möchte ich
folgern, daß' zum Altbau nur die eigentliche Terrassenmauer gehört, die Befestigung
aber erst nach der Eroberung durch Athen hinzutrat, als Eleusis Grenzfestung
wurde. Dann halte ich für berechtigt Wredes Bedenken gegen den Anschluß einer
archaischen Stadtmauer C 9—C 11 an das Tor in der Weise, wie Noack ihn Abb. 13,
14 zeigt. Der östliche Doppelpfeiler scheint jünger zu sein, und die entsprechende
Säule ist wohl von ihrem Platz verschoben worden, als die Hausmauer entstand.
Zur Klarstellung brauchten wir einen Überblick über den Verlauf der ganzen Stadt-
mauer, die noch nicht untersucht ist. Wozu hat das Heiligtum überhaupt ein ver-
teidigungsfähiges Diateichisma D 2—D 6? Hier wäre die Frage zu klären, ob die
Befestigung des Telesterions nicht nur eine Erweiterung der anstoßenden Fels-
akropole ist, die erst im 5. Jh. zu einem Stadtkyklos ausgedehnt wurde. Noack hat
seine Aufgabe zu sehr auf das Telesterion selbst beschränkt und daher zu seinem
Nachteil manche Folgerungen übersehen. — Die Stelle des Tores nehmen die Ge-
treidespeicher des späten 5. Jh. ein (Taf. 16). Es überzeugt wenig, daß sie weichen
mußten, als das philonische Prostoon gebaut wurde, während doch im Süden die
BESPRECHUNGEN.
Ferdinand Noack, Eleusis. Die baugeschichtliche Entwicklung des Heilig-
tums. Aufnahmen und Untersuchungen. Mit Beiträgen von J. Kirchner,
A. Körte und A. K. Orlandos. Berlin 1927, de Gruyter. X, 333 S. 112 Abb.
44 Taf. in Mappe.
Ein Berichterstatter bezeichnete dieses Werk etwas voreilig als die Lebensarbeit
des Verfassers: solche Überschwänglichkeiten sind doch eigentlich garnicht freund-
lich, oder ist das gar Ärger über die 20 Jahre währende Arbeit? Ein anderer,
selbst nicht Architekt, attestiert ihm die volle Kompetenz des Baufachmannes. Als
Architekt würdige ich die Leistung vermutlich sogar höher als der freigebige Re-
zensent, auch wenn ich zugleich meine grundsätzliche Ansicht ausspreche: im Nor-
malfalle ließen sich die 5 Jahre Architekturstudium von der Entstehungszeit des
Buches ohne Zeitverlust einsparen, und sie wären sogar für diese Arbeit von
Nutzen gewesen, ebenso für folgende Arbeiten. Das Buch hätte schätzungsweise ein
Viertel seines Umfanges eingebüßt. Es ist nicht richtig, daß ein Werk, das sich
überwiegend an Sprach- und Kunsthistoriker wendet, einer umständlichen Aus-
drucksweise bedarf, um verständlich zu sein. Eine knappe und technisch korrekte
Abfassung bleibt auch dem Nichtfachmann klar und würde manchen Leser dieser
Zeitschrift bewegen, dieses Buch selbst in die Hand zu nehmen. Dafür will ich
nichts gegen die Ausstattung einwenden, die den meisten der bisherigen Rezensenten
nicht behagt, weil sie zu dürftig sei. Ein unzerreißbares Bilderbuch brauchen seine
Leser ja nicht mehr, und ich freue mich, wenn die Abkehr von Luxuspublikationen
weitere Anhänger findet, wozu Th. Wiegand seit Magnesia und Priene das beste
Beispiel gegeben hat.
Der Verfasser weist nach, daß die eleusinische Kultanlage sich unabhängig von
irgend welchen Urkulten, aber auch später als die immerhin vorhandenen ältesten
Siedelungsspuren entwickelt hat. Erst im 8. Jahrhundert entsteht die erste kleine
Terrasse, die im 7. erweitert wird und schon ein Telesterion trägt. Der Raum ge-
stattet nicht, mit dem Verfasser die historische Entwicklung zu verfolgen und die
vielen Einzelfragen zu behandeln; ich verzichte umso leichter darauf, als dazu eine
Nachprüfung am Ort nötig wäre, die ich mir versagen muß. Ergänzungen verdan-
ken wir besonders W. Wrede (Gnomon 1928, 548 ff.), der schon in der „blauen"
Periode des 7. Jh. (Tafel 14) eine längere Entwicklung feststellt. An der östlichen
Terrassenspitze zeigen auch Noacks Aufnahmen verschiedene Überbauungen, von
denen erst die jüngste mit dem Zwingertor B 4 zusammenhängt. Daraus möchte ich
folgern, daß' zum Altbau nur die eigentliche Terrassenmauer gehört, die Befestigung
aber erst nach der Eroberung durch Athen hinzutrat, als Eleusis Grenzfestung
wurde. Dann halte ich für berechtigt Wredes Bedenken gegen den Anschluß einer
archaischen Stadtmauer C 9—C 11 an das Tor in der Weise, wie Noack ihn Abb. 13,
14 zeigt. Der östliche Doppelpfeiler scheint jünger zu sein, und die entsprechende
Säule ist wohl von ihrem Platz verschoben worden, als die Hausmauer entstand.
Zur Klarstellung brauchten wir einen Überblick über den Verlauf der ganzen Stadt-
mauer, die noch nicht untersucht ist. Wozu hat das Heiligtum überhaupt ein ver-
teidigungsfähiges Diateichisma D 2—D 6? Hier wäre die Frage zu klären, ob die
Befestigung des Telesterions nicht nur eine Erweiterung der anstoßenden Fels-
akropole ist, die erst im 5. Jh. zu einem Stadtkyklos ausgedehnt wurde. Noack hat
seine Aufgabe zu sehr auf das Telesterion selbst beschränkt und daher zu seinem
Nachteil manche Folgerungen übersehen. — Die Stelle des Tores nehmen die Ge-
treidespeicher des späten 5. Jh. ein (Taf. 16). Es überzeugt wenig, daß sie weichen
mußten, als das philonische Prostoon gebaut wurde, während doch im Süden die