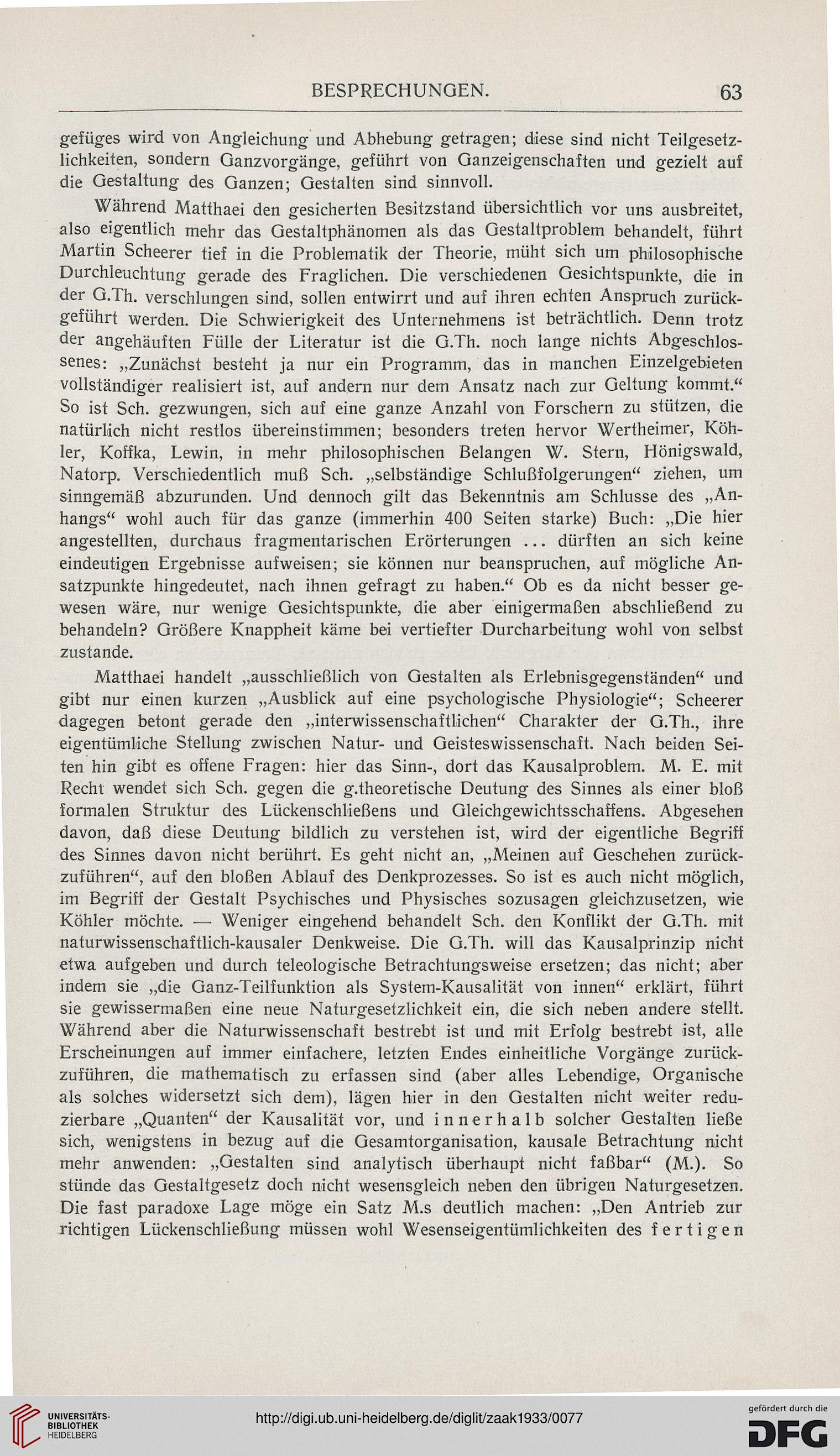BESPRECHUNGEN.
63
gefüges wird von Angleichung und Abhebung getragen; diese sind nicht Teilgesetz-
lichkeiten, sondern Qanzvorgänge, geführt von Ganzeigenschaften und gezielt auf
die Gestaltung des Ganzen; Gestalten sind sinnvoll.
Während Matthaei den gesicherten Besitzstand übersichtlich vor uns ausbreitet,
also eigentlich mehr das Gestaltphänomen als das Gestaltproblem behandelt, führt
Martin Scheerer tief in die Problematik der Theorie, müht sich um philosophische
Durchleuchtung gerade des Fraglichen. Die verschiedenen Gesichtspunkte, die in
der G.Th. verschlungen sind, sollen entwirrt und auf ihren echten Anspruch zurück-
geführt werden. Die Schwierigkeit des Unternehmens ist beträchtlich. Denn trotz
der angehäuften Fülle der Literatur ist die G.Th. noch lange nichts Abgeschlos-
senes: „Zunächst besteht ja nur ein Programm, das in manchen Einzelgebieten
vollständiger realisiert ist, auf andern nur dem Ansatz nach zur Geltung kommt."
So ist Sch. gezwungen, sich auf eine ganze Anzahl von Forschern zu stützen, die
natürlich nicht restlos übereinstimmen; besonders treten hervor Wertheimer, Köh-
ler, Koffka, Lewin, in mehr philosophischen Belangen W. Stern, Hönigswald,
Natorp. Verschiedentlich muß Sch. „selbständige Schlußfolgerungen" ziehen, um
sinngemäß abzurunden. Und dennoch gilt das Bekenntnis am Schlüsse des „An-
hangs" wohl auch für das ganze (immerhin 400 Seiten starke) Buch: „Die hier
angestellten, durchaus fragmentarischen Erörterungen ... dürften an sich keine
eindeutigen Ergebnisse aufweisen; sie können nur beanspruchen, auf mögliche An-
satzpunkte hingedeutet, nach ihnen gefragt zu haben." Ob es da nicht besser ge-
wesen wäre, nur wenige Gesichtspunkte, die aber einigermaßen abschließend zu
behandeln? Größere Knappheit käme bei vertiefter Durcharbeitung wohl von selbst
zustande.
Matthaei handelt „ausschließlich von Gestalten als Erlebnisgegenständen" und
gibt nur einen kurzen „Ausblick auf eine psychologische Physiologie"; Scheerer
dagegen betont gerade den „interwissenschaftlichen" Charakter der G.Th., ihre
eigentümliche Stellung zwischen Natur- und Geisteswissenschaft. Nach beiden Sei-
ten hin gibt es offene Fragen: hier das Sinn-, dort das Kausalproblem. M. E. mit
Recht wendet sich Sch. gegen die g.theoretische Deutung des Sinnes als einer bloß
formalen Struktur des Lückenschließens und Gleichgewichtsschaffens. Abgesehen
davon, daß diese Deutung bildlich zu verstehen ist, wird der eigentliche Begriff
des Sinnes davon nicht berührt. Es geht nicht an, „Meinen auf Geschehen zurück-
zuführen", auf den bloßen Ablauf des Denkprozesses. So ist es auch nicht möglich,
im Begriff der Gestalt Psychisches und Physisches sozusagen gleichzusetzen, wie
Köhler möchte. — Weniger eingehend behandelt Sch. den Konflikt der G.Th. mit
naturwissenschaftlich-kausaler Denkweise. Die G.Th. will das Kausalprinzip nicht
etwa aufgeben und durch teleologische Betrachtungsweise ersetzen; das nicht; aber
indem sie „die Ganz-Teilfunktion als System-Kausalität von innen" erklärt, führt
sie gewissermaßen eine neue Naturgesetzlichkeit ein, die sich neben andere stellt.
Während aber die Naturwissenschaft bestrebt ist und mit Erfolg bestrebt ist, alle
Erscheinungen auf immer einfachere, letzten Endes einheitliche Vorgänge zurück-
zuführen, die mathematisch zu erfassen sind (aber alles Lebendige, Organische
als solches widersetzt sich dem), lägen hier in den Gestalten nicht weiter redu-
zierbare „Quanten" der Kausalität vor, und innerhalb solcher Gestalten ließe
sich, wenigstens in bezug auf die Gesamtorganisation, kausale Betrachtung nicht
mehr anwenden: „Gestalten sind analytisch überhaupt nicht faßbar" (M.). So
stünde das Gestaltgesetz doch nicht wesensgleich neben den übrigen Naturgesetzen.
Die fast paradoxe Lage möge ein Satz M.s deutlich machen: „Den Antrieb zur
richtigen Lückenschließung müssen wohl Wesenseigentümlichkeiten des fertigen
63
gefüges wird von Angleichung und Abhebung getragen; diese sind nicht Teilgesetz-
lichkeiten, sondern Qanzvorgänge, geführt von Ganzeigenschaften und gezielt auf
die Gestaltung des Ganzen; Gestalten sind sinnvoll.
Während Matthaei den gesicherten Besitzstand übersichtlich vor uns ausbreitet,
also eigentlich mehr das Gestaltphänomen als das Gestaltproblem behandelt, führt
Martin Scheerer tief in die Problematik der Theorie, müht sich um philosophische
Durchleuchtung gerade des Fraglichen. Die verschiedenen Gesichtspunkte, die in
der G.Th. verschlungen sind, sollen entwirrt und auf ihren echten Anspruch zurück-
geführt werden. Die Schwierigkeit des Unternehmens ist beträchtlich. Denn trotz
der angehäuften Fülle der Literatur ist die G.Th. noch lange nichts Abgeschlos-
senes: „Zunächst besteht ja nur ein Programm, das in manchen Einzelgebieten
vollständiger realisiert ist, auf andern nur dem Ansatz nach zur Geltung kommt."
So ist Sch. gezwungen, sich auf eine ganze Anzahl von Forschern zu stützen, die
natürlich nicht restlos übereinstimmen; besonders treten hervor Wertheimer, Köh-
ler, Koffka, Lewin, in mehr philosophischen Belangen W. Stern, Hönigswald,
Natorp. Verschiedentlich muß Sch. „selbständige Schlußfolgerungen" ziehen, um
sinngemäß abzurunden. Und dennoch gilt das Bekenntnis am Schlüsse des „An-
hangs" wohl auch für das ganze (immerhin 400 Seiten starke) Buch: „Die hier
angestellten, durchaus fragmentarischen Erörterungen ... dürften an sich keine
eindeutigen Ergebnisse aufweisen; sie können nur beanspruchen, auf mögliche An-
satzpunkte hingedeutet, nach ihnen gefragt zu haben." Ob es da nicht besser ge-
wesen wäre, nur wenige Gesichtspunkte, die aber einigermaßen abschließend zu
behandeln? Größere Knappheit käme bei vertiefter Durcharbeitung wohl von selbst
zustande.
Matthaei handelt „ausschließlich von Gestalten als Erlebnisgegenständen" und
gibt nur einen kurzen „Ausblick auf eine psychologische Physiologie"; Scheerer
dagegen betont gerade den „interwissenschaftlichen" Charakter der G.Th., ihre
eigentümliche Stellung zwischen Natur- und Geisteswissenschaft. Nach beiden Sei-
ten hin gibt es offene Fragen: hier das Sinn-, dort das Kausalproblem. M. E. mit
Recht wendet sich Sch. gegen die g.theoretische Deutung des Sinnes als einer bloß
formalen Struktur des Lückenschließens und Gleichgewichtsschaffens. Abgesehen
davon, daß diese Deutung bildlich zu verstehen ist, wird der eigentliche Begriff
des Sinnes davon nicht berührt. Es geht nicht an, „Meinen auf Geschehen zurück-
zuführen", auf den bloßen Ablauf des Denkprozesses. So ist es auch nicht möglich,
im Begriff der Gestalt Psychisches und Physisches sozusagen gleichzusetzen, wie
Köhler möchte. — Weniger eingehend behandelt Sch. den Konflikt der G.Th. mit
naturwissenschaftlich-kausaler Denkweise. Die G.Th. will das Kausalprinzip nicht
etwa aufgeben und durch teleologische Betrachtungsweise ersetzen; das nicht; aber
indem sie „die Ganz-Teilfunktion als System-Kausalität von innen" erklärt, führt
sie gewissermaßen eine neue Naturgesetzlichkeit ein, die sich neben andere stellt.
Während aber die Naturwissenschaft bestrebt ist und mit Erfolg bestrebt ist, alle
Erscheinungen auf immer einfachere, letzten Endes einheitliche Vorgänge zurück-
zuführen, die mathematisch zu erfassen sind (aber alles Lebendige, Organische
als solches widersetzt sich dem), lägen hier in den Gestalten nicht weiter redu-
zierbare „Quanten" der Kausalität vor, und innerhalb solcher Gestalten ließe
sich, wenigstens in bezug auf die Gesamtorganisation, kausale Betrachtung nicht
mehr anwenden: „Gestalten sind analytisch überhaupt nicht faßbar" (M.). So
stünde das Gestaltgesetz doch nicht wesensgleich neben den übrigen Naturgesetzen.
Die fast paradoxe Lage möge ein Satz M.s deutlich machen: „Den Antrieb zur
richtigen Lückenschließung müssen wohl Wesenseigentümlichkeiten des fertigen