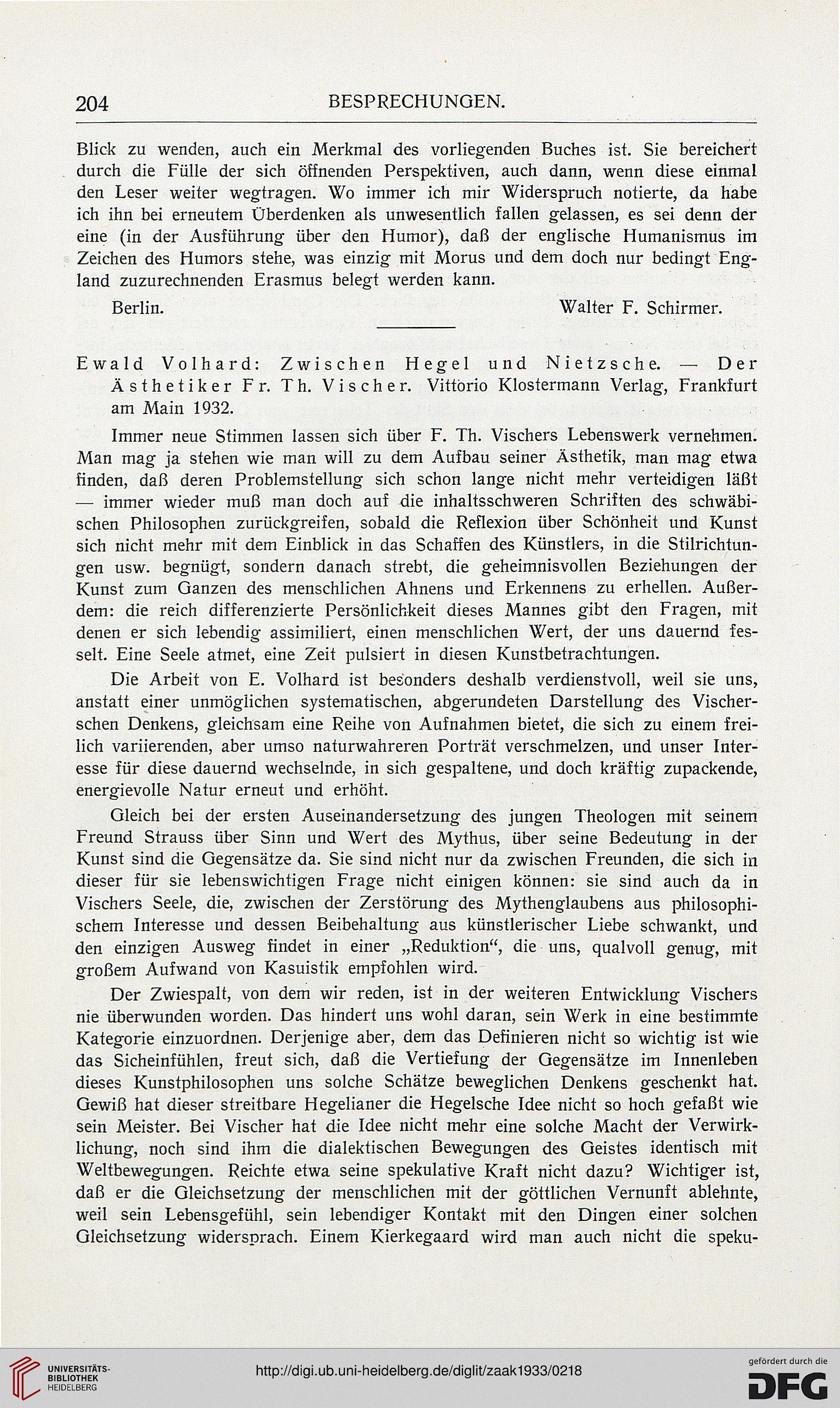204
BESPRECHUNGEN.
Blick zu wenden, auch ein Merkmal des vorliegenden Buches ist. Sie bereichert
durch die Fülle der sich öffnenden Perspektiven, auch dann, wenn diese einmal
den Leser weiter wegtragen. Wo immer ich mir Widerspruch notierte, da habe
ich ihn bei erneutem Überdenken als unwesentlich fallen gelassen, es sei denn der
eine (in der Ausführung über den Humor), daß der englische Humanismus im
Zeichen des Humors stehe, was einzig mit Morus und dem doch nur bedingt Eng-
land zuzurechnenden Erasmus belegt werden kann.
Berlin. Walter F. Schirmer.
Ewald Volhard: Zwischen Hegel und Nietzsche. — Der
Ästhetiker Fr. Th. Vischer. Vittörio Klostermann Verlag, Frankfurt
am Main 1932.
Immer neue Stimmen lassen sich über F. Th. Vischers Lebenswerk vernehmen.
Man mag ja stehen wie man will zu dem Aufbau seiner Ästhetik, man mag etwa
rinden, daß deren Problemstellung sich schon lange nicht mehr verteidigen läßt
— immer wieder muß man doch auf die inhaltsschweren Schriften des schwäbi-
schen Philosophen zurückgreifen, sobald die Reflexion über Schönheit und Kunst
sich nicht mehr mit dem Einblick in das Schaffen des Künstlers, in die Stilrichtun-
gen usw. begnügt, sondern danach strebt, die geheimnisvollen Beziehungen der
Kunst zum Ganzen des menschlichen Ahnens und Erkennens zu erhellen. Außer-
dem: die reich differenzierte Persönlichkeit dieses Mannes gibt den Fragen, mit
denen er sich lebendig assimiliert, einen menschlichen Wert, der uns dauernd fes-
selt. Eine Seele atmet, eine Zeit pulsiert in diesen Kunstbetrachtungen.
Die Arbeit von E. Volhard ist besonders deshalb verdienstvoll, weil sie uns,
anstatt einer unmöglichen systematischen, abgerundeten Darstellung des Vischer-
schen Denkens, gleichsam eine Reihe von Aufnahmen bietet, die sich zu einem frei-
lich variierenden, aber umso naturwahreren Porträt verschmelzen, und unser Inter-
esse für diese dauernd wechselnde, in sich gespaltene, und doch kräftig zupackende,
energievolle Natur erneut und erhöht.
Gleich bei der ersten Auseinandersetzung des jungen Theologen mit seinem
Freund Strauss über Sinn und Wert des Mythus, über seine Bedeutung in der
Kunst sind die Gegensätze da. Sie sind nicht nur da zwischen Freunden, die sich in
dieser für sie lebenswichtigen Frage nicht einigen können: sie sind auch da in
Vischers Seele, die, zwischen der Zerstörung des Mythenglaubens aus philosophi-
schem Interesse und dessen Beibehaltung aus künstlerischer Liebe schwankt, und
den einzigen Ausweg findet in einer „Reduktion", die uns, qualvoll genug, mit
großem Aufwand von Kasuistik empfohlen wird.
Der Zwiespalt, von dem wir reden, ist in der weiteren Entwicklung Vischers
nie überwunden worden. Das hindert uns wohl daran, sein Werk in eine bestimmte
Kategorie einzuordnen. Derjenige aber, dem das Definieren nicht so wichtig ist wie
das Sicheinfühlen, freut sich, daß die Vertiefung der Gegensätze im Innenleben
dieses Kunstphilosophen uns solche Schätze beweglichen Denkens geschenkt hat.
Gewiß hat dieser streitbare Hegelianer die Hegeische Idee nicht so hoch gefaßt wie
sein Meister. Bei Vischer hat die Idee nicht mehr eine solche Macht der Verwirk-
lichung, noch sind ihm die dialektischen Bewegungen des Geistes identisch mit
Weltbewegungen. Reichte etwa seine spekulative Kraft nicht dazu? Wichtiger ist,
daß er die Gleichsetzung der menschlichen mit der göttlichen Vernunft ablehnte,
weil sein Lebensgefühl, sein lebendiger Kontakt mit den Dingen einer solchen
Gleichsetzung widersprach. Einem Kierkegaard wird man auch nicht die speku-
BESPRECHUNGEN.
Blick zu wenden, auch ein Merkmal des vorliegenden Buches ist. Sie bereichert
durch die Fülle der sich öffnenden Perspektiven, auch dann, wenn diese einmal
den Leser weiter wegtragen. Wo immer ich mir Widerspruch notierte, da habe
ich ihn bei erneutem Überdenken als unwesentlich fallen gelassen, es sei denn der
eine (in der Ausführung über den Humor), daß der englische Humanismus im
Zeichen des Humors stehe, was einzig mit Morus und dem doch nur bedingt Eng-
land zuzurechnenden Erasmus belegt werden kann.
Berlin. Walter F. Schirmer.
Ewald Volhard: Zwischen Hegel und Nietzsche. — Der
Ästhetiker Fr. Th. Vischer. Vittörio Klostermann Verlag, Frankfurt
am Main 1932.
Immer neue Stimmen lassen sich über F. Th. Vischers Lebenswerk vernehmen.
Man mag ja stehen wie man will zu dem Aufbau seiner Ästhetik, man mag etwa
rinden, daß deren Problemstellung sich schon lange nicht mehr verteidigen läßt
— immer wieder muß man doch auf die inhaltsschweren Schriften des schwäbi-
schen Philosophen zurückgreifen, sobald die Reflexion über Schönheit und Kunst
sich nicht mehr mit dem Einblick in das Schaffen des Künstlers, in die Stilrichtun-
gen usw. begnügt, sondern danach strebt, die geheimnisvollen Beziehungen der
Kunst zum Ganzen des menschlichen Ahnens und Erkennens zu erhellen. Außer-
dem: die reich differenzierte Persönlichkeit dieses Mannes gibt den Fragen, mit
denen er sich lebendig assimiliert, einen menschlichen Wert, der uns dauernd fes-
selt. Eine Seele atmet, eine Zeit pulsiert in diesen Kunstbetrachtungen.
Die Arbeit von E. Volhard ist besonders deshalb verdienstvoll, weil sie uns,
anstatt einer unmöglichen systematischen, abgerundeten Darstellung des Vischer-
schen Denkens, gleichsam eine Reihe von Aufnahmen bietet, die sich zu einem frei-
lich variierenden, aber umso naturwahreren Porträt verschmelzen, und unser Inter-
esse für diese dauernd wechselnde, in sich gespaltene, und doch kräftig zupackende,
energievolle Natur erneut und erhöht.
Gleich bei der ersten Auseinandersetzung des jungen Theologen mit seinem
Freund Strauss über Sinn und Wert des Mythus, über seine Bedeutung in der
Kunst sind die Gegensätze da. Sie sind nicht nur da zwischen Freunden, die sich in
dieser für sie lebenswichtigen Frage nicht einigen können: sie sind auch da in
Vischers Seele, die, zwischen der Zerstörung des Mythenglaubens aus philosophi-
schem Interesse und dessen Beibehaltung aus künstlerischer Liebe schwankt, und
den einzigen Ausweg findet in einer „Reduktion", die uns, qualvoll genug, mit
großem Aufwand von Kasuistik empfohlen wird.
Der Zwiespalt, von dem wir reden, ist in der weiteren Entwicklung Vischers
nie überwunden worden. Das hindert uns wohl daran, sein Werk in eine bestimmte
Kategorie einzuordnen. Derjenige aber, dem das Definieren nicht so wichtig ist wie
das Sicheinfühlen, freut sich, daß die Vertiefung der Gegensätze im Innenleben
dieses Kunstphilosophen uns solche Schätze beweglichen Denkens geschenkt hat.
Gewiß hat dieser streitbare Hegelianer die Hegeische Idee nicht so hoch gefaßt wie
sein Meister. Bei Vischer hat die Idee nicht mehr eine solche Macht der Verwirk-
lichung, noch sind ihm die dialektischen Bewegungen des Geistes identisch mit
Weltbewegungen. Reichte etwa seine spekulative Kraft nicht dazu? Wichtiger ist,
daß er die Gleichsetzung der menschlichen mit der göttlichen Vernunft ablehnte,
weil sein Lebensgefühl, sein lebendiger Kontakt mit den Dingen einer solchen
Gleichsetzung widersprach. Einem Kierkegaard wird man auch nicht die speku-