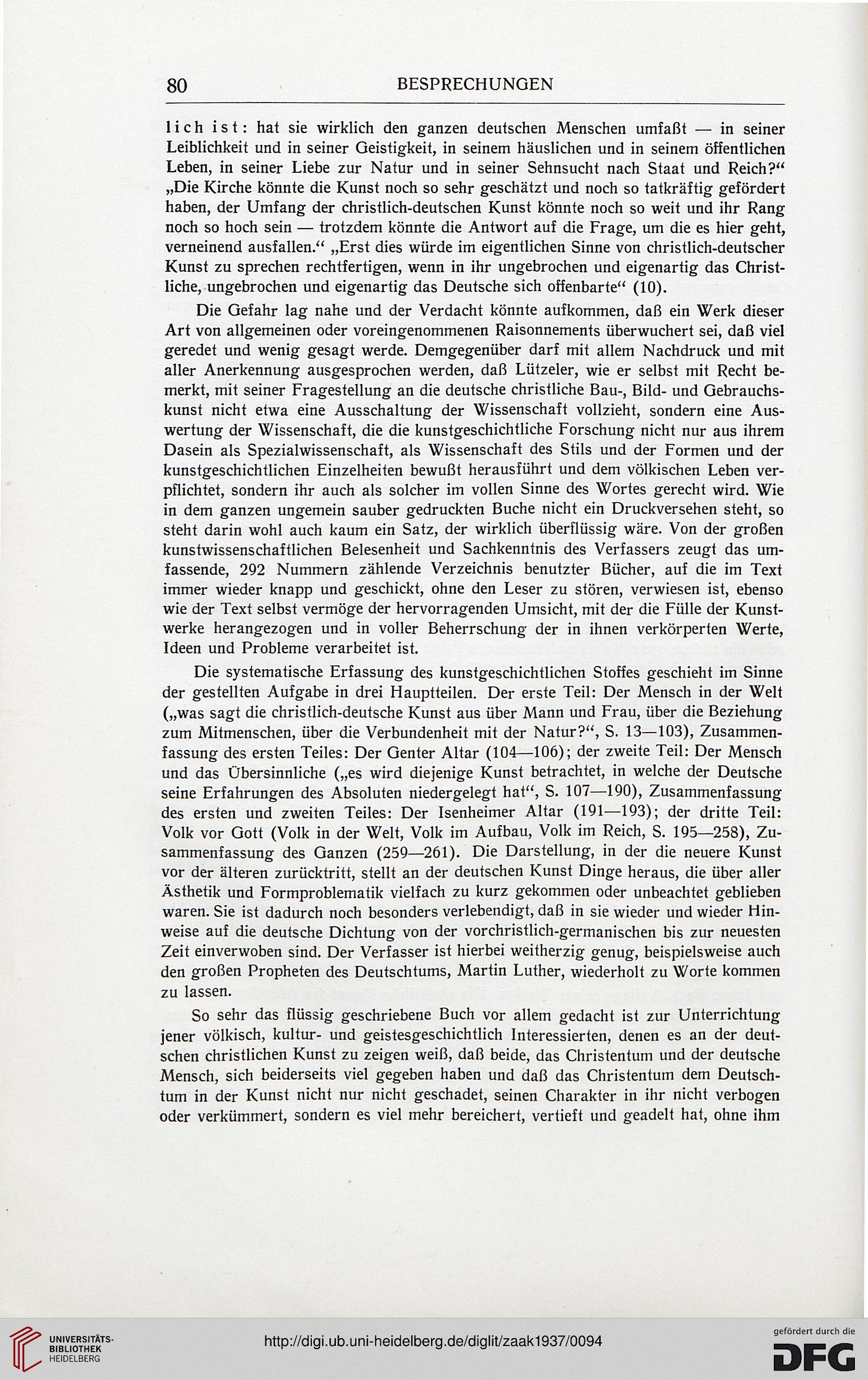80
BESPRECHUNGEN
lieh ist: hat sie wirklich den ganzen deutschen Menschen umfaßt — in seiner
Leiblichkeit und in seiner Geistigkeit, in seinem häuslichen und in seinem öffentlichen
Leben, in seiner Liebe zur Natur und in seiner Sehnsucht nach Staat und Reich?"
„Die Kirche könnte die Kunst noch so sehr geschätzt und noch so tatkräftig gefördert
haben, der Umfang der christlich-deutschen Kunst könnte noch so weit und ihr Rang
noch so hoch sein — trotzdem könnte die Antwort auf die Frage, um die es hier geht,
verneinend ausfallen." „Erst dies würde im eigentlichen Sinne von christlich-deutscher
Kunst zu sprechen rechtfertigen, wenn in ihr ungebrochen und eigenartig das Christ-
liche, ungebrochen und eigenartig das Deutsche sich offenbarte" (10).
Die Gefahr lag nahe und der Verdacht könnte aufkommen, daß ein Werk dieser
Art von allgemeinen oder voreingenommenen Raisonnements überwuchert sei, daß viel
geredet und wenig gesagt werde. Demgegenüber darf mit allem Nachdruck und mit
aller Anerkennung ausgesprochen werden, daß Lützeler, wie er selbst mit Recht be-
merkt, mit seiner Fragestellung an die deutsche christliche Bau-, Bild- und Gebrauchs-
kunst nicht etwa eine Ausschaltung der Wissenschaft vollzieht, sondern eine Aus-
wertung der Wissenschaft, die die kunstgeschichtliche Forschung nicht nur aus ihrem
Dasein als SpezialWissenschaft, als Wissenschaft des Stils und der Formen und der
kunstgeschichtlichen Einzelheiten bewußt herausführt und dem völkischen Leben ver-
pflichtet, sondern ihr auch als solcher im vollen Sinne des Wortes gerecht wird. Wie
in dem ganzen ungemein sauber gedruckten Buche nicht ein Druckversehen steht, so
steht darin wohl auch kaum ein Satz, der wirklich überflüssig wäre. Von der großen
kunstwissenschaftlichen Belesenheit und Sachkenntnis des Verfassers zeugt das um-
fassende, 292 Nummern zählende Verzeichnis benutzter Bücher, auf die im Text
immer wieder knapp und geschickt, ohne den Leser zu stören, verwiesen ist, ebenso
wie der Text selbst vermöge der hervorragenden Umsicht, mit der die Fülle der Kunst-
werke herangezogen und in voller Beherrschung der in ihnen verkörperten Werte,
Ideen und Probleme verarbeitet ist.
Die systematische Erfassung des kunstgeschichtlichen Stoffes geschieht im Sinne
der gestellten Aufgabe in drei Hauptteilen. Der erste Teil: Der Mensch in der Welt
(„was sagt die christlich-deutsche Kunst aus über Mann und Frau, über die Beziehung
zum Mitmenschen, über die Verbundenheit mit der Natur?", S. 13—103), Zusammen-
fassung des ersten Teiles: Der Genter Altar (104—106); der zweite Teil: Der Mensch
und das Übersinnliche („es wird diejenige Kunst betrachtet, in welche der Deutsche
seine Erfahrungen des Absoluten niedergelegt hat", S. 107—190), Zusammenfassung
des ersten und zweiten Teiles: Der Isenheimer Altar (191—193); der dritte Teil:
Volk vor Gott (Volk in der Welt, Volk im Aufbau, Volk im Reich, S. 195—258), Zu-
sammenfassung des Ganzen (259—261). Die Darstellung, in der die neuere Kunst
vor der älteren zurücktritt, stellt an der deutschen Kunst Dinge heraus, die über aller
Ästhetik und Formproblematik vielfach zu kurz gekommen oder unbeachtet geblieben
waren. Sie ist dadurch noch besonders verlebendigt, daß in sie wieder und wieder Hin-
weise auf die deutsche Dichtung von der vorchristlich-germanischen bis zur neuesten
Zeit einverwoben sind. Der Verfasser ist hierbei weitherzig genug, beispielsweise auch
den großen Propheten des Deutschtums, Martin Luther, wiederholt zu Worte kommen
zu lassen.
So sehr das flüssig geschriebene Buch vor allem gedacht ist zur Unterrichtung
jener völkisch, kultur- und geistesgeschichtlich Interessierten, denen es an der deut-
schen christlichen Kunst zu zeigen weiß, daß beide, das Christentum und der deutsche
Mensch, sich beiderseits viel gegeben haben und daß das Christentum dem Deutsch-
tum in der Kunst nicht nur nicht geschadet, seinen Charakter in ihr nicht verbogen
oder verkümmert, sondern es viel mehr bereichert, vertieft und geadelt hat, ohne ihm
BESPRECHUNGEN
lieh ist: hat sie wirklich den ganzen deutschen Menschen umfaßt — in seiner
Leiblichkeit und in seiner Geistigkeit, in seinem häuslichen und in seinem öffentlichen
Leben, in seiner Liebe zur Natur und in seiner Sehnsucht nach Staat und Reich?"
„Die Kirche könnte die Kunst noch so sehr geschätzt und noch so tatkräftig gefördert
haben, der Umfang der christlich-deutschen Kunst könnte noch so weit und ihr Rang
noch so hoch sein — trotzdem könnte die Antwort auf die Frage, um die es hier geht,
verneinend ausfallen." „Erst dies würde im eigentlichen Sinne von christlich-deutscher
Kunst zu sprechen rechtfertigen, wenn in ihr ungebrochen und eigenartig das Christ-
liche, ungebrochen und eigenartig das Deutsche sich offenbarte" (10).
Die Gefahr lag nahe und der Verdacht könnte aufkommen, daß ein Werk dieser
Art von allgemeinen oder voreingenommenen Raisonnements überwuchert sei, daß viel
geredet und wenig gesagt werde. Demgegenüber darf mit allem Nachdruck und mit
aller Anerkennung ausgesprochen werden, daß Lützeler, wie er selbst mit Recht be-
merkt, mit seiner Fragestellung an die deutsche christliche Bau-, Bild- und Gebrauchs-
kunst nicht etwa eine Ausschaltung der Wissenschaft vollzieht, sondern eine Aus-
wertung der Wissenschaft, die die kunstgeschichtliche Forschung nicht nur aus ihrem
Dasein als SpezialWissenschaft, als Wissenschaft des Stils und der Formen und der
kunstgeschichtlichen Einzelheiten bewußt herausführt und dem völkischen Leben ver-
pflichtet, sondern ihr auch als solcher im vollen Sinne des Wortes gerecht wird. Wie
in dem ganzen ungemein sauber gedruckten Buche nicht ein Druckversehen steht, so
steht darin wohl auch kaum ein Satz, der wirklich überflüssig wäre. Von der großen
kunstwissenschaftlichen Belesenheit und Sachkenntnis des Verfassers zeugt das um-
fassende, 292 Nummern zählende Verzeichnis benutzter Bücher, auf die im Text
immer wieder knapp und geschickt, ohne den Leser zu stören, verwiesen ist, ebenso
wie der Text selbst vermöge der hervorragenden Umsicht, mit der die Fülle der Kunst-
werke herangezogen und in voller Beherrschung der in ihnen verkörperten Werte,
Ideen und Probleme verarbeitet ist.
Die systematische Erfassung des kunstgeschichtlichen Stoffes geschieht im Sinne
der gestellten Aufgabe in drei Hauptteilen. Der erste Teil: Der Mensch in der Welt
(„was sagt die christlich-deutsche Kunst aus über Mann und Frau, über die Beziehung
zum Mitmenschen, über die Verbundenheit mit der Natur?", S. 13—103), Zusammen-
fassung des ersten Teiles: Der Genter Altar (104—106); der zweite Teil: Der Mensch
und das Übersinnliche („es wird diejenige Kunst betrachtet, in welche der Deutsche
seine Erfahrungen des Absoluten niedergelegt hat", S. 107—190), Zusammenfassung
des ersten und zweiten Teiles: Der Isenheimer Altar (191—193); der dritte Teil:
Volk vor Gott (Volk in der Welt, Volk im Aufbau, Volk im Reich, S. 195—258), Zu-
sammenfassung des Ganzen (259—261). Die Darstellung, in der die neuere Kunst
vor der älteren zurücktritt, stellt an der deutschen Kunst Dinge heraus, die über aller
Ästhetik und Formproblematik vielfach zu kurz gekommen oder unbeachtet geblieben
waren. Sie ist dadurch noch besonders verlebendigt, daß in sie wieder und wieder Hin-
weise auf die deutsche Dichtung von der vorchristlich-germanischen bis zur neuesten
Zeit einverwoben sind. Der Verfasser ist hierbei weitherzig genug, beispielsweise auch
den großen Propheten des Deutschtums, Martin Luther, wiederholt zu Worte kommen
zu lassen.
So sehr das flüssig geschriebene Buch vor allem gedacht ist zur Unterrichtung
jener völkisch, kultur- und geistesgeschichtlich Interessierten, denen es an der deut-
schen christlichen Kunst zu zeigen weiß, daß beide, das Christentum und der deutsche
Mensch, sich beiderseits viel gegeben haben und daß das Christentum dem Deutsch-
tum in der Kunst nicht nur nicht geschadet, seinen Charakter in ihr nicht verbogen
oder verkümmert, sondern es viel mehr bereichert, vertieft und geadelt hat, ohne ihm