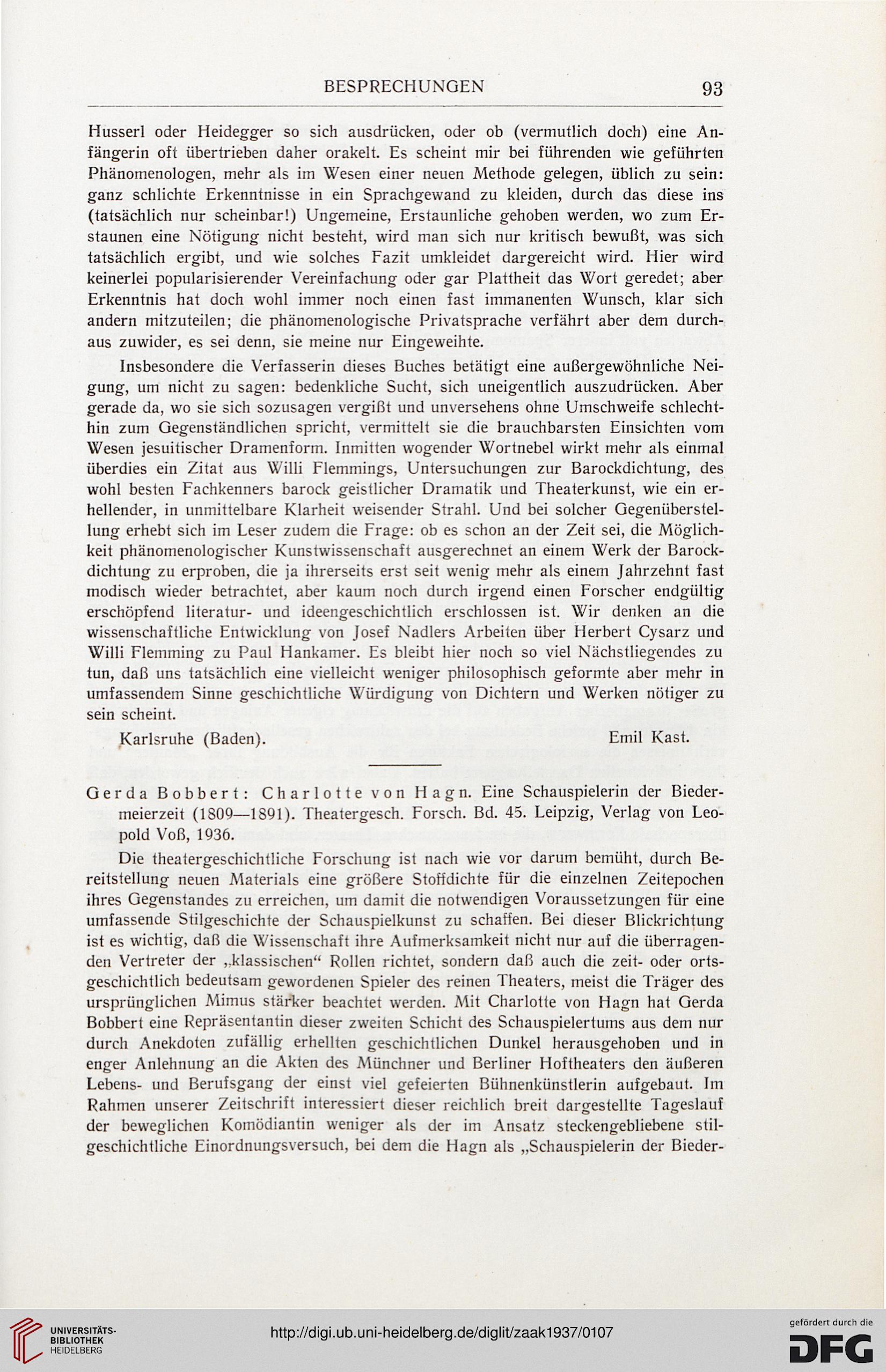BESPRECHUNGEN
93
Husserl oder Heidegger so sich ausdrücken, oder ob (vermutlich doch) eine An-
fängerin oft übertrieben daher orakelt. Es scheint mir bei führenden wie geführten
Phänomenologen, mehr als im Wesen einer neuen Methode gelegen, üblich zu sein:
ganz schlichte Erkenntnisse in ein Sprachgewand zu kleiden, durch das diese ins
(tatsächlich nur scheinbar!) Ungemeine, Erstaunliche gehoben werden, wo zum Er-
staunen eine Nötigung nicht besteht, wird man sich nur kritisch bewußt, was sich
tatsächlich ergibt, und wie solches Fazit umkleidet dargereicht wird. Hier wird
keinerlei popularisierender Vereinfachung oder gar Plattheit das Wort geredet; aber
Erkenntnis hat doch wohl immer noch einen fast immanenten Wunsch, klar sich
andern mitzuteilen; die phänomenologische Privatsprache verfährt aber dem durch-
aus zuwider, es sei denn, sie meine nur Eingeweihte.
Insbesondere die Verfasserin dieses Buches betätigt eine außergewöhnliche Nei-
gung, um nicht zu sagen: bedenkliche Sucht, sich uneigentlich auszudrücken. Aber
gerade da, wo sie sich sozusagen vergißt und unversehens ohne Umschweife schlecht-
hin zum Gegenständlichen spricht, vermittelt sie die brauchbarsten Einsichten vom
Wesen jesuitischer Dramenform. Inmitten wogender Wortnebel wirkt mehr als einmal
überdies ein Zitat aus Willi Flemmings, Untersuchungen zur Barockdichtung, des
wohl besten Fachkenners barock geistlicher Dramatik und Theaterkunst, wie ein er-
hellender, in unmittelbare Klarheit weisender Strahl. Und bei solcher Gegenüberstel-
lung erhebt sich im Leser zudem die Frage: ob es schon an der Zeit sei, die Möglich-
keit phänomenologischer Kunstwissenschaft ausgerechnet an einem Werk der Barock-
dichtung zu erproben, die ja ihrerseits erst seit wenig mehr als einem Jahrzehnt fast
modisch wieder betrachtet, aber kaum noch durch irgend einen Forscher endgültig
erschöpfend literatur- und ideengeschichtlich erschlossen ist. Wir denken an die
wissenschaftliche Entwicklung von Josef Nadlers Arbeiten über Herbert Cysarz und
Willi Flemming zu Paul Hankamer. Es bleibt hier noch so viel Nächstliegendes zu
tun, daß uns tatsächlich eine vielleicht weniger philosophisch geformte aber mehr in
umfassendem Sinne geschichtliche Würdigung von Dichtern und Werken nötiger zu
sein scheint.
Karlsruhe (Baden). Emil Kast.
Gerda Bobbert: Charlotte von Hagn. Eine Schauspielerin der Bieder-
meierzeit (1809—1891). Theatergesch. Forsch. Bd. 45. Leipzig, Verlag von Leo-
pold Voß, 1936.
Die theatergeschichtliche Forschung ist nach wie vor darum bemüht, durch Be-
reitstellung neuen Materials eine größere Stoffdichte für die einzelnen Zeitepochen
ihres Gegenstandes zu erreichen, um damit die notwendigen Voraussetzungen für eine
umfassende Stilgeschichte der Schauspielkunst zu schaffen. Bei dieser Blickrichtung
ist es wichtig, daß die Wissenschaft ihre Aufmerksamkeit nicht nur auf die überragen-
den Vertreter der „klassischen" Rollen richtet, sondern daß auch die zeit- oder orts-
geschichtlich bedeutsam gewordenen Spieler des reinen Theaters, meist die Träger des
ursprünglichen Mimus stärker beachtet werden. Mit Charlotte von Hagn hat Gerda
Bobbert eine Repräsentantin dieser zweiten Schicht des Schauspielertums aus dem nur
durch Anekdoten zufällig erhellten geschichtlichen Dunkel herausgehoben und in
enger Anlehnung an die Akten des Münchner und Berliner Hoftheaters den äußeren
Lebens- und Berufsgang der einst viel gefeierten Bühnenkünstlerin aufgebaut. Im
Rahmen unserer Zeitschrift interessiert dieser reichlich breit dargestellte Tageslauf
der beweglichen Komödiantin weniger als der im Ansatz steckengebliebene stil-
geschichtliche Einordnungsversuch, bei dem die Hagn als „Schauspielerin der Bieder-
93
Husserl oder Heidegger so sich ausdrücken, oder ob (vermutlich doch) eine An-
fängerin oft übertrieben daher orakelt. Es scheint mir bei führenden wie geführten
Phänomenologen, mehr als im Wesen einer neuen Methode gelegen, üblich zu sein:
ganz schlichte Erkenntnisse in ein Sprachgewand zu kleiden, durch das diese ins
(tatsächlich nur scheinbar!) Ungemeine, Erstaunliche gehoben werden, wo zum Er-
staunen eine Nötigung nicht besteht, wird man sich nur kritisch bewußt, was sich
tatsächlich ergibt, und wie solches Fazit umkleidet dargereicht wird. Hier wird
keinerlei popularisierender Vereinfachung oder gar Plattheit das Wort geredet; aber
Erkenntnis hat doch wohl immer noch einen fast immanenten Wunsch, klar sich
andern mitzuteilen; die phänomenologische Privatsprache verfährt aber dem durch-
aus zuwider, es sei denn, sie meine nur Eingeweihte.
Insbesondere die Verfasserin dieses Buches betätigt eine außergewöhnliche Nei-
gung, um nicht zu sagen: bedenkliche Sucht, sich uneigentlich auszudrücken. Aber
gerade da, wo sie sich sozusagen vergißt und unversehens ohne Umschweife schlecht-
hin zum Gegenständlichen spricht, vermittelt sie die brauchbarsten Einsichten vom
Wesen jesuitischer Dramenform. Inmitten wogender Wortnebel wirkt mehr als einmal
überdies ein Zitat aus Willi Flemmings, Untersuchungen zur Barockdichtung, des
wohl besten Fachkenners barock geistlicher Dramatik und Theaterkunst, wie ein er-
hellender, in unmittelbare Klarheit weisender Strahl. Und bei solcher Gegenüberstel-
lung erhebt sich im Leser zudem die Frage: ob es schon an der Zeit sei, die Möglich-
keit phänomenologischer Kunstwissenschaft ausgerechnet an einem Werk der Barock-
dichtung zu erproben, die ja ihrerseits erst seit wenig mehr als einem Jahrzehnt fast
modisch wieder betrachtet, aber kaum noch durch irgend einen Forscher endgültig
erschöpfend literatur- und ideengeschichtlich erschlossen ist. Wir denken an die
wissenschaftliche Entwicklung von Josef Nadlers Arbeiten über Herbert Cysarz und
Willi Flemming zu Paul Hankamer. Es bleibt hier noch so viel Nächstliegendes zu
tun, daß uns tatsächlich eine vielleicht weniger philosophisch geformte aber mehr in
umfassendem Sinne geschichtliche Würdigung von Dichtern und Werken nötiger zu
sein scheint.
Karlsruhe (Baden). Emil Kast.
Gerda Bobbert: Charlotte von Hagn. Eine Schauspielerin der Bieder-
meierzeit (1809—1891). Theatergesch. Forsch. Bd. 45. Leipzig, Verlag von Leo-
pold Voß, 1936.
Die theatergeschichtliche Forschung ist nach wie vor darum bemüht, durch Be-
reitstellung neuen Materials eine größere Stoffdichte für die einzelnen Zeitepochen
ihres Gegenstandes zu erreichen, um damit die notwendigen Voraussetzungen für eine
umfassende Stilgeschichte der Schauspielkunst zu schaffen. Bei dieser Blickrichtung
ist es wichtig, daß die Wissenschaft ihre Aufmerksamkeit nicht nur auf die überragen-
den Vertreter der „klassischen" Rollen richtet, sondern daß auch die zeit- oder orts-
geschichtlich bedeutsam gewordenen Spieler des reinen Theaters, meist die Träger des
ursprünglichen Mimus stärker beachtet werden. Mit Charlotte von Hagn hat Gerda
Bobbert eine Repräsentantin dieser zweiten Schicht des Schauspielertums aus dem nur
durch Anekdoten zufällig erhellten geschichtlichen Dunkel herausgehoben und in
enger Anlehnung an die Akten des Münchner und Berliner Hoftheaters den äußeren
Lebens- und Berufsgang der einst viel gefeierten Bühnenkünstlerin aufgebaut. Im
Rahmen unserer Zeitschrift interessiert dieser reichlich breit dargestellte Tageslauf
der beweglichen Komödiantin weniger als der im Ansatz steckengebliebene stil-
geschichtliche Einordnungsversuch, bei dem die Hagn als „Schauspielerin der Bieder-