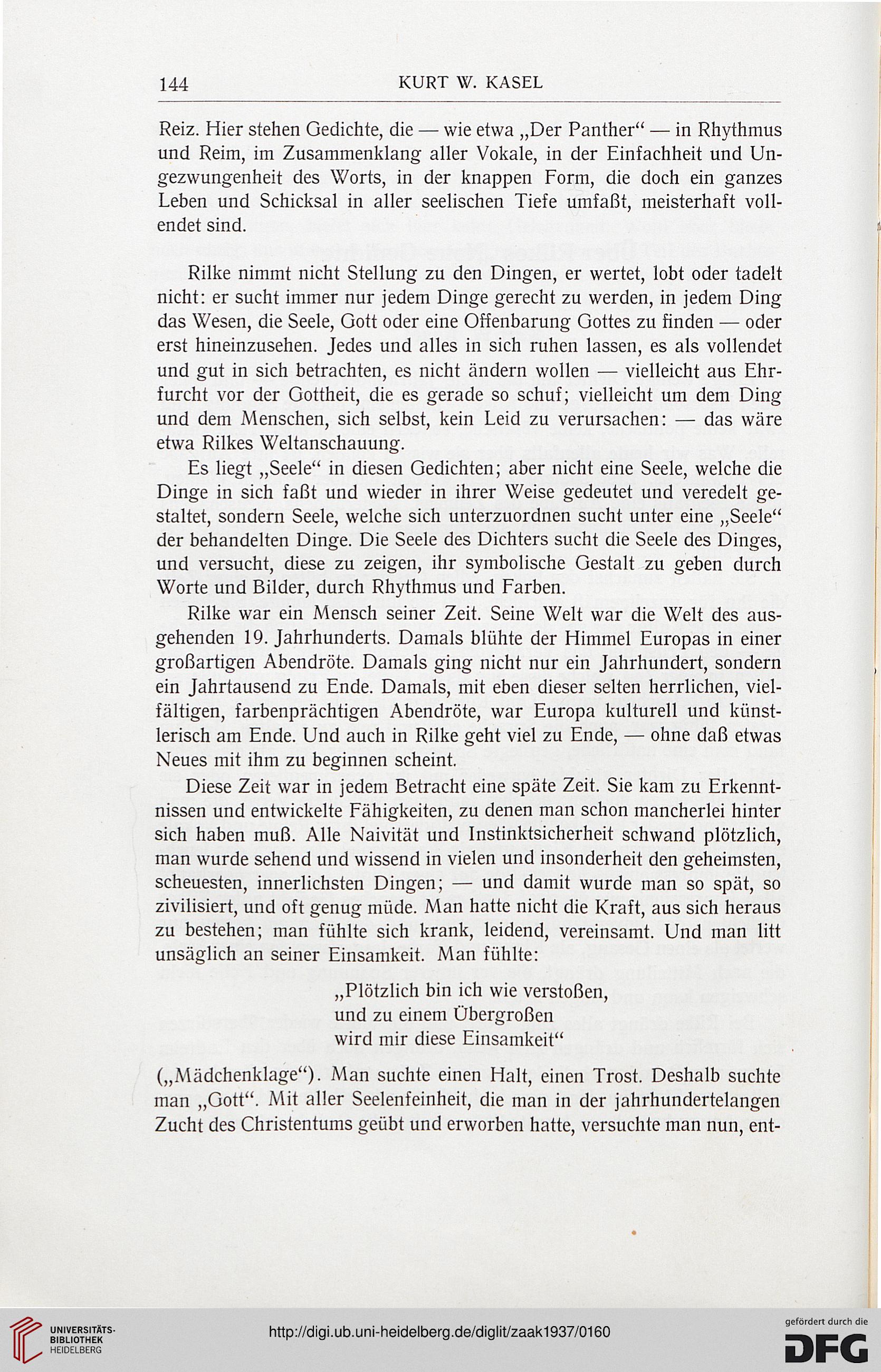144
KURT W. KASEL
Reiz. Hier stehen Gedichte, die — wie etwa „Der Panther" — in Rhythmus
und Reim, im Zusammenklang aller Vokale, in der Einfachheit und Un-
gezwungenheit des Worts, in der knappen Form, die doch ein ganzes
Leben und Schicksal in aller seelischen Tiefe umfaßt, meisterhaft voll-
endet sind.
Rilke nimmt nicht Stellung zu den Dingen, er wertet, lobt oder tadelt
nicht: er sucht immer nur jedem Dinge gerecht zu werden, in jedem Ding
das Wesen, die Seele, Gott oder eine Offenbarung Gottes zu finden — oder
erst hineinzusehen. Jedes und alles in sich ruhen lassen, es als vollendet
und gut in sich betrachten, es nicht ändern wollen — vielleicht aus Ehr-
furcht vor der Gottheit, die es gerade so schuf; vielleicht um dem Ding
und dem Menschen, sich selbst, kein Leid zu verursachen: — das wäre
etwa Rilkes Weltanschauung.
Es liegt „Seele" in diesen Gedichten; aber nicht eine Seele, welche die
Dinge in sich faßt und wieder in ihrer Weise gedeutet und veredelt ge-
staltet, sondern Seele, welche sich unterzuordnen sucht unter eine „Seele"
der behandelten Dinge. Die Seele des Dichters sucht die Seele des Dinges,
und versucht, diese zu zeigen, ihr symbolische Gestalt zu geben durch
Worte und Bilder, durch Rhythmus und Farben.
Rilke war ein Mensch seiner Zeit. Seine Welt war die Welt des aus-
gehenden 19. Jahrhunderts. Damals blühte der Himmel Europas in einer
großartigen Abendröte. Damals ging nicht nur ein Jahrhundert, sondern
ein Jahrtausend zu Ende. Damals, mit eben dieser selten herrlichen, viel-
fältigen, farbenprächtigen Abendröte, war Europa kulturell und künst-
lerisch am Ende. Und auch in Rilke geht viel zu Ende, — ohne daß etwas
Neues mit ihm zu beginnen scheint.
Diese Zeit war in jedem Betracht eine späte Zeit. Sie kam zu Erkennt-
nissen und entwickelte Fähigkeiten, zu denen man schon mancherlei hinter
sich haben muß. Alle Naivität und Instinktsicherheit schwand plötzlich,
man wurde sehend und wissend in vielen und insonderheit den geheimsten,
scheuesten, innerlichsten Dingen; — und damit wurde man so spät, so
zivilisiert, und oft genug müde. Man hatte nicht die Kraft, aus sich heraus
zu bestehen; man fühlte sich krank, leidend, vereinsamt. Und man litt
unsäglich an seiner Einsamkeit. Man fühlte:
„Plötzlich bin ich wie verstoßen,
und zu einem Übergroßen
wird mir diese Einsamkeit"
(„Mädchenklage"). Man suchte einen Halt, einen Trost. Deshalb suchte
man „Gott". Mit aller Seelenfeinheit, die man in der jahrhundertelangen
Zucht des Christentums geübt und erworben hatte, versuchte man nun, ent-
KURT W. KASEL
Reiz. Hier stehen Gedichte, die — wie etwa „Der Panther" — in Rhythmus
und Reim, im Zusammenklang aller Vokale, in der Einfachheit und Un-
gezwungenheit des Worts, in der knappen Form, die doch ein ganzes
Leben und Schicksal in aller seelischen Tiefe umfaßt, meisterhaft voll-
endet sind.
Rilke nimmt nicht Stellung zu den Dingen, er wertet, lobt oder tadelt
nicht: er sucht immer nur jedem Dinge gerecht zu werden, in jedem Ding
das Wesen, die Seele, Gott oder eine Offenbarung Gottes zu finden — oder
erst hineinzusehen. Jedes und alles in sich ruhen lassen, es als vollendet
und gut in sich betrachten, es nicht ändern wollen — vielleicht aus Ehr-
furcht vor der Gottheit, die es gerade so schuf; vielleicht um dem Ding
und dem Menschen, sich selbst, kein Leid zu verursachen: — das wäre
etwa Rilkes Weltanschauung.
Es liegt „Seele" in diesen Gedichten; aber nicht eine Seele, welche die
Dinge in sich faßt und wieder in ihrer Weise gedeutet und veredelt ge-
staltet, sondern Seele, welche sich unterzuordnen sucht unter eine „Seele"
der behandelten Dinge. Die Seele des Dichters sucht die Seele des Dinges,
und versucht, diese zu zeigen, ihr symbolische Gestalt zu geben durch
Worte und Bilder, durch Rhythmus und Farben.
Rilke war ein Mensch seiner Zeit. Seine Welt war die Welt des aus-
gehenden 19. Jahrhunderts. Damals blühte der Himmel Europas in einer
großartigen Abendröte. Damals ging nicht nur ein Jahrhundert, sondern
ein Jahrtausend zu Ende. Damals, mit eben dieser selten herrlichen, viel-
fältigen, farbenprächtigen Abendröte, war Europa kulturell und künst-
lerisch am Ende. Und auch in Rilke geht viel zu Ende, — ohne daß etwas
Neues mit ihm zu beginnen scheint.
Diese Zeit war in jedem Betracht eine späte Zeit. Sie kam zu Erkennt-
nissen und entwickelte Fähigkeiten, zu denen man schon mancherlei hinter
sich haben muß. Alle Naivität und Instinktsicherheit schwand plötzlich,
man wurde sehend und wissend in vielen und insonderheit den geheimsten,
scheuesten, innerlichsten Dingen; — und damit wurde man so spät, so
zivilisiert, und oft genug müde. Man hatte nicht die Kraft, aus sich heraus
zu bestehen; man fühlte sich krank, leidend, vereinsamt. Und man litt
unsäglich an seiner Einsamkeit. Man fühlte:
„Plötzlich bin ich wie verstoßen,
und zu einem Übergroßen
wird mir diese Einsamkeit"
(„Mädchenklage"). Man suchte einen Halt, einen Trost. Deshalb suchte
man „Gott". Mit aller Seelenfeinheit, die man in der jahrhundertelangen
Zucht des Christentums geübt und erworben hatte, versuchte man nun, ent-