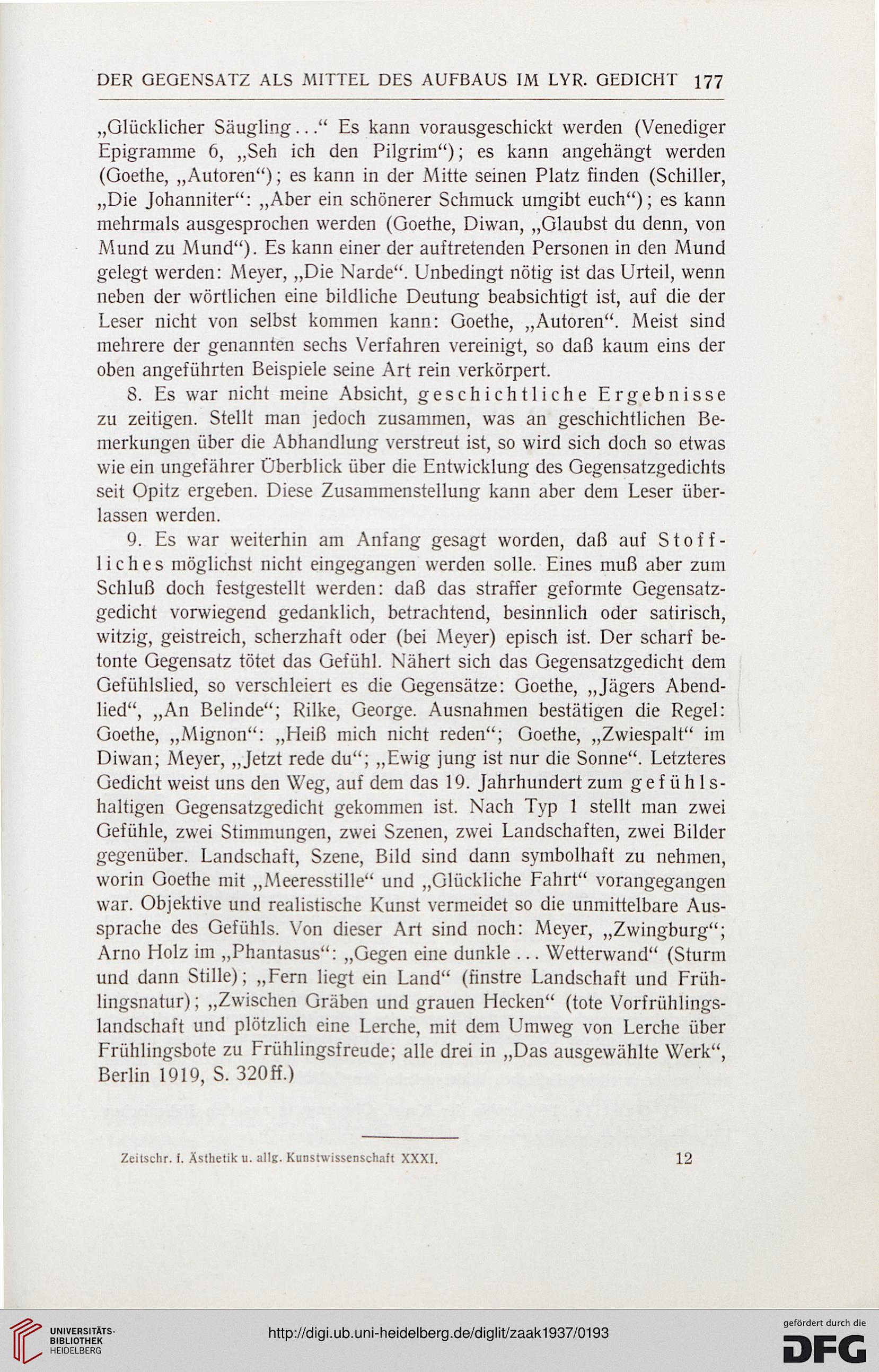DER GEGENSATZ ALS MITTEL DES AUFBAUS IM LYR. GEDICHT 177
„Glücklicher Säugling..." Es kann vorausgeschickt werden (Venediger
Epigramme 6, „Seh ich den Pilgrim"); es kann angehängt werden
(Goethe, „Autoren"); es kann in der Mitte seinen Platz finden (Schiller,
„Die Johanniter": „Aber ein schönerer Schmuck umgibt euch"); es kann
mehrmals ausgesprochen werden (Goethe, Diwan, „Glaubst du denn, von
Mund zu Mund"). Es kann einer der auftretenden Personen in den Mund
gelegt werden: Meyer, „Die Narde". Unbedingt nötig ist das Urteil, wenn
neben der wörtlichen eine bildliche Deutung beabsichtigt ist, auf die der
Leser nicht von selbst kommen kann: Goethe, „Autoren". Meist sind
mehrere der genannten sechs Verfahren vereinigt, so daß kaum eins der
oben angeführten Beispiele seine Art rein verkörpert.
8. Es war nicht meine Absicht, geschichtliche Ergebnisse
zu zeitigen. Stellt man jedoch zusammen, was an geschichtlichen Be-
merkungen über die Abhandlung verstreut ist, so wird sich doch so etwas
wie ein ungefährer Überblick über die Entwicklung des Gegensatzgedichts
seit Opitz ergeben. Diese Zusammenstellung kann aber dem Leser über-
lassen werden.
9. Es war weiterhin am Anfang gesagt worden, daß auf Stoff-
liches möglichst nicht eingegangen werden solle. Eines muß aber zum
Schluß doch festgestellt werden: daß das straffer geformte Gegensatz-
gedicht vorwiegend gedanklich, betrachtend, besinnlich oder satirisch,
witzig, geistreich, scherzhaft oder (bei Meyer) episch ist. Der scharf be-
tonte Gegensatz tötet das Gefühl. Nähert sich das Gegensatzgedicht dem
Gefühlslied, so verschleiert es die Gegensätze: Goethe, „Jägers Abend-
lied", „An Belinde"; Rilke, George. Ausnahmen bestätigen die Regel:
Goethe, „Mignon": „Heiß mich nicht reden"; Goethe, „Zwiespalt" im
Diwan; Meyer, „Jetzt rede du"; „Ewig jung ist nur die Sonne". Letzteres
Gedicht weist uns den Weg, auf dem das 19. Jahrhundert zum ge f ü h 1 s-
haltigen Gegensatzgedicht gekommen ist. Nach Typ 1 stellt man zwei
Gefühle, zwei Stimmungen, zwei Szenen, zwei Landschaften, zwei Bilder
gegenüber. Landschaft, Szene, Bild sind dann symbolhaft zu nehmen,
worin Goethe mit „Meeresstille" und „Glückliche Fahrt" vorangegangen
war. Objektive und realistische Kunst vermeidet so die unmittelbare Aus-
sprache des Gefühls. Von dieser Art sind noch: Meyer, „Zwingburg";
Arno Holz im „Phantasus": „Gegen eine dunkle ... Wetterwand" (Sturm
und dann Stille); „Fern liegt ein Land" (finstre Landschaft und Früh-
lingsnatur) ; „Zwischen Gräben und grauen Hecken" (tote Vorfrühlings-
landschaft und plötzlich eine Lerche, mit dem Umweg von Lerche über
Frühlingsbote zu Frühlingsfreude; alle drei in „Das ausgewählte Werk",
Berlin 1919, S. 320ff.)
Zeitschr. f. Ästhetik u. allg. Kunstwissenschaft XXXI.
12
„Glücklicher Säugling..." Es kann vorausgeschickt werden (Venediger
Epigramme 6, „Seh ich den Pilgrim"); es kann angehängt werden
(Goethe, „Autoren"); es kann in der Mitte seinen Platz finden (Schiller,
„Die Johanniter": „Aber ein schönerer Schmuck umgibt euch"); es kann
mehrmals ausgesprochen werden (Goethe, Diwan, „Glaubst du denn, von
Mund zu Mund"). Es kann einer der auftretenden Personen in den Mund
gelegt werden: Meyer, „Die Narde". Unbedingt nötig ist das Urteil, wenn
neben der wörtlichen eine bildliche Deutung beabsichtigt ist, auf die der
Leser nicht von selbst kommen kann: Goethe, „Autoren". Meist sind
mehrere der genannten sechs Verfahren vereinigt, so daß kaum eins der
oben angeführten Beispiele seine Art rein verkörpert.
8. Es war nicht meine Absicht, geschichtliche Ergebnisse
zu zeitigen. Stellt man jedoch zusammen, was an geschichtlichen Be-
merkungen über die Abhandlung verstreut ist, so wird sich doch so etwas
wie ein ungefährer Überblick über die Entwicklung des Gegensatzgedichts
seit Opitz ergeben. Diese Zusammenstellung kann aber dem Leser über-
lassen werden.
9. Es war weiterhin am Anfang gesagt worden, daß auf Stoff-
liches möglichst nicht eingegangen werden solle. Eines muß aber zum
Schluß doch festgestellt werden: daß das straffer geformte Gegensatz-
gedicht vorwiegend gedanklich, betrachtend, besinnlich oder satirisch,
witzig, geistreich, scherzhaft oder (bei Meyer) episch ist. Der scharf be-
tonte Gegensatz tötet das Gefühl. Nähert sich das Gegensatzgedicht dem
Gefühlslied, so verschleiert es die Gegensätze: Goethe, „Jägers Abend-
lied", „An Belinde"; Rilke, George. Ausnahmen bestätigen die Regel:
Goethe, „Mignon": „Heiß mich nicht reden"; Goethe, „Zwiespalt" im
Diwan; Meyer, „Jetzt rede du"; „Ewig jung ist nur die Sonne". Letzteres
Gedicht weist uns den Weg, auf dem das 19. Jahrhundert zum ge f ü h 1 s-
haltigen Gegensatzgedicht gekommen ist. Nach Typ 1 stellt man zwei
Gefühle, zwei Stimmungen, zwei Szenen, zwei Landschaften, zwei Bilder
gegenüber. Landschaft, Szene, Bild sind dann symbolhaft zu nehmen,
worin Goethe mit „Meeresstille" und „Glückliche Fahrt" vorangegangen
war. Objektive und realistische Kunst vermeidet so die unmittelbare Aus-
sprache des Gefühls. Von dieser Art sind noch: Meyer, „Zwingburg";
Arno Holz im „Phantasus": „Gegen eine dunkle ... Wetterwand" (Sturm
und dann Stille); „Fern liegt ein Land" (finstre Landschaft und Früh-
lingsnatur) ; „Zwischen Gräben und grauen Hecken" (tote Vorfrühlings-
landschaft und plötzlich eine Lerche, mit dem Umweg von Lerche über
Frühlingsbote zu Frühlingsfreude; alle drei in „Das ausgewählte Werk",
Berlin 1919, S. 320ff.)
Zeitschr. f. Ästhetik u. allg. Kunstwissenschaft XXXI.
12