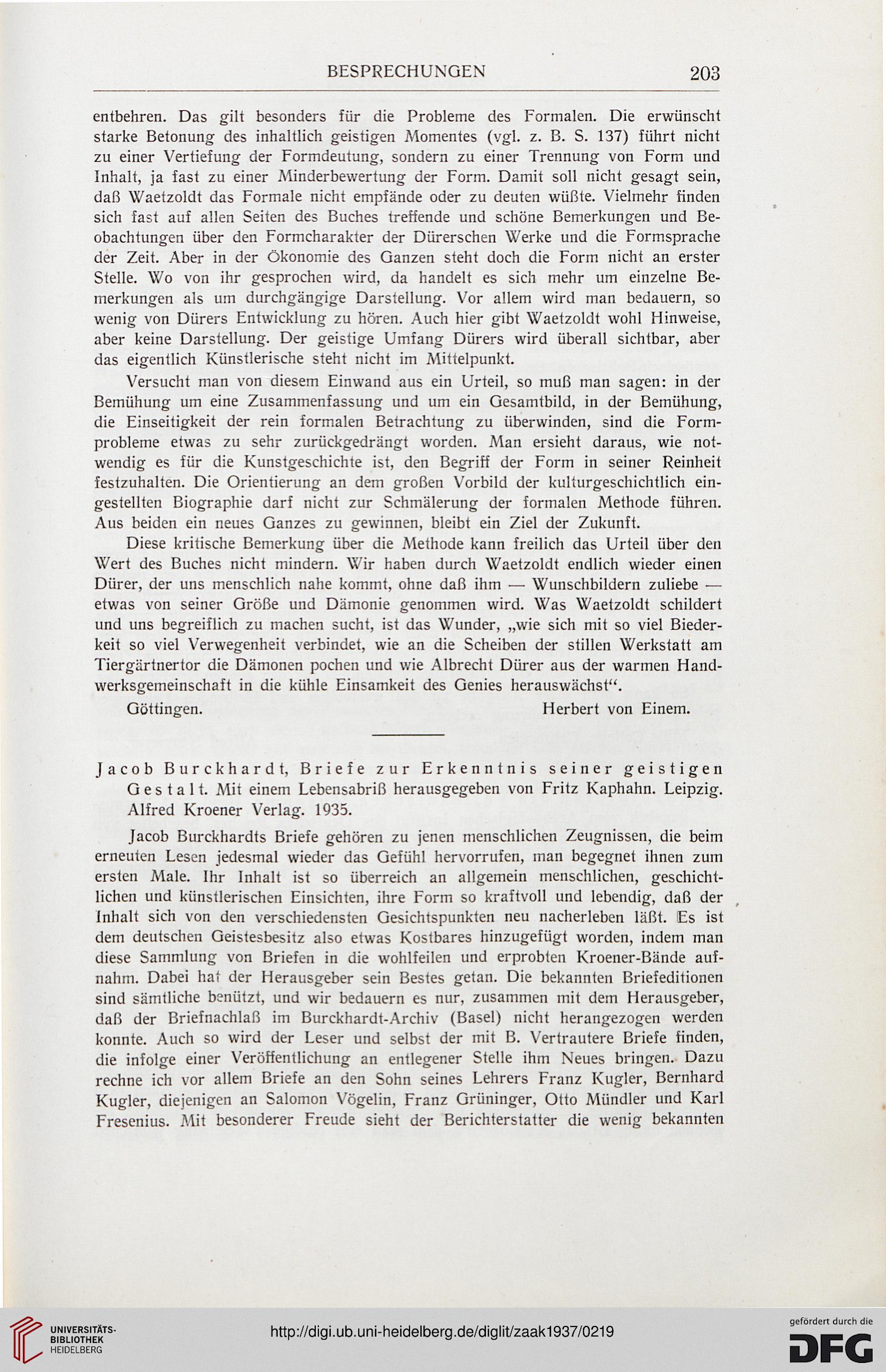BESPRECHUNGEN
203
entbehren. Das gilt besonders für die Probleme des Formalen. Die erwünscht
starke Betonung des inhaltlich geistigen Momentes (vgl. z. B. S. 137) führt nicht
zu einer Vertiefung der Formdeutung, sondern zu einer Trennung von Form und
Inhalt, ja fast zu einer Minderbewertung der Form. Damit soll nicht gesagt sein,
daß Waetzoldt das Formale nicht empfände oder zu deuten wüßte. Vielmehr rinden
sich fast auf allen Seiten des Buches treffende und schöne Bemerkungen und Be-
obachtungen über den Formcharakter der Dürerschen Werke und die Formsprache
der Zeit. Aber in der Ökonomie des Ganzen steht doch die Form nicht an erster
Stelle. Wo von ihr gesprochen wird, da handelt es sich mehr um einzelne Be-
merkungen als um durchgängige Darstellung. Vor allem wird man bedauern, so
wenig von Dürers Entwicklung zu hören. Auch hier gibt Waetzoldt wohl Hinweise,
aber keine Darstellung. Der geistige Umfang Dürers wird überall sichtbar, aber
das eigentlich Künstlerische steht nicht im Mittelpunkt.
Versucht man von diesem Einwand aus ein Urteil, so muß man sagen: in der
Bemühung um eine Zusammenfassung und um ein Gesamtbild, in der Bemühung,
die Einseitigkeit der rein formalen Betrachtung zu überwinden, sind die Form-
probleme etwas zu sehr zurückgedrängt worden. Man ersieht daraus, wie not-
wendig es für die Kunstgeschichte ist, den Begriff der Form in seiner Reinheit
festzuhalten. Die Orientierung an dem großen Vorbild der kulturgeschichtlich ein-
gestellten Biographie darf nicht zur Schmälerung der formalen Methode führen.
Aus beiden ein neues Ganzes zu gewinnen, bleibt ein Ziel der Zukunft.
Diese kritische Bemerkung über die Methode kann freilich das Urteil über den
Wert des Buches nicht mindern. Wir haben durch Waetzoldt endlich wieder einen
Dürer, der uns menschlich nahe kommt, ohne daß ihm ■— Wunschbildern zuliebe —
etwas von seiner Größe und Dämonie genommen wird. Was Waetzoldt schildert
und uns begreiflich zu machen sucht, ist das Wunder, „wie sich mit so viel Bieder-
keit so viel Verwegenheit verbindet, wie an die Scheiben der stillen Werkstatt am
Tiergärtnertor die Dämonen pochen und wie Albrecht Dürer aus der warmen Hand-
werksgemeinschaft in die kühle Einsamkeit des Genies herauswächst".
Göttingen. Herbert von Einem.
Jacob Burckhardt, Briefe zur Erkenntnis seiner geistigen
Gestalt. Mit einem Lebensabriß herausgegeben von Fritz Kaphahn. Leipzig.
Alfred Kroener Verlag. 1935.
Jacob Burckhardts Briefe gehören zu jenen menschlichen Zeugnissen, die beim
erneuten Lesen jedesmal wieder das Gefühl hervorrufen, man begegnet ihnen zum
ersten Male. Ihr Inhalt ist so überreich an allgemein menschlichen, geschicht-
lichen und künstlerischen Einsichten, ihre Form so kraftvoll und lebendig, daß der
Inhalt sich von den verschiedensten Gesichtspunkten neu nacherleben läßt. Es ist
dem deutschen Geistesbesitz also etwas Kostbares hinzugefügt worden, indem man
diese Sammlung von Briefen in die wohlfeilen und erprobten Kroener-Bände auf-
nahm. Dabei hat der Herausgeber sein Bestes getan. Die bekannten Briefeditionen
sind sämtliche benützt, und wir bedauern es nur, zusammen mit dem Herausgeber,
daß der Briefnachlaß im Burckhardt-Archiv (Basel) nicht herangezogen werden
konnte. Auch so wird der Leser und selbst der mit B. Vertrautere Briefe finden,
die infolge einer Veröffentlichung an entlegener Stelle ihm Neues bringen. Dazu
rechne ich vor allem Briefe an den Sohn seines Lehrers Franz Kugler, Bernhard
Kugler, diejenigen an Salomon Vögelin, Franz Grüninger, Otto Mündler und Karl
Fresenius. Mit besonderer Freude sieht der Berichterstatter die wenig bekannten
203
entbehren. Das gilt besonders für die Probleme des Formalen. Die erwünscht
starke Betonung des inhaltlich geistigen Momentes (vgl. z. B. S. 137) führt nicht
zu einer Vertiefung der Formdeutung, sondern zu einer Trennung von Form und
Inhalt, ja fast zu einer Minderbewertung der Form. Damit soll nicht gesagt sein,
daß Waetzoldt das Formale nicht empfände oder zu deuten wüßte. Vielmehr rinden
sich fast auf allen Seiten des Buches treffende und schöne Bemerkungen und Be-
obachtungen über den Formcharakter der Dürerschen Werke und die Formsprache
der Zeit. Aber in der Ökonomie des Ganzen steht doch die Form nicht an erster
Stelle. Wo von ihr gesprochen wird, da handelt es sich mehr um einzelne Be-
merkungen als um durchgängige Darstellung. Vor allem wird man bedauern, so
wenig von Dürers Entwicklung zu hören. Auch hier gibt Waetzoldt wohl Hinweise,
aber keine Darstellung. Der geistige Umfang Dürers wird überall sichtbar, aber
das eigentlich Künstlerische steht nicht im Mittelpunkt.
Versucht man von diesem Einwand aus ein Urteil, so muß man sagen: in der
Bemühung um eine Zusammenfassung und um ein Gesamtbild, in der Bemühung,
die Einseitigkeit der rein formalen Betrachtung zu überwinden, sind die Form-
probleme etwas zu sehr zurückgedrängt worden. Man ersieht daraus, wie not-
wendig es für die Kunstgeschichte ist, den Begriff der Form in seiner Reinheit
festzuhalten. Die Orientierung an dem großen Vorbild der kulturgeschichtlich ein-
gestellten Biographie darf nicht zur Schmälerung der formalen Methode führen.
Aus beiden ein neues Ganzes zu gewinnen, bleibt ein Ziel der Zukunft.
Diese kritische Bemerkung über die Methode kann freilich das Urteil über den
Wert des Buches nicht mindern. Wir haben durch Waetzoldt endlich wieder einen
Dürer, der uns menschlich nahe kommt, ohne daß ihm ■— Wunschbildern zuliebe —
etwas von seiner Größe und Dämonie genommen wird. Was Waetzoldt schildert
und uns begreiflich zu machen sucht, ist das Wunder, „wie sich mit so viel Bieder-
keit so viel Verwegenheit verbindet, wie an die Scheiben der stillen Werkstatt am
Tiergärtnertor die Dämonen pochen und wie Albrecht Dürer aus der warmen Hand-
werksgemeinschaft in die kühle Einsamkeit des Genies herauswächst".
Göttingen. Herbert von Einem.
Jacob Burckhardt, Briefe zur Erkenntnis seiner geistigen
Gestalt. Mit einem Lebensabriß herausgegeben von Fritz Kaphahn. Leipzig.
Alfred Kroener Verlag. 1935.
Jacob Burckhardts Briefe gehören zu jenen menschlichen Zeugnissen, die beim
erneuten Lesen jedesmal wieder das Gefühl hervorrufen, man begegnet ihnen zum
ersten Male. Ihr Inhalt ist so überreich an allgemein menschlichen, geschicht-
lichen und künstlerischen Einsichten, ihre Form so kraftvoll und lebendig, daß der
Inhalt sich von den verschiedensten Gesichtspunkten neu nacherleben läßt. Es ist
dem deutschen Geistesbesitz also etwas Kostbares hinzugefügt worden, indem man
diese Sammlung von Briefen in die wohlfeilen und erprobten Kroener-Bände auf-
nahm. Dabei hat der Herausgeber sein Bestes getan. Die bekannten Briefeditionen
sind sämtliche benützt, und wir bedauern es nur, zusammen mit dem Herausgeber,
daß der Briefnachlaß im Burckhardt-Archiv (Basel) nicht herangezogen werden
konnte. Auch so wird der Leser und selbst der mit B. Vertrautere Briefe finden,
die infolge einer Veröffentlichung an entlegener Stelle ihm Neues bringen. Dazu
rechne ich vor allem Briefe an den Sohn seines Lehrers Franz Kugler, Bernhard
Kugler, diejenigen an Salomon Vögelin, Franz Grüninger, Otto Mündler und Karl
Fresenius. Mit besonderer Freude sieht der Berichterstatter die wenig bekannten