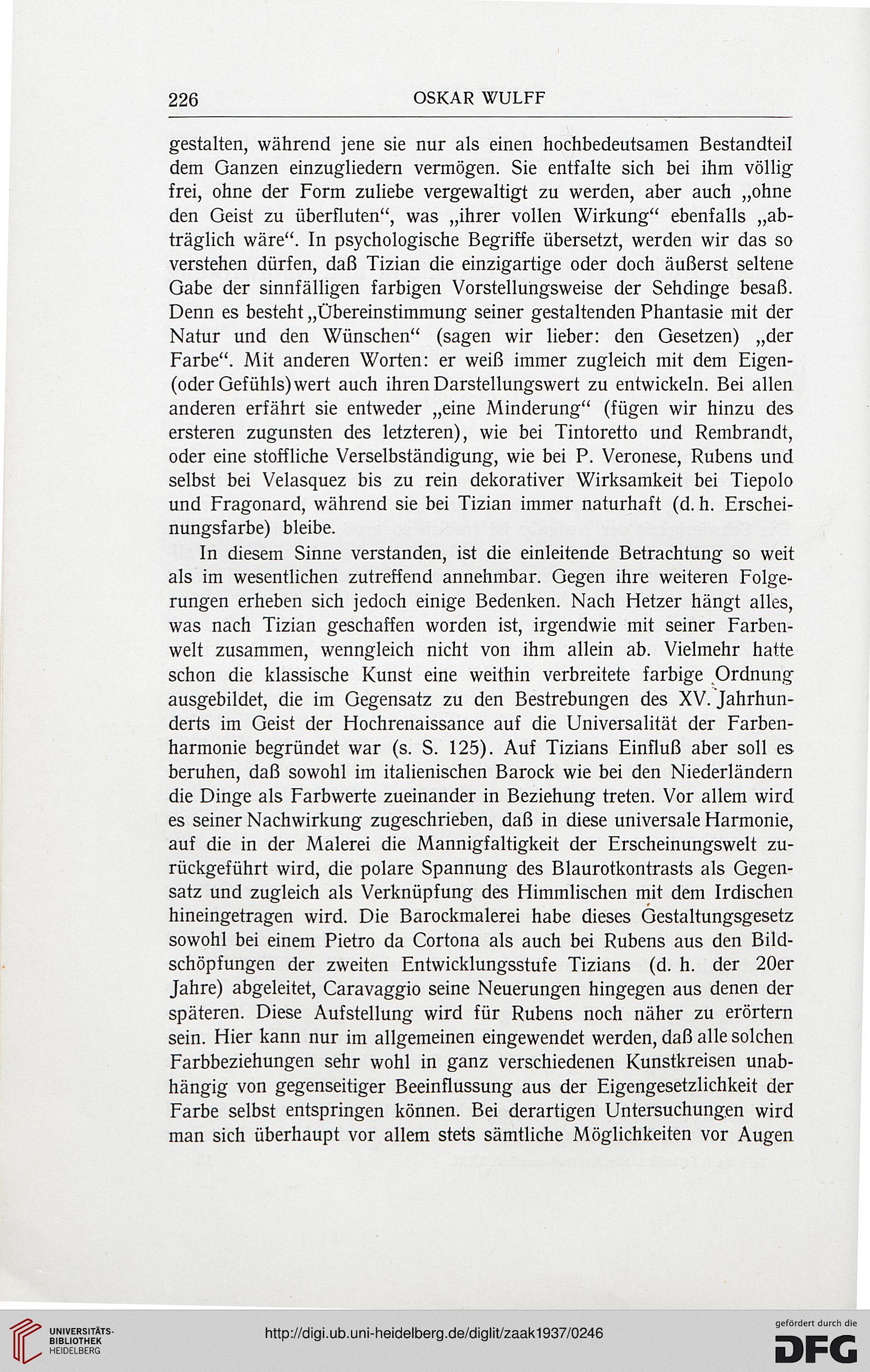226
OSKAR WULFF
gestalten, während jene sie nur als einen hochbedeutsamen Bestandteil
dem Ganzen einzugliedern vermögen. Sie entfalte sich bei ihm völlig
frei, ohne der Form zuliebe vergewaltigt zu werden, aber auch „ohne
den Geist zu überfluten", was „ihrer vollen Wirkung" ebenfalls „ab-
träglich wäre". In psychologische Begriffe übersetzt, werden wir das so
verstehen dürfen, daß Tizian die einzigartige oder doch äußerst seltene
Gabe der sinnfälligen farbigen Vorstellungsweise der Sehdinge besaß.
Denn es besteht „Übereinstimmung seiner gestaltenden Phantasie mit der
Natur und den Wünschen" (sagen wir lieber: den Gesetzen) „der
Farbe". Mit anderen Worten: er weiß immer zugleich mit dem Eigen-
(oder Gefühls) wert auch ihren Darstellungswert zu entwickeln. Bei allen
anderen erfährt sie entweder „eine Minderung" (fügen wir hinzu des
ersteren zugunsten des letzteren), wie bei Tintoretto und Rembrandt,
oder eine stoffliche Verselbständigung, wie bei P. Veronese, Rubens und
selbst bei Velasquez bis zu rein dekorativer Wirksamkeit bei Tiepolo
und Fragonard, während sie bei Tizian immer naturhaft (d. h. Erschei-
nungsfarbe) bleibe.
In diesem Sinne verstanden, ist die einleitende Betrachtung so weit
als im wesentlichen zutreffend annehmbar. Gegen ihre weiteren Folge-
rungen erheben sich jedoch einige Bedenken. Nach Hetzer hängt alles,
was nach Tizian geschaffen worden ist, irgendwie mit seiner Farben-
welt zusammen, wenngleich nicht von ihm allein ab. Vielmehr hatte
schon die klassische Kunst eine weithin verbreitete farbige Ordnung
ausgebildet, die im Gegensatz zu den Bestrebungen des XV. Jahrhun-
derts im Geist der Hochrenaissance auf die Universalität der Farben-
harmonie begründet war (s. S. 125). Auf Tizians Einfluß aber soll es
beruhen, daß sowohl im italienischen Barock wie bei den Niederländern
die Dinge als Farbwerte zueinander in Beziehung treten. Vor allem wird
es seiner Nachwirkung zugeschrieben, daß in diese universale Harmonie,
auf die in der Malerei die Mannigfaltigkeit der Erscheinungswelt zu-
rückgeführt wird, die polare Spannung des Blaurotkontrasts als Gegen-
satz und zugleich als Verknüpfung des Himmlischen mit dem Irdischen
hineingetragen wird. Die Barockmalerei habe dieses Gestaltungsgesetz
sowohl bei einem Pietro da Cortona als auch bei Rubens aus den Bild-
schöpfungen der zweiten Entwicklungsstufe Tizians (d. h. der 20er
Jahre) abgeleitet, Caravaggio seine Neuerungen hingegen aus denen der
späteren. Diese Aufstellung wird für Rubens noch näher zu erörtern
sein. Hier kann nur im allgemeinen eingewendet werden, daß alle solchen
Farbbeziehungen sehr wohl in ganz verschiedenen Kunstkreisen unab-
hängig von gegenseitiger Beeinflussung aus der Eigengesetzlichkeit der
Farbe selbst entspringen können. Bei derartigen Untersuchungen wird
man sich überhaupt vor allem stets sämtliche Möglichkeiten vor Augen
OSKAR WULFF
gestalten, während jene sie nur als einen hochbedeutsamen Bestandteil
dem Ganzen einzugliedern vermögen. Sie entfalte sich bei ihm völlig
frei, ohne der Form zuliebe vergewaltigt zu werden, aber auch „ohne
den Geist zu überfluten", was „ihrer vollen Wirkung" ebenfalls „ab-
träglich wäre". In psychologische Begriffe übersetzt, werden wir das so
verstehen dürfen, daß Tizian die einzigartige oder doch äußerst seltene
Gabe der sinnfälligen farbigen Vorstellungsweise der Sehdinge besaß.
Denn es besteht „Übereinstimmung seiner gestaltenden Phantasie mit der
Natur und den Wünschen" (sagen wir lieber: den Gesetzen) „der
Farbe". Mit anderen Worten: er weiß immer zugleich mit dem Eigen-
(oder Gefühls) wert auch ihren Darstellungswert zu entwickeln. Bei allen
anderen erfährt sie entweder „eine Minderung" (fügen wir hinzu des
ersteren zugunsten des letzteren), wie bei Tintoretto und Rembrandt,
oder eine stoffliche Verselbständigung, wie bei P. Veronese, Rubens und
selbst bei Velasquez bis zu rein dekorativer Wirksamkeit bei Tiepolo
und Fragonard, während sie bei Tizian immer naturhaft (d. h. Erschei-
nungsfarbe) bleibe.
In diesem Sinne verstanden, ist die einleitende Betrachtung so weit
als im wesentlichen zutreffend annehmbar. Gegen ihre weiteren Folge-
rungen erheben sich jedoch einige Bedenken. Nach Hetzer hängt alles,
was nach Tizian geschaffen worden ist, irgendwie mit seiner Farben-
welt zusammen, wenngleich nicht von ihm allein ab. Vielmehr hatte
schon die klassische Kunst eine weithin verbreitete farbige Ordnung
ausgebildet, die im Gegensatz zu den Bestrebungen des XV. Jahrhun-
derts im Geist der Hochrenaissance auf die Universalität der Farben-
harmonie begründet war (s. S. 125). Auf Tizians Einfluß aber soll es
beruhen, daß sowohl im italienischen Barock wie bei den Niederländern
die Dinge als Farbwerte zueinander in Beziehung treten. Vor allem wird
es seiner Nachwirkung zugeschrieben, daß in diese universale Harmonie,
auf die in der Malerei die Mannigfaltigkeit der Erscheinungswelt zu-
rückgeführt wird, die polare Spannung des Blaurotkontrasts als Gegen-
satz und zugleich als Verknüpfung des Himmlischen mit dem Irdischen
hineingetragen wird. Die Barockmalerei habe dieses Gestaltungsgesetz
sowohl bei einem Pietro da Cortona als auch bei Rubens aus den Bild-
schöpfungen der zweiten Entwicklungsstufe Tizians (d. h. der 20er
Jahre) abgeleitet, Caravaggio seine Neuerungen hingegen aus denen der
späteren. Diese Aufstellung wird für Rubens noch näher zu erörtern
sein. Hier kann nur im allgemeinen eingewendet werden, daß alle solchen
Farbbeziehungen sehr wohl in ganz verschiedenen Kunstkreisen unab-
hängig von gegenseitiger Beeinflussung aus der Eigengesetzlichkeit der
Farbe selbst entspringen können. Bei derartigen Untersuchungen wird
man sich überhaupt vor allem stets sämtliche Möglichkeiten vor Augen