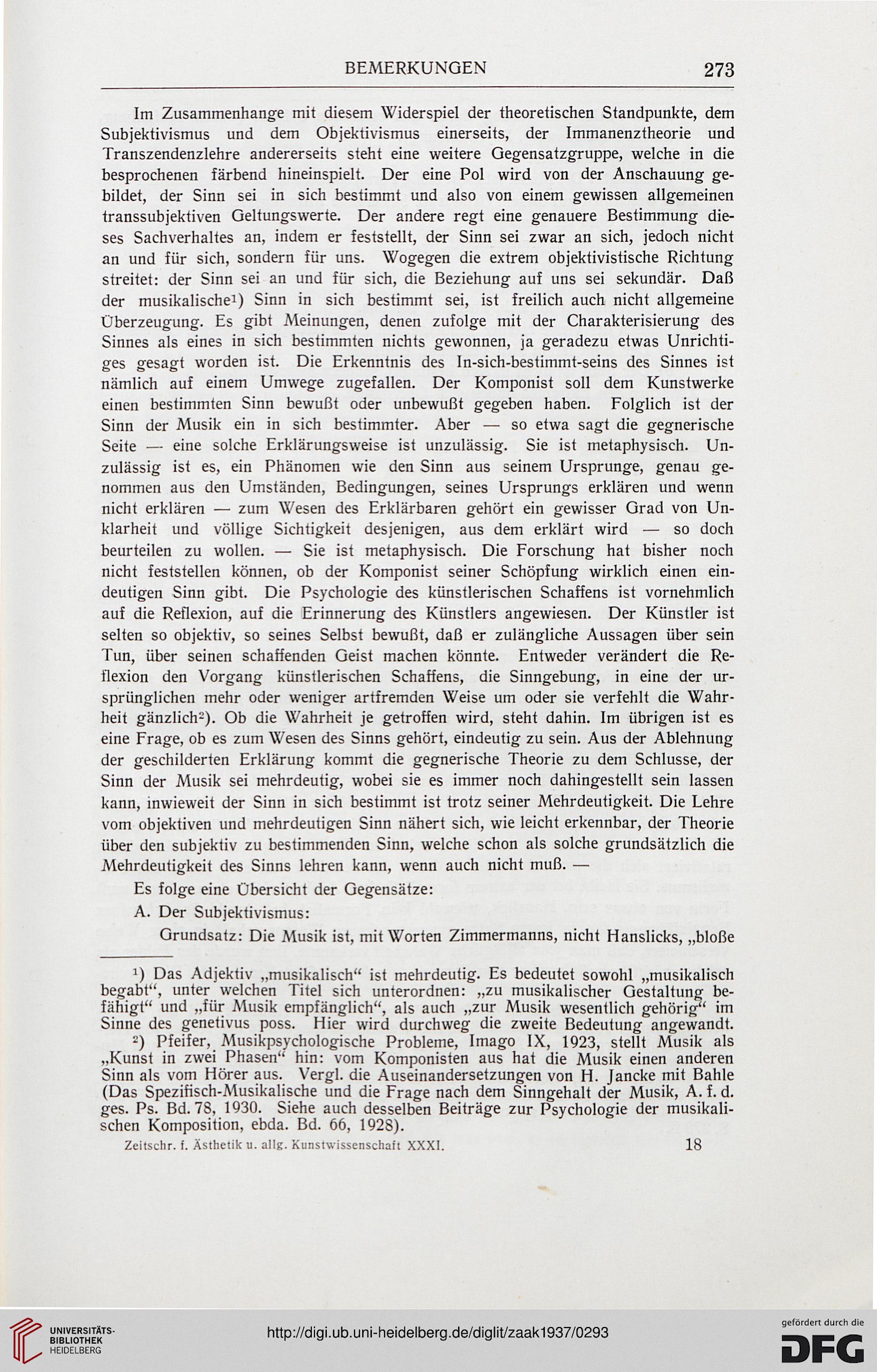BEMERKUNGEN
273
Im Zusammenhange mit diesem Widerspiel der theoretischen Standpunkte, dem
Subjektivismus und dem Objektivismus einerseits, der Immanenztheorie und
Transzendenzlehre andererseits steht eine weitere Gegensatzgruppe, welche in die
besprochenen färbend hineinspielt. Der eine Pol wird von der Anschauung ge-
bildet, der Sinn sei in sich bestimmt und also von einem gewissen allgemeinen
transsubjektiven Geltungswerte. Der andere regt eine genauere Bestimmung die-
ses Sachverhaltes an, indem er feststellt, der Sinn sei zwar an sich, jedoch nicht
an und für sich, sondern für uns. Wogegen die extrem objektivistische Richtung
streitet: der Sinn sei an und für sich, die Beziehung auf uns sei sekundär. Daß
der musikalische1) Sinn in sich bestimmt sei, ist freilich auch nicht allgemeine
Überzeugung. Es gibt Meinungen, denen zufolge mit der Charakterisierung des
Sinnes als eines in sich bestimmten nichts gewonnen, ja geradezu etwas Unrichti-
ges gesagt worden ist. Die Erkenntnis des In-sich-bestimmt-seins des Sinnes ist
nämlich auf einem Umwege zugefallen. Der Komponist soll dem Kunstwerke
einen bestimmten Sinn bewußt oder unbewußt gegeben haben. Folglich ist der
Sinn der Musik ein in sich bestimmter. Aber — so etwa sagt die gegnerische
Seite — eine solche Erklärungsweise ist unzulässig. Sie ist metaphysisch. Un-
zulässig ist es, ein Phänomen wie den Sinn aus seinem Ursprünge, genau ge-
nommen aus den Umständen, Bedingungen, seines Ursprungs erklären und wenn
nicht erklären — zum Wesen des Erklärbaren gehört ein gewisser Grad von Un-
klarheit und völlige Sichtigkeit desjenigen, aus dem erklärt wird — so doch
beurteilen zu wollen. — Sie ist metaphysisch. Die Forschung hat bisher noch
nicht feststellen können, ob der Komponist seiner Schöpfung wirklich einen ein-
deutigen Sinn gibt. Die Psychologie des künstlerischen Schaffens ist vornehmlich
auf die Reflexion, auf die Erinnerung des Künstlers angewiesen. Der Künstler ist
selten so objektiv, so seines Selbst bewußt, daß er zulängliche Aussagen über sein
Tun, über seinen schaffenden Geist machen könnte. Entweder verändert die Re-
flexion den Vorgang künstlerischen Schaffens, die Sinngebung, in eine der ur-
sprünglichen mehr oder weniger artfremden Weise um oder sie verfehlt die Wahr-
heit gänzlich-). Ob die Wahrheit je getroffen wird, steht dahin. Im übrigen ist es
eine Frage, ob es zum Wesen des Sinns gehört, eindeutig zu sein. Aus der Ablehnung
der geschilderten Erklärung kommt die gegnerische Theorie zu dem Schlüsse, der
Sinn der Musik sei mehrdeutig, wobei sie es immer noch dahingestellt sein lassen
kann, inwieweit der Sinn in sich bestimmt ist trotz seiner Mehrdeutigkeit. Die Lehre
vom objektiven und mehrdeutigen Sinn nähert sich, wie leicht erkennbar, der Theorie
über den subjektiv zu bestimmenden Sinn, welche schon als solche grundsätzlich die
Mehrdeutigkeit des Sinns lehren kann, wenn auch nicht muß. —
Es folge eine Übersicht der Gegensätze:
A. Der Subjektivismus:
Grundsatz: Die Musik ist, mit Worten Zimmermanns, nicht Hanslicks, „bloße
*) Das Adjektiv „musikalisch" ist mehrdeutig. Es bedeutet sowohl „musikalisch
begabt", unter welchen Titel sich unterordnen: „zu musikalischer Gestaltung be-
fähigt" und „für Musik empfänglich", als auch „zur Musik wesentlich gehörig" im
Sinne des genetivus poss. Hier wird durchweg die zweite Bedeutung angewandt.
-') Pfeifer, Musikpsychologische Probleme, Imago IX, 1923, stellt Musik als
„Kunst in zwei Phasen" hin: vom Komponisten aus hat die Musik einen anderen
Sinn als vom Hörer aus. Vergl. die Auseinandersetzungen von H. Jancke mit Bahle
(Das Spezifisch-Musikalische und die Frage nach dem Sinngehalt der Musik, A. f. d.
ges. Ps. Bd. 78, 1930. Siehe auch desselben Beiträge zur Psychologie der musikali-
schen Komposition, ebda. Bd. 66, 1928).
Zeitschr. f. Ästhetik u. alle- Kunstwissenschaft XXXI. 18
273
Im Zusammenhange mit diesem Widerspiel der theoretischen Standpunkte, dem
Subjektivismus und dem Objektivismus einerseits, der Immanenztheorie und
Transzendenzlehre andererseits steht eine weitere Gegensatzgruppe, welche in die
besprochenen färbend hineinspielt. Der eine Pol wird von der Anschauung ge-
bildet, der Sinn sei in sich bestimmt und also von einem gewissen allgemeinen
transsubjektiven Geltungswerte. Der andere regt eine genauere Bestimmung die-
ses Sachverhaltes an, indem er feststellt, der Sinn sei zwar an sich, jedoch nicht
an und für sich, sondern für uns. Wogegen die extrem objektivistische Richtung
streitet: der Sinn sei an und für sich, die Beziehung auf uns sei sekundär. Daß
der musikalische1) Sinn in sich bestimmt sei, ist freilich auch nicht allgemeine
Überzeugung. Es gibt Meinungen, denen zufolge mit der Charakterisierung des
Sinnes als eines in sich bestimmten nichts gewonnen, ja geradezu etwas Unrichti-
ges gesagt worden ist. Die Erkenntnis des In-sich-bestimmt-seins des Sinnes ist
nämlich auf einem Umwege zugefallen. Der Komponist soll dem Kunstwerke
einen bestimmten Sinn bewußt oder unbewußt gegeben haben. Folglich ist der
Sinn der Musik ein in sich bestimmter. Aber — so etwa sagt die gegnerische
Seite — eine solche Erklärungsweise ist unzulässig. Sie ist metaphysisch. Un-
zulässig ist es, ein Phänomen wie den Sinn aus seinem Ursprünge, genau ge-
nommen aus den Umständen, Bedingungen, seines Ursprungs erklären und wenn
nicht erklären — zum Wesen des Erklärbaren gehört ein gewisser Grad von Un-
klarheit und völlige Sichtigkeit desjenigen, aus dem erklärt wird — so doch
beurteilen zu wollen. — Sie ist metaphysisch. Die Forschung hat bisher noch
nicht feststellen können, ob der Komponist seiner Schöpfung wirklich einen ein-
deutigen Sinn gibt. Die Psychologie des künstlerischen Schaffens ist vornehmlich
auf die Reflexion, auf die Erinnerung des Künstlers angewiesen. Der Künstler ist
selten so objektiv, so seines Selbst bewußt, daß er zulängliche Aussagen über sein
Tun, über seinen schaffenden Geist machen könnte. Entweder verändert die Re-
flexion den Vorgang künstlerischen Schaffens, die Sinngebung, in eine der ur-
sprünglichen mehr oder weniger artfremden Weise um oder sie verfehlt die Wahr-
heit gänzlich-). Ob die Wahrheit je getroffen wird, steht dahin. Im übrigen ist es
eine Frage, ob es zum Wesen des Sinns gehört, eindeutig zu sein. Aus der Ablehnung
der geschilderten Erklärung kommt die gegnerische Theorie zu dem Schlüsse, der
Sinn der Musik sei mehrdeutig, wobei sie es immer noch dahingestellt sein lassen
kann, inwieweit der Sinn in sich bestimmt ist trotz seiner Mehrdeutigkeit. Die Lehre
vom objektiven und mehrdeutigen Sinn nähert sich, wie leicht erkennbar, der Theorie
über den subjektiv zu bestimmenden Sinn, welche schon als solche grundsätzlich die
Mehrdeutigkeit des Sinns lehren kann, wenn auch nicht muß. —
Es folge eine Übersicht der Gegensätze:
A. Der Subjektivismus:
Grundsatz: Die Musik ist, mit Worten Zimmermanns, nicht Hanslicks, „bloße
*) Das Adjektiv „musikalisch" ist mehrdeutig. Es bedeutet sowohl „musikalisch
begabt", unter welchen Titel sich unterordnen: „zu musikalischer Gestaltung be-
fähigt" und „für Musik empfänglich", als auch „zur Musik wesentlich gehörig" im
Sinne des genetivus poss. Hier wird durchweg die zweite Bedeutung angewandt.
-') Pfeifer, Musikpsychologische Probleme, Imago IX, 1923, stellt Musik als
„Kunst in zwei Phasen" hin: vom Komponisten aus hat die Musik einen anderen
Sinn als vom Hörer aus. Vergl. die Auseinandersetzungen von H. Jancke mit Bahle
(Das Spezifisch-Musikalische und die Frage nach dem Sinngehalt der Musik, A. f. d.
ges. Ps. Bd. 78, 1930. Siehe auch desselben Beiträge zur Psychologie der musikali-
schen Komposition, ebda. Bd. 66, 1928).
Zeitschr. f. Ästhetik u. alle- Kunstwissenschaft XXXI. 18