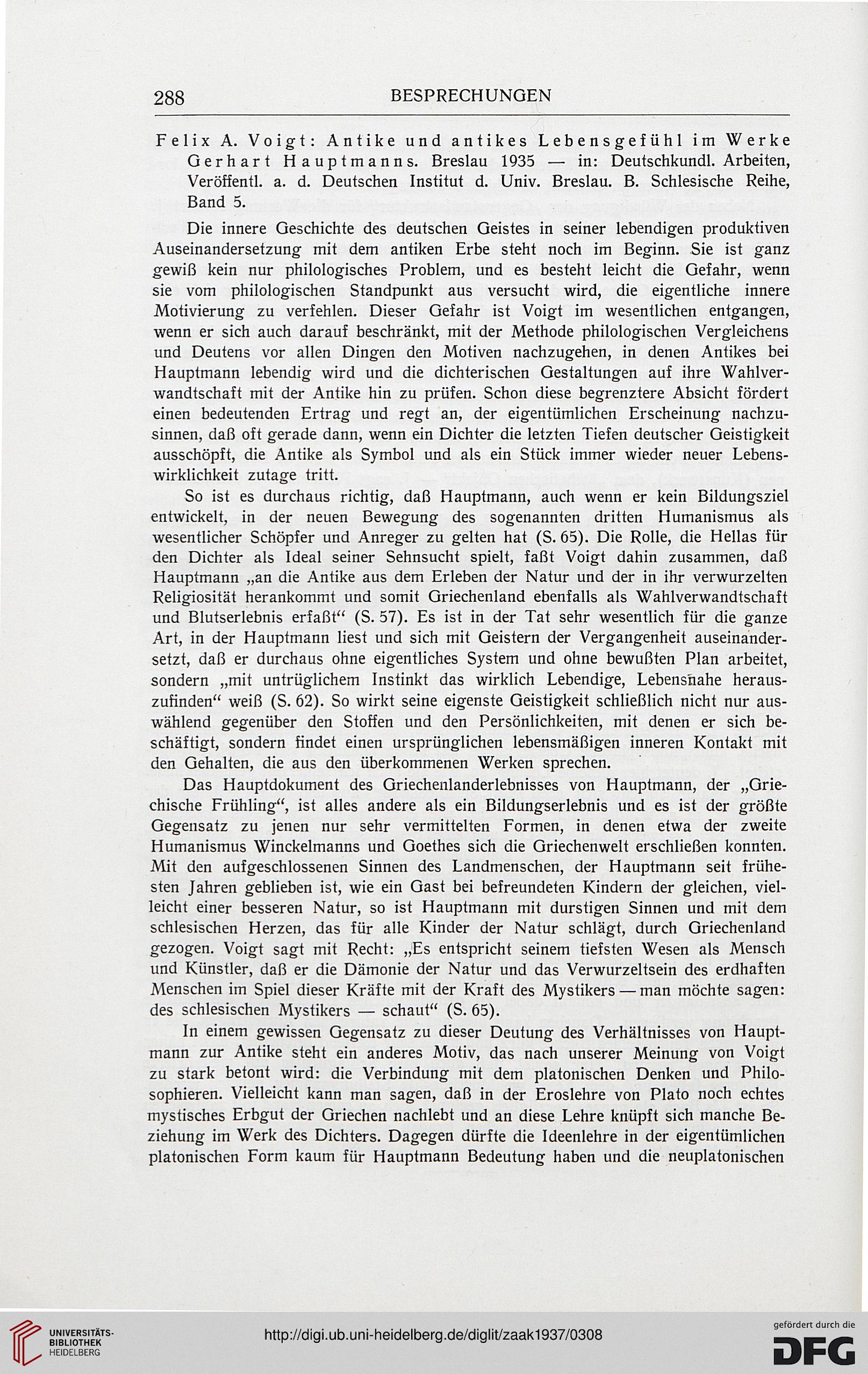288
BESPRECHUNGEN
Felix A. Voigt: Antike und antikes Lebensgefühl im Werke
Gerhart Hauptmanns. Breslau 1935 —■ in: Deutschkundl. Arbeiten,
Veröffentl. a. d. Deutschen Institut d. Univ. Breslau. B. Schlesische Reihe,
Band 5.
Die innere Geschichte des deutschen Geistes in seiner lebendigen produktiven
Auseinandersetzung mit dem antiken Erbe steht noch im Beginn. Sie ist ganz
gewiß kein nur philologisches Problem, und es besteht leicht die Gefahr, wenn
sie vom philologischen Standpunkt aus versucht wird, die eigentliche innere
Motivierung zu verfehlen. Dieser Gefahr ist Voigt im wesentlichen entgangen,
wenn er sich auch darauf beschränkt, mit der Methode philologischen Vergleichens
und Deutens vor allen Dingen den Motiven nachzugehen, in denen Antikes bei
Hauptmann lebendig wird und die dichterischen Gestaltungen auf ihre Wahlver-
wandtschaft mit der Antike hin zu prüfen. Schon diese begrenztere Absicht fördert
einen bedeutenden Ertrag und regt an, der eigentümlichen Erscheinung nachzu-
sinnen, daß oft gerade dann, wenn ein Dichter die letzten Tiefen deutscher Geistigkeit
ausschöpft, die Antike als Symbol und als ein Stück immer wieder neuer Lebens-
wirklichkeit zutage tritt.
So ist es durchaus richtig, daß Hauptmann, auch wenn er kein Bildungsziel
entwickelt, in der neuen Bewegung des sogenannten dritten Humanismus als
wesentlicher Schöpfer und Anreger zu gelten hat (S. 65). Die Rolle, die Hellas für
den Dichter als Ideal seiner Sehnsucht spielt, faßt Voigt dahin zusammen, daß
Hauptmann „an die Antike aus dem Erleben der Natur und der in ihr verwurzelten
Religiosität herankommt und somit Griechenland ebenfalls als Wahlverwandtschaft
und Blutserlebnis erfaßt" (S. 57). Es ist in der Tat sehr wesentlich für die ganze
Art, in der Hauptmann liest und sich mit Geistern der Vergangenheit auseinander-
setzt, daß er durchaus ohne eigentliches System und ohne bewußten Plan arbeitet,
sondern „mit untrüglichem Instinkt das wirklich Lebendige, Lebensnahe heraus-
zufinden" weiß (S. 62). So wirkt seine eigenste Geistigkeit schließlich nicht nur aus-
wählend gegenüber den Stoffen und den Persönlichkeiten, mit denen er sich be-
schäftigt, sondern findet einen ursprünglichen lebensmäßigen inneren Kontakt mit
den Gehalten, die aus den überkommenen Werken sprechen.
Das Hauptdokument des Griechenlanderlebnisses von Hauptmann, der „Grie-
chische Frühling", ist alles andere als ein Bildungserlebnis und es ist der größte
Gegensatz zu jenen nur sehr vermittelten Formen, in denen etwa der zweite
Humanismus Winckelmanns und Goethes sich die Griechenwelt erschließen konnten.
Mit den aufgeschlossenen Sinnen des Landmenschen, der Hauptmann seit frühe-
sten Jahren geblieben ist, wie ein Gast bei befreundeten Kindern der gleichen, viel-
leicht einer besseren Natur, so ist Hauptmann mit durstigen Sinnen und mit dem
schlesischen Herzen, das für alle Kinder der Natur schlägt, durch Griechenland
gezogen. Voigt sagt mit Recht: „Es entspricht seinem tiefsten Wesen als Mensch
und Künstler, daß er die Dämonie der Natur und das Verwurzeltsein des erdhaften
Menschen im Spiel dieser Kräfte mit der Kraft des Mystikers — man möchte sagen:
des schlesischen Mystikers — schaut" (S. 65).
In einem gewissen Gegensatz zu dieser Deutung des Verhältnisses von Haupt-
mann zur Antike steht ein anderes Motiv, das nach unserer Meinung von Voigt
zu stark betont wird: die Verbindung mit dem platonischen Denken und Philo-
sophieren. Vielleicht kann man sagen, daß in der Eroslehre von Plato noch echtes
mystisches Erbgut der Griechen nachlebt und an diese Lehre knüpft sich manche Be-
ziehung im Werk des Dichters. Dagegen dürfte die Ideenlehre in der eigentümlichen
platonischen Form kaum für Hauptmann Bedeutung haben und die neuplatonischen
BESPRECHUNGEN
Felix A. Voigt: Antike und antikes Lebensgefühl im Werke
Gerhart Hauptmanns. Breslau 1935 —■ in: Deutschkundl. Arbeiten,
Veröffentl. a. d. Deutschen Institut d. Univ. Breslau. B. Schlesische Reihe,
Band 5.
Die innere Geschichte des deutschen Geistes in seiner lebendigen produktiven
Auseinandersetzung mit dem antiken Erbe steht noch im Beginn. Sie ist ganz
gewiß kein nur philologisches Problem, und es besteht leicht die Gefahr, wenn
sie vom philologischen Standpunkt aus versucht wird, die eigentliche innere
Motivierung zu verfehlen. Dieser Gefahr ist Voigt im wesentlichen entgangen,
wenn er sich auch darauf beschränkt, mit der Methode philologischen Vergleichens
und Deutens vor allen Dingen den Motiven nachzugehen, in denen Antikes bei
Hauptmann lebendig wird und die dichterischen Gestaltungen auf ihre Wahlver-
wandtschaft mit der Antike hin zu prüfen. Schon diese begrenztere Absicht fördert
einen bedeutenden Ertrag und regt an, der eigentümlichen Erscheinung nachzu-
sinnen, daß oft gerade dann, wenn ein Dichter die letzten Tiefen deutscher Geistigkeit
ausschöpft, die Antike als Symbol und als ein Stück immer wieder neuer Lebens-
wirklichkeit zutage tritt.
So ist es durchaus richtig, daß Hauptmann, auch wenn er kein Bildungsziel
entwickelt, in der neuen Bewegung des sogenannten dritten Humanismus als
wesentlicher Schöpfer und Anreger zu gelten hat (S. 65). Die Rolle, die Hellas für
den Dichter als Ideal seiner Sehnsucht spielt, faßt Voigt dahin zusammen, daß
Hauptmann „an die Antike aus dem Erleben der Natur und der in ihr verwurzelten
Religiosität herankommt und somit Griechenland ebenfalls als Wahlverwandtschaft
und Blutserlebnis erfaßt" (S. 57). Es ist in der Tat sehr wesentlich für die ganze
Art, in der Hauptmann liest und sich mit Geistern der Vergangenheit auseinander-
setzt, daß er durchaus ohne eigentliches System und ohne bewußten Plan arbeitet,
sondern „mit untrüglichem Instinkt das wirklich Lebendige, Lebensnahe heraus-
zufinden" weiß (S. 62). So wirkt seine eigenste Geistigkeit schließlich nicht nur aus-
wählend gegenüber den Stoffen und den Persönlichkeiten, mit denen er sich be-
schäftigt, sondern findet einen ursprünglichen lebensmäßigen inneren Kontakt mit
den Gehalten, die aus den überkommenen Werken sprechen.
Das Hauptdokument des Griechenlanderlebnisses von Hauptmann, der „Grie-
chische Frühling", ist alles andere als ein Bildungserlebnis und es ist der größte
Gegensatz zu jenen nur sehr vermittelten Formen, in denen etwa der zweite
Humanismus Winckelmanns und Goethes sich die Griechenwelt erschließen konnten.
Mit den aufgeschlossenen Sinnen des Landmenschen, der Hauptmann seit frühe-
sten Jahren geblieben ist, wie ein Gast bei befreundeten Kindern der gleichen, viel-
leicht einer besseren Natur, so ist Hauptmann mit durstigen Sinnen und mit dem
schlesischen Herzen, das für alle Kinder der Natur schlägt, durch Griechenland
gezogen. Voigt sagt mit Recht: „Es entspricht seinem tiefsten Wesen als Mensch
und Künstler, daß er die Dämonie der Natur und das Verwurzeltsein des erdhaften
Menschen im Spiel dieser Kräfte mit der Kraft des Mystikers — man möchte sagen:
des schlesischen Mystikers — schaut" (S. 65).
In einem gewissen Gegensatz zu dieser Deutung des Verhältnisses von Haupt-
mann zur Antike steht ein anderes Motiv, das nach unserer Meinung von Voigt
zu stark betont wird: die Verbindung mit dem platonischen Denken und Philo-
sophieren. Vielleicht kann man sagen, daß in der Eroslehre von Plato noch echtes
mystisches Erbgut der Griechen nachlebt und an diese Lehre knüpft sich manche Be-
ziehung im Werk des Dichters. Dagegen dürfte die Ideenlehre in der eigentümlichen
platonischen Form kaum für Hauptmann Bedeutung haben und die neuplatonischen