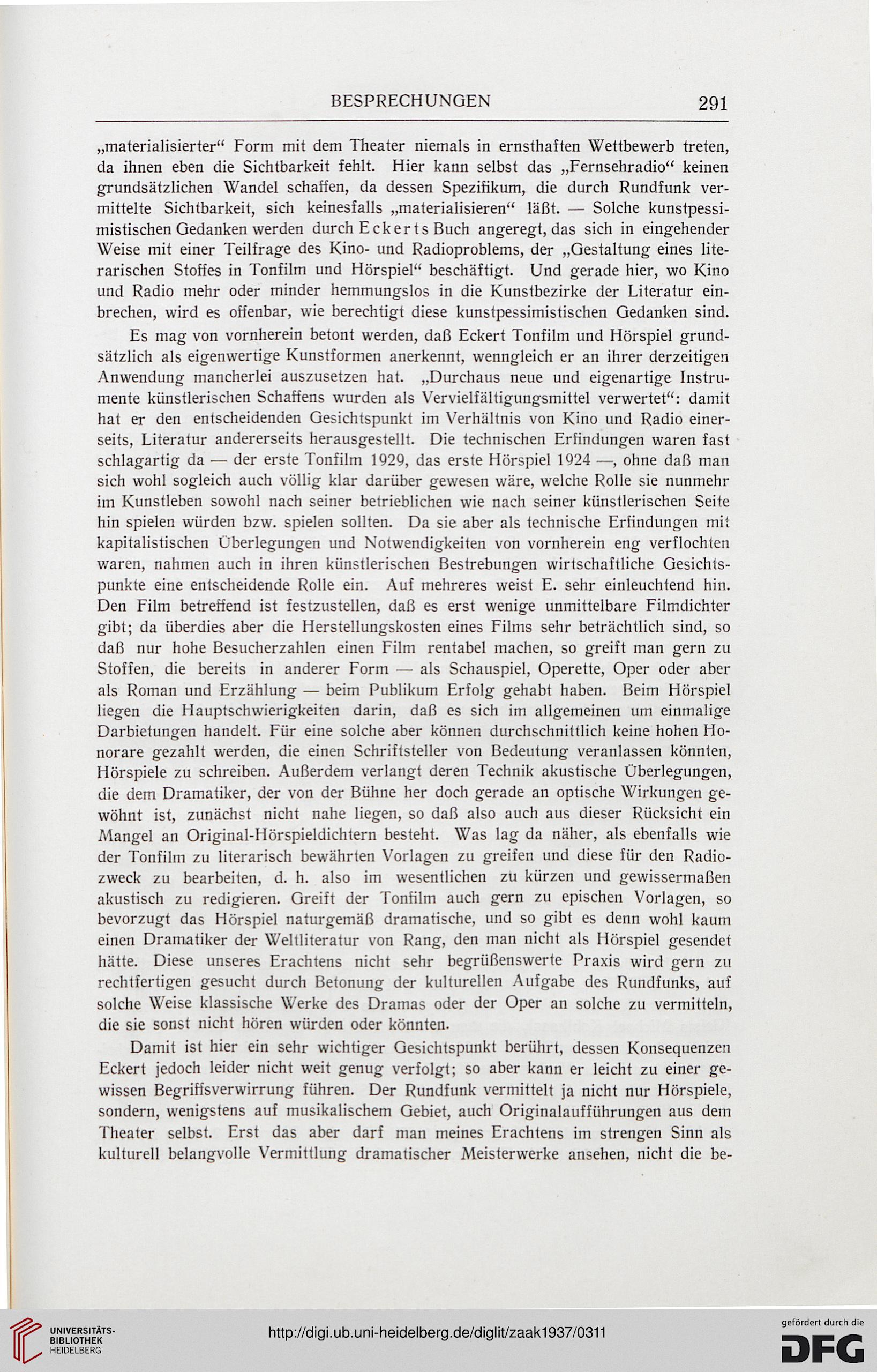BESPRECHUNGEN
291
„materialisierter" Form mit dem Theater niemals in ernsthaften Wettbewerb treten,
da ihnen eben die Sichtbarkeit fehlt. Hier kann selbst das „Fernsehradio" keinen
grundsätzlichen Wandel scharfen, da dessen Spezifikum, die durch Rundfunk ver-
mittelte Sichtbarkeit, sich keinesfalls „materialisieren" läßt. — Solche kunstpessi-
mistischen Gedanken werden durch Eckerts Buch angeregt, das sich in eingehender
Weise mit einer Teilfrage des Kino- und Radioproblems, der „Gestaltung eines lite-
rarischen Stoffes in Tonfilm und Hörspiel" beschäftigt. Und gerade hier, wo Kino
und Radio mehr oder minder hemmungslos in die Kunstbezirke der Literatur ein-
brechen, wird es offenbar, wie berechtigt diese kunstpessimistischen Gedanken sind.
Es mag von vornherein betont werden, daß Eckert Tonfilm und Hörspiel grund-
sätzlich als eigenwertige Kunstformen anerkennt, wenngleich er an ihrer derzeitigen
Anwendung mancherlei auszusetzen hat. „Durchaus neue und eigenartige Instru-
mente künstlerischen Schaffens wurden als Vervielfältigungsmittel verwertet": damit
hat er den entscheidenden Gesichtspunkt im Verhältnis von Kino und Radio einer-
seits, Literatur andererseits herausgestellt. Die technischen Erfindungen waren fast
schlagartig da — der erste Tonfilm 1929, das erste Hörspiel 1924 —, ohne daß man
sich wohl sogleich auch völlig klar darüber gewesen wäre, welche Rolle sie nunmehr
im Kunstleben sowohl nach seiner betrieblichen wie nach seiner künstlerischen Seite
hin spielen würden bzw. spielen sollten. Da sie aber als technische Erfindungen mit
kapitalistischen Überlegungen und Notwendigkeiten von vornherein eng verflochten
waren, nahmen auch in ihren künstlerischen Bestrebungen wirtschaftliche Gesichts-
punkte eine entscheidende Rolle ein. Auf mehreres weist E. sehr einleuchtend hin.
Den Film betreffend ist festzustellen, daß es erst wenige unmittelbare Filmdichter
gibt; da überdies aber die Herstellungskosten eines Films sehr beträchtlich sind, so
daß nur hohe Besucherzahlen einen Film rentabel machen, so greift man gern zu
Stoffen, die bereits in anderer Form — als Schauspiel, Operette, Oper oder aber
als Roman und Erzählung — beim Publikum Erfolg gehabt haben. Beim Hörspiel
liegen die Hauptschwierigkeiten darin, daß es sich im allgemeinen um einmalige
Darbietungen handelt. Für eine solche aber können durchschnittlich keine hohen Ho-
norare gezahlt werden, die einen Schriftsteller von Bedeutung veranlassen könnten,
Hörspiele zu schreiben. Außerdem verlangt deren Technik akustische Überlegungen,
die dem Dramatiker, der von der Bühne her doch gerade an optische Wirkungen ge-
wöhnt ist, zunächst nicht nahe liegen, so daß also auch aus dieser Rücksicht ein
Mangel an Original-Hörspieldichtern besteht. Was lag da näher, als ebenfalls wie
der Tonfilm zu literarisch bewährten Vorlagen zu greifen und diese für den Radio-
zweck zu bearbeiten, d. h. also im wesentlichen zu kürzen und gewissermaßen
akustisch zu redigieren. Greift der Tonfilm auch gern zu epischen Vorlagen, so
bevorzugt das Hörspiel naturgemäß dramatische, und so gibt es denn wohl kaum
einen Dramatiker der Weltliteratur von Rang, den man nicht als Hörspiel gesendet
hätte. Diese unseres Erachtens nicht sehr begrüßenswerte Praxis wird gern zu
rechtfertigen gesucht durch Betonung der kulturellen Aufgabe des Rundfunks, auf
solche Weise klassische Werke des Dramas oder der Oper an solche zu vermitteln,
die sie sonst nicht hören würden oder könnten.
Damit ist hier ein sehr wichtiger Gesichtspunkt berührt, dessen Konsequenzen
Eckert jedoch leider nicht weit genug verfolgt; so aber kann er leicht zu einer ge-
wissen Begriffsverwirrung führen. Der Rundfunk vermittelt ja nicht nur Hörspiele,
sondern, wenigstens auf musikalischem Gebiet, auch Originalaufführungen aus dem
Theater selbst. Erst das aber darf man meines Erachtens im strengen Sinn als
kulturell belangvolle Vermittlung dramatischer Meisterwerke ansehen, nicht die be-
291
„materialisierter" Form mit dem Theater niemals in ernsthaften Wettbewerb treten,
da ihnen eben die Sichtbarkeit fehlt. Hier kann selbst das „Fernsehradio" keinen
grundsätzlichen Wandel scharfen, da dessen Spezifikum, die durch Rundfunk ver-
mittelte Sichtbarkeit, sich keinesfalls „materialisieren" läßt. — Solche kunstpessi-
mistischen Gedanken werden durch Eckerts Buch angeregt, das sich in eingehender
Weise mit einer Teilfrage des Kino- und Radioproblems, der „Gestaltung eines lite-
rarischen Stoffes in Tonfilm und Hörspiel" beschäftigt. Und gerade hier, wo Kino
und Radio mehr oder minder hemmungslos in die Kunstbezirke der Literatur ein-
brechen, wird es offenbar, wie berechtigt diese kunstpessimistischen Gedanken sind.
Es mag von vornherein betont werden, daß Eckert Tonfilm und Hörspiel grund-
sätzlich als eigenwertige Kunstformen anerkennt, wenngleich er an ihrer derzeitigen
Anwendung mancherlei auszusetzen hat. „Durchaus neue und eigenartige Instru-
mente künstlerischen Schaffens wurden als Vervielfältigungsmittel verwertet": damit
hat er den entscheidenden Gesichtspunkt im Verhältnis von Kino und Radio einer-
seits, Literatur andererseits herausgestellt. Die technischen Erfindungen waren fast
schlagartig da — der erste Tonfilm 1929, das erste Hörspiel 1924 —, ohne daß man
sich wohl sogleich auch völlig klar darüber gewesen wäre, welche Rolle sie nunmehr
im Kunstleben sowohl nach seiner betrieblichen wie nach seiner künstlerischen Seite
hin spielen würden bzw. spielen sollten. Da sie aber als technische Erfindungen mit
kapitalistischen Überlegungen und Notwendigkeiten von vornherein eng verflochten
waren, nahmen auch in ihren künstlerischen Bestrebungen wirtschaftliche Gesichts-
punkte eine entscheidende Rolle ein. Auf mehreres weist E. sehr einleuchtend hin.
Den Film betreffend ist festzustellen, daß es erst wenige unmittelbare Filmdichter
gibt; da überdies aber die Herstellungskosten eines Films sehr beträchtlich sind, so
daß nur hohe Besucherzahlen einen Film rentabel machen, so greift man gern zu
Stoffen, die bereits in anderer Form — als Schauspiel, Operette, Oper oder aber
als Roman und Erzählung — beim Publikum Erfolg gehabt haben. Beim Hörspiel
liegen die Hauptschwierigkeiten darin, daß es sich im allgemeinen um einmalige
Darbietungen handelt. Für eine solche aber können durchschnittlich keine hohen Ho-
norare gezahlt werden, die einen Schriftsteller von Bedeutung veranlassen könnten,
Hörspiele zu schreiben. Außerdem verlangt deren Technik akustische Überlegungen,
die dem Dramatiker, der von der Bühne her doch gerade an optische Wirkungen ge-
wöhnt ist, zunächst nicht nahe liegen, so daß also auch aus dieser Rücksicht ein
Mangel an Original-Hörspieldichtern besteht. Was lag da näher, als ebenfalls wie
der Tonfilm zu literarisch bewährten Vorlagen zu greifen und diese für den Radio-
zweck zu bearbeiten, d. h. also im wesentlichen zu kürzen und gewissermaßen
akustisch zu redigieren. Greift der Tonfilm auch gern zu epischen Vorlagen, so
bevorzugt das Hörspiel naturgemäß dramatische, und so gibt es denn wohl kaum
einen Dramatiker der Weltliteratur von Rang, den man nicht als Hörspiel gesendet
hätte. Diese unseres Erachtens nicht sehr begrüßenswerte Praxis wird gern zu
rechtfertigen gesucht durch Betonung der kulturellen Aufgabe des Rundfunks, auf
solche Weise klassische Werke des Dramas oder der Oper an solche zu vermitteln,
die sie sonst nicht hören würden oder könnten.
Damit ist hier ein sehr wichtiger Gesichtspunkt berührt, dessen Konsequenzen
Eckert jedoch leider nicht weit genug verfolgt; so aber kann er leicht zu einer ge-
wissen Begriffsverwirrung führen. Der Rundfunk vermittelt ja nicht nur Hörspiele,
sondern, wenigstens auf musikalischem Gebiet, auch Originalaufführungen aus dem
Theater selbst. Erst das aber darf man meines Erachtens im strengen Sinn als
kulturell belangvolle Vermittlung dramatischer Meisterwerke ansehen, nicht die be-