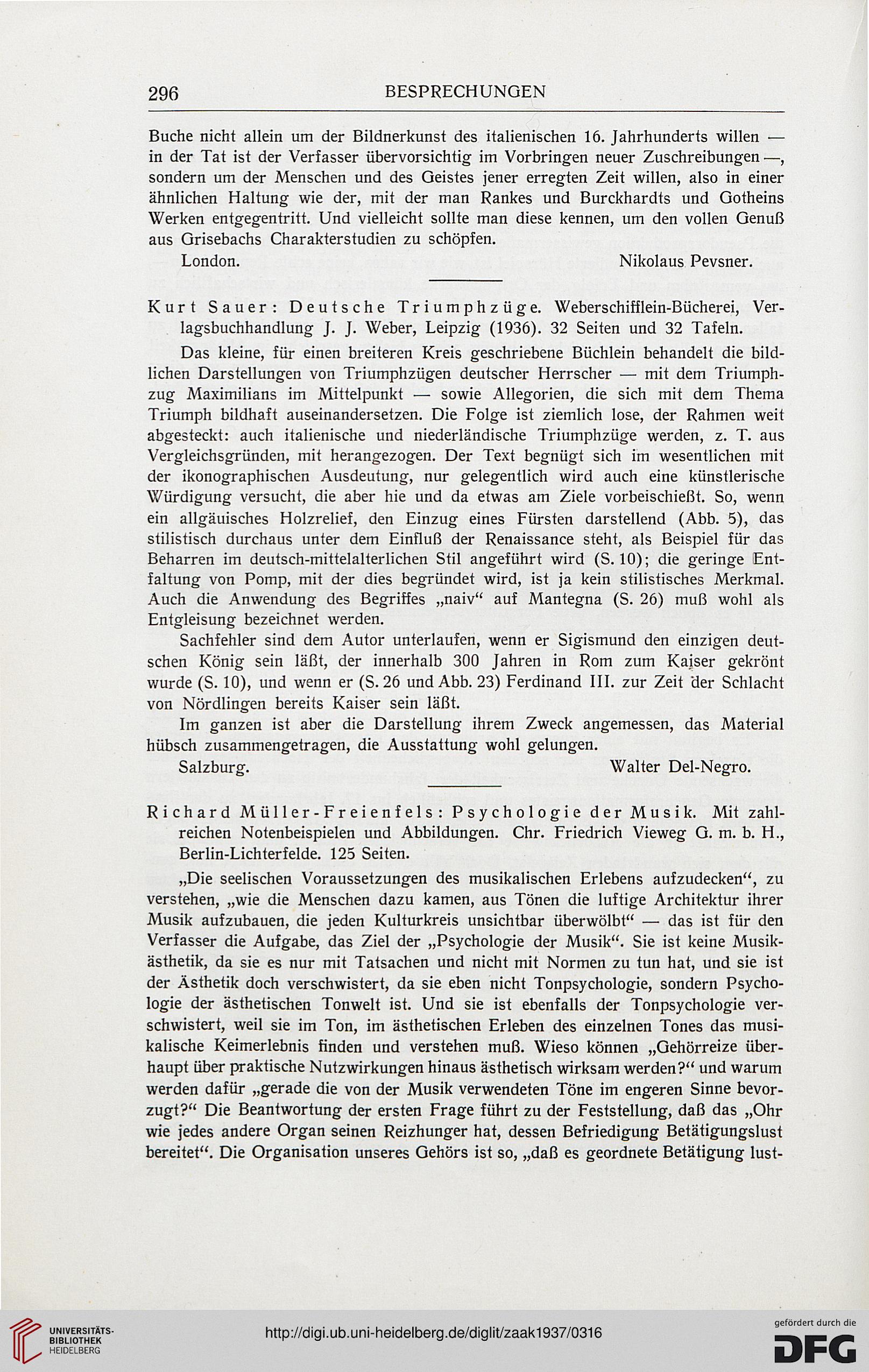296
BESPRECHUNGEN
Buche nicht allein um der Bildnerkunst des italienischen 16. Jahrhunderts willen —
in der Tat ist der Verfasser übervorsichtig im Vorbringen neuer Zuschreibungen •—,
sondern um der Menschen und des Geistes jener erregten Zeit willen, also in einer
ähnlichen Haltung wie der, mit der man Rankes und Burckhardts und Gotheins
Werken entgegentritt. Und vielleicht sollte man diese kennen, um den vollen Genuß
aus Grisebachs Charakterstudien zu schöpfen.
London. Nikolaus Pevsner.
Kurt Sauer: Deutsche Triumphzüge. Weberschifflein-Bücherei, Ver-
lagsbuchhandlung J. J. Weber, Leipzig (1936). 32 Seiten und 32 Tafeln.
Das kleine, für einen breiteren Kreis geschriebene Büchlein behandelt die bild-
lichen Darstellungen von Triumphzügen deutscher Herrscher — mit dem Triumph-
zug Maximilians im Mittelpunkt — sowie Allegorien, die sich mit dem Thema
Triumph bildhaft auseinandersetzen. Die Folge ist ziemlich lose, der Rahmen weit
abgesteckt: auch italienische und niederländische Triumphzüge werden, z. T. aus
Vergleichsgründen, mit herangezogen. Der Text begnügt sich im wesentlichen mit
der ikonographischen Ausdeutung, nur gelegentlich wird auch eine künstlerische
Würdigung versucht, die aber hie und da etwas am Ziele vorbeischießt. So, wenn
ein allgäuisches Holzrelief, den Einzug eines Fürsten darstellend (Abb. 5), das
stilistisch durchaus unter dem Einfluß der Renaissance steht, als Beispiel für das
Beharren im deutsch-mittelalterlichen Stil angeführt wird (S. 10); die geringe Ent-
faltung von Pomp, mit der dies begründet wird, ist ja kein stilistisches Merkmal.
Auch die Anwendung des Begriffes „naiv" auf Mantegna (S. 26) muß wohl als
Entgleisung bezeichnet werden.
Sachfehler sind dem Autor unterlaufen, wenn er Sigismund den einzigen deut-
schen König sein läßt, der innerhalb 300 Jahren in Rom zum Kaiser gekrönt
wurde (S. 10), und wenn er (S. 26 und Abb. 23) Ferdinand III. zur Zeit der Schlacht
von Nördlingen bereits Kaiser sein läßt.
Im ganzen ist aber die Darstellung ihrem Zweck angemessen, das Material
hübsch zusammengetragen, die Ausstattung wohl gelungen.
Salzburg. Walter Del-Negro.
Richard Müller-Freienfels: Psychologie der Musik. Mit zahl-
reichen Notenbeispielen und Abbildungen. Chr. Friedrich Vieweg G. m. b. H.,
Berlin-Lichterfelde. 125 Seiten.
„Die seelischen Voraussetzungen des musikalischen Erlebens aufzudecken", zu
verstehen, „wie die Menschen dazu kamen, aus Tönen die luftige Architektur ihrer
Musik aufzubauen, die jeden Kulturkreis unsichtbar überwölbt" — das ist für den
Verfasser die Aufgabe, das Ziel der „Psychologie der Musik". Sie ist keine Musik-
ästhetik, da sie es nur mit Tatsachen und nicht mit Normen zu tun hat, und sie ist
der Ästhetik doch verschwistert, da sie eben nicht Tonpsychologie, sondern Psycho-
logie der ästhetischen Tonwelt ist. Und sie ist ebenfalls der Tonpsychologie ver-
schwistert, weil sie im Ton, im ästhetischen Erleben des einzelnen Tones das musi-
kalische Keimerlebnis finden und verstehen muß. Wieso können „Gehörreize über-
haupt über praktische Nutzwirkungen hinaus ästhetisch wirksam werden?" und warum
werden dafür „gerade die von der Musik verwendeten Töne im engeren Sinne bevor-
zugt?" Die Beantwortung der ersten Frage führt zu der Feststellung, daß das „Ohr
wie jedes andere Organ seinen Reizhunger hat, dessen Befriedigung Betätigungslust
bereitet". Die Organisation unseres Gehörs ist so, „daß es geordnete Betätigung lust-
BESPRECHUNGEN
Buche nicht allein um der Bildnerkunst des italienischen 16. Jahrhunderts willen —
in der Tat ist der Verfasser übervorsichtig im Vorbringen neuer Zuschreibungen •—,
sondern um der Menschen und des Geistes jener erregten Zeit willen, also in einer
ähnlichen Haltung wie der, mit der man Rankes und Burckhardts und Gotheins
Werken entgegentritt. Und vielleicht sollte man diese kennen, um den vollen Genuß
aus Grisebachs Charakterstudien zu schöpfen.
London. Nikolaus Pevsner.
Kurt Sauer: Deutsche Triumphzüge. Weberschifflein-Bücherei, Ver-
lagsbuchhandlung J. J. Weber, Leipzig (1936). 32 Seiten und 32 Tafeln.
Das kleine, für einen breiteren Kreis geschriebene Büchlein behandelt die bild-
lichen Darstellungen von Triumphzügen deutscher Herrscher — mit dem Triumph-
zug Maximilians im Mittelpunkt — sowie Allegorien, die sich mit dem Thema
Triumph bildhaft auseinandersetzen. Die Folge ist ziemlich lose, der Rahmen weit
abgesteckt: auch italienische und niederländische Triumphzüge werden, z. T. aus
Vergleichsgründen, mit herangezogen. Der Text begnügt sich im wesentlichen mit
der ikonographischen Ausdeutung, nur gelegentlich wird auch eine künstlerische
Würdigung versucht, die aber hie und da etwas am Ziele vorbeischießt. So, wenn
ein allgäuisches Holzrelief, den Einzug eines Fürsten darstellend (Abb. 5), das
stilistisch durchaus unter dem Einfluß der Renaissance steht, als Beispiel für das
Beharren im deutsch-mittelalterlichen Stil angeführt wird (S. 10); die geringe Ent-
faltung von Pomp, mit der dies begründet wird, ist ja kein stilistisches Merkmal.
Auch die Anwendung des Begriffes „naiv" auf Mantegna (S. 26) muß wohl als
Entgleisung bezeichnet werden.
Sachfehler sind dem Autor unterlaufen, wenn er Sigismund den einzigen deut-
schen König sein läßt, der innerhalb 300 Jahren in Rom zum Kaiser gekrönt
wurde (S. 10), und wenn er (S. 26 und Abb. 23) Ferdinand III. zur Zeit der Schlacht
von Nördlingen bereits Kaiser sein läßt.
Im ganzen ist aber die Darstellung ihrem Zweck angemessen, das Material
hübsch zusammengetragen, die Ausstattung wohl gelungen.
Salzburg. Walter Del-Negro.
Richard Müller-Freienfels: Psychologie der Musik. Mit zahl-
reichen Notenbeispielen und Abbildungen. Chr. Friedrich Vieweg G. m. b. H.,
Berlin-Lichterfelde. 125 Seiten.
„Die seelischen Voraussetzungen des musikalischen Erlebens aufzudecken", zu
verstehen, „wie die Menschen dazu kamen, aus Tönen die luftige Architektur ihrer
Musik aufzubauen, die jeden Kulturkreis unsichtbar überwölbt" — das ist für den
Verfasser die Aufgabe, das Ziel der „Psychologie der Musik". Sie ist keine Musik-
ästhetik, da sie es nur mit Tatsachen und nicht mit Normen zu tun hat, und sie ist
der Ästhetik doch verschwistert, da sie eben nicht Tonpsychologie, sondern Psycho-
logie der ästhetischen Tonwelt ist. Und sie ist ebenfalls der Tonpsychologie ver-
schwistert, weil sie im Ton, im ästhetischen Erleben des einzelnen Tones das musi-
kalische Keimerlebnis finden und verstehen muß. Wieso können „Gehörreize über-
haupt über praktische Nutzwirkungen hinaus ästhetisch wirksam werden?" und warum
werden dafür „gerade die von der Musik verwendeten Töne im engeren Sinne bevor-
zugt?" Die Beantwortung der ersten Frage führt zu der Feststellung, daß das „Ohr
wie jedes andere Organ seinen Reizhunger hat, dessen Befriedigung Betätigungslust
bereitet". Die Organisation unseres Gehörs ist so, „daß es geordnete Betätigung lust-