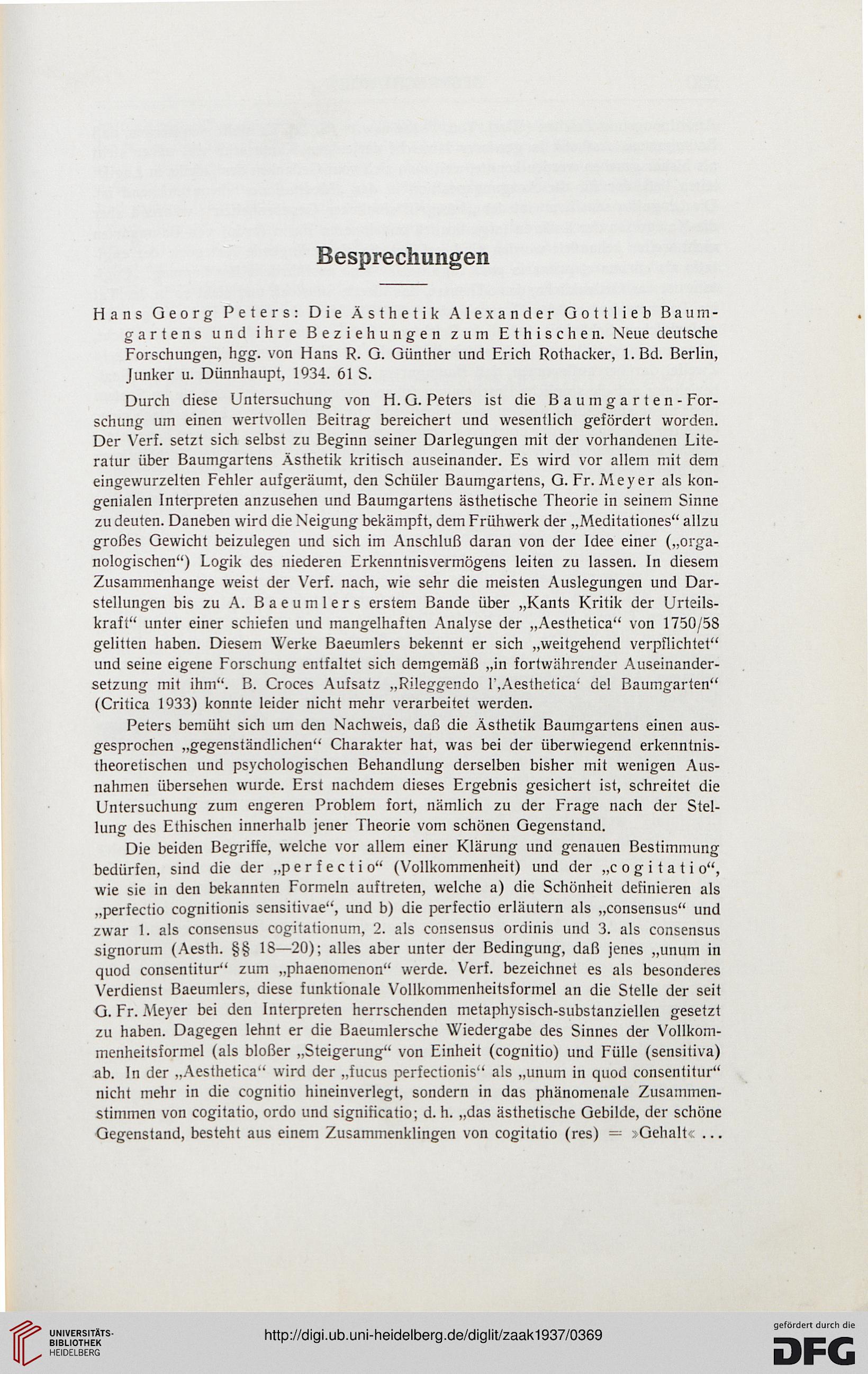Besprechungen
Hans Georg Peters: Die Ästhetik Alexander Gottlieb Baum-
gartens und ihre Beziehungen zum Ethischen. Neue deutsche
Forschungen, hgg. von Hans R. G. Günther und Erich Rothacker, l.Bd. Berlin,
Junker u. Dünnhaupt, 1934. 61 S.
Durch diese Untersuchung von H.G.Peters ist die B a u m g a r t e n - For-
schung um einen wertvollen Beitrag bereichert und wesentlich gefördert worden.
Der Verf. setzt sich selbst zu Beginn seiner Darlegungen mit der vorhandenen Lite-
ratur über Baumgartens Ästhetik kritisch auseinander. Es wird vor allem mit dem
eingewurzelten Fehler aufgeräumt, den Schüler Baumgartens, G. Fr. Meyer als kon-
genialen Interpreten anzusehen und Baumgartens ästhetische Theorie in seinem Sinne
zu deuten. Daneben wird die Neigung bekämpft, dem Frühwerk der „Meditationes" allzu
großes Gewicht beizulegen und sich im Anschluß daran von der Idee einer („orga-
nologischen") Logik des niederen Erkenntnisvermögens leiten zu lassen. In diesem
Zusammenhange weist der Verf. nach, wie sehr die meisten Auslegungen und Dar-
stellungen bis zu A. Baeumlers erstem Bande über „Kants Kritik der Urteils-
kraft" unter einer schiefen und mangelhaften Analyse der „Aesthetica" von 1750/58
gelitten haben. Diesem Werke Baeumlers bekennt er sich „weitgehend verpflichtet"
und seine eigene Forschung entfaltet sich demgemäß „in fortwahrender Auseinander-
setzung mit ihm". B. Croces Aufsatz „Rileggendo 1,Aesthetica' del Baumgarten"
(Critica 1933) konnte leider nicht mehr verarbeitet werden.
Peters bemüht sich um den Nachweis, daß die Ästhetik Baumgartens einen aus-
gesprochen „gegenständlichen" Charakter hat, was bei der überwiegend erkenntnis-
theoretischen und psychologischen Behandlung derselben bisher mit wenigen Aus-
nahmen übersehen wurde. Erst nachdem dieses Ergebnis gesichert ist, schreitet die
Untersuchung zum engeren Problem fort, nämlich zu der Frage nach der Stel-
lung des Ethischen innerhalb jener Theorie vom schönen Gegenstand.
Die beiden Begriffe, welche vor allem einer Klärung und genauen Bestimmung
bedürfen, sind die der „p e r f e c t i o" (Vollkommenheit) und der „c o g i t a t i o",
wie sie in den bekannten Formeln auftreten, welche a) die Schönheit definieren als
„perfectio cognitionis sensitivae", und b) die perfectio erläutern als „consensus" und
zwar 1. als consensus cogitationum, 2. als consensus ordinis und 3. als consensus
signorum (Aesth. §§ 18—20); alles aber unter der Bedingung, daß jenes „unum in
quod consentitur" zum „phaenomenon" werde. Verf. bezeichnet es als besonderes
Verdienst Baeumlers, diese funktionale Vollkommenheitsformel an die Stelle der seit
G. Fr. Meyer bei den Interpreten herrschenden metaphysisch-substanziellen gesetzt
zu haben. Dagegen lehnt er die Baeumlersche Wiedergabe des Sinnes der Vollkom-
menheitsformel (als bloßer „Steigerung" von Einheit (cognitio) und Fülle (sensitiva)
ab. In der „Aesthetica" wird der „fucus perfectionis" als „unum in quod consentitur"
nicht mehr in die cognitio hineinverlegt, sondern in das phänomenale Zusammen-
stimmen von cogitatio, ordo und significatio; d. h. „das ästhetische Gebilde, der schöne
Gegenstand, besteht aus einem Zusammenklingen von cogitatio (res) = Gehalt« ...
Hans Georg Peters: Die Ästhetik Alexander Gottlieb Baum-
gartens und ihre Beziehungen zum Ethischen. Neue deutsche
Forschungen, hgg. von Hans R. G. Günther und Erich Rothacker, l.Bd. Berlin,
Junker u. Dünnhaupt, 1934. 61 S.
Durch diese Untersuchung von H.G.Peters ist die B a u m g a r t e n - For-
schung um einen wertvollen Beitrag bereichert und wesentlich gefördert worden.
Der Verf. setzt sich selbst zu Beginn seiner Darlegungen mit der vorhandenen Lite-
ratur über Baumgartens Ästhetik kritisch auseinander. Es wird vor allem mit dem
eingewurzelten Fehler aufgeräumt, den Schüler Baumgartens, G. Fr. Meyer als kon-
genialen Interpreten anzusehen und Baumgartens ästhetische Theorie in seinem Sinne
zu deuten. Daneben wird die Neigung bekämpft, dem Frühwerk der „Meditationes" allzu
großes Gewicht beizulegen und sich im Anschluß daran von der Idee einer („orga-
nologischen") Logik des niederen Erkenntnisvermögens leiten zu lassen. In diesem
Zusammenhange weist der Verf. nach, wie sehr die meisten Auslegungen und Dar-
stellungen bis zu A. Baeumlers erstem Bande über „Kants Kritik der Urteils-
kraft" unter einer schiefen und mangelhaften Analyse der „Aesthetica" von 1750/58
gelitten haben. Diesem Werke Baeumlers bekennt er sich „weitgehend verpflichtet"
und seine eigene Forschung entfaltet sich demgemäß „in fortwahrender Auseinander-
setzung mit ihm". B. Croces Aufsatz „Rileggendo 1,Aesthetica' del Baumgarten"
(Critica 1933) konnte leider nicht mehr verarbeitet werden.
Peters bemüht sich um den Nachweis, daß die Ästhetik Baumgartens einen aus-
gesprochen „gegenständlichen" Charakter hat, was bei der überwiegend erkenntnis-
theoretischen und psychologischen Behandlung derselben bisher mit wenigen Aus-
nahmen übersehen wurde. Erst nachdem dieses Ergebnis gesichert ist, schreitet die
Untersuchung zum engeren Problem fort, nämlich zu der Frage nach der Stel-
lung des Ethischen innerhalb jener Theorie vom schönen Gegenstand.
Die beiden Begriffe, welche vor allem einer Klärung und genauen Bestimmung
bedürfen, sind die der „p e r f e c t i o" (Vollkommenheit) und der „c o g i t a t i o",
wie sie in den bekannten Formeln auftreten, welche a) die Schönheit definieren als
„perfectio cognitionis sensitivae", und b) die perfectio erläutern als „consensus" und
zwar 1. als consensus cogitationum, 2. als consensus ordinis und 3. als consensus
signorum (Aesth. §§ 18—20); alles aber unter der Bedingung, daß jenes „unum in
quod consentitur" zum „phaenomenon" werde. Verf. bezeichnet es als besonderes
Verdienst Baeumlers, diese funktionale Vollkommenheitsformel an die Stelle der seit
G. Fr. Meyer bei den Interpreten herrschenden metaphysisch-substanziellen gesetzt
zu haben. Dagegen lehnt er die Baeumlersche Wiedergabe des Sinnes der Vollkom-
menheitsformel (als bloßer „Steigerung" von Einheit (cognitio) und Fülle (sensitiva)
ab. In der „Aesthetica" wird der „fucus perfectionis" als „unum in quod consentitur"
nicht mehr in die cognitio hineinverlegt, sondern in das phänomenale Zusammen-
stimmen von cogitatio, ordo und significatio; d. h. „das ästhetische Gebilde, der schöne
Gegenstand, besteht aus einem Zusammenklingen von cogitatio (res) = Gehalt« ...