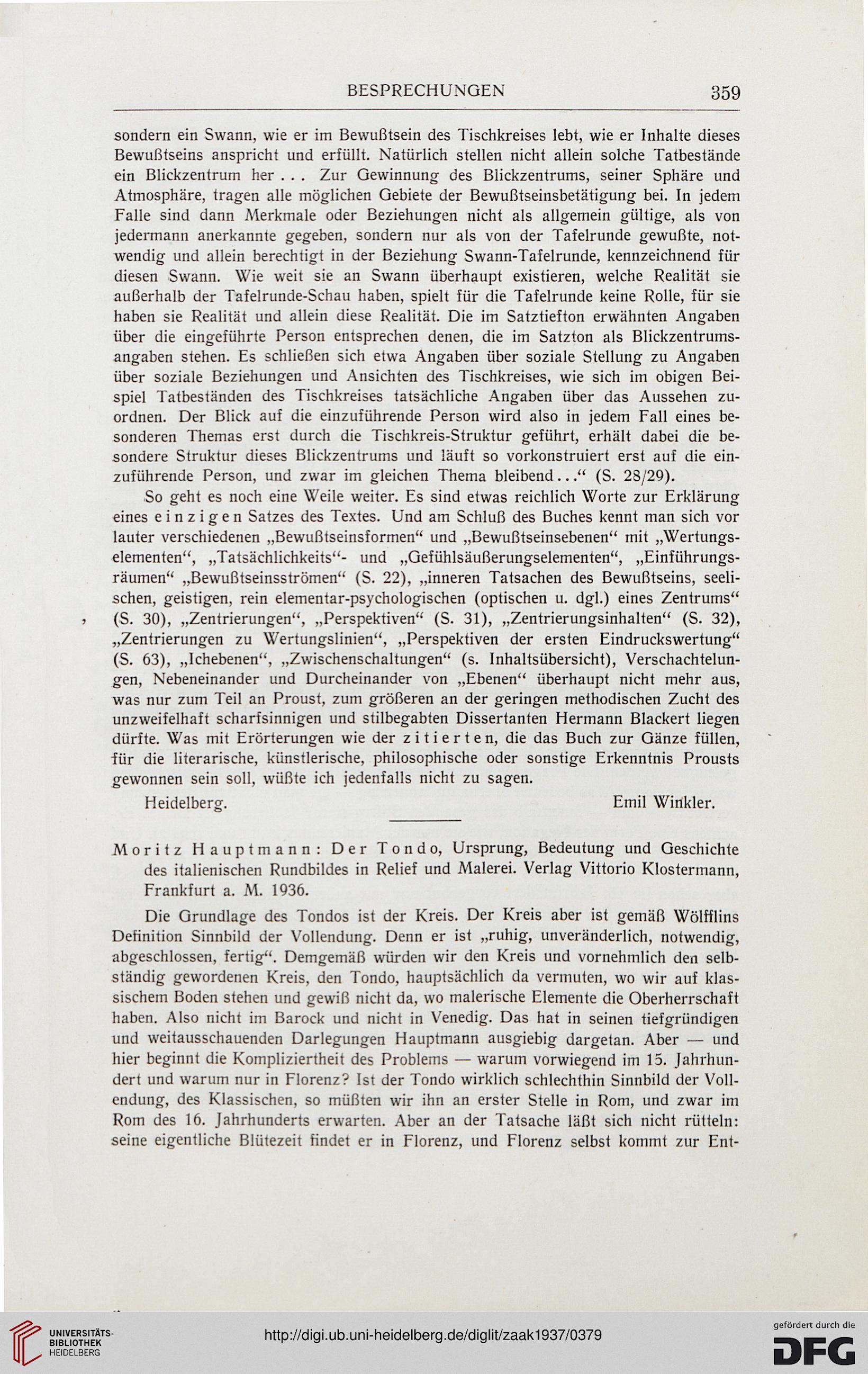BESPRECHUNGEN
359
sondern ein Swann, wie er im Bewußtsein des Tischkreises lebt, wie er Inhalte dieses
Bewußtseins anspricht und erfüllt. Natürlich stellen nicht allein solche Tatbestände
ein Blickzentrum her . . . Zur Gewinnung des Blickzentrums, seiner Sphäre und
Atmosphäre, tragen alle möglichen Gebiete der Bewußtseinsbetätigung bei. In jedem
Falle sind dann Merkmale oder Beziehungen nicht als allgemein gültige, als von
jedermann anerkannte gegeben, sondern nur als von der Tafelrunde gewußte, not-
wendig und allein berechtigt in der Beziehung Swann-Tafelrunde, kennzeichnend für
diesen Swann. Wie weit sie an Swann überhaupt existieren, welche Realität sie
außerhalb der Tafelrunde-Schau haben, spielt für die Tafelrunde keine Rolle, für sie
haben sie Realität und allein diese Realität. Die im Satztiefton erwähnten Angaben
über die eingeführte Person entsprechen denen, die im Satzton als Blickzentrums-
angaben stehen. Es schließen sich etwa Angaben über soziale Stellung zu Angaben
über soziale Beziehungen und Ansichten des Tischkreises, wie sich im obigen Bei-
spiel Tatbeständen des Tischkreises tatsächliche Angaben über das Aussehen zu-
ordnen. Der Blick auf die einzuführende Person wird also in jedem Fall eines be-
sonderen Themas erst durch die Tischkreis-Struktur geführt, erhält dabei die be-
sondere Struktur dieses Blickzentrums und läuft so vorkonstruiert erst auf die ein-
zuführende Person, und zwar im gleichen Thema bleibend..." (S. 28/29).
So geht es noch eine Weile weiter. Es sind etwas reichlich Worte zur Erklärung
eines einzigen Satzes des Textes. Und am Schluß des Buches kennt man sich vor
lauter verschiedenen „Bewußtseinsformen" und „Bewußtseinsebenen" mit „Wertungs-
elementen", „Tatsächlichkeits"- und „Gefühlsäußerungselementen", „Einführungs-
räumen" „Bewußtseinsströmen" (S. 22), „inneren Tatsachen des Bewußtseins, seeli-
schen, geistigen, rein elementar-psychologischen (optischen u. dgl.) eines Zentrums"
> (S. 30), „Zentrierungen", „Perspektiven" (S. 31), „Zentrierungsinhalten" (S. 32),
„Zentrierungen zu Wertungslinien", „Perspektiven der ersten Eindruckswertung"
(S. 63), „Ichebenen", „Zwischenschaltungen" (s. Inhaltsübersicht), Verschachtelun-
gen, Nebeneinander und Durcheinander von „Ebenen" überhaupt nicht mehr aus,
was nur zum Teil an Proust, zum größeren an der geringen methodischen Zucht des
unzweifelhaft scharfsinnigen und stilbegabten Dissertanten Hermann Blackert liegen
dürfte. Was mit Erörterungen wie der zitierten, die das Buch zur Gänze füllen,
für die literarische, künstlerische, philosophische oder sonstige Erkenntnis Prousts
gewonnen sein soll, wüßte ich jedenfalls nicht zu sagen.
Heidelberg. Emil Winkler.
Moritz Hauptmann: Der Tondo, Ursprung, Bedeutung und Geschichte
des italienischen Rundbildes in Relief und Malerei. Verlag Vittorio Klostermann,
Frankfurt a. M. 1936.
Die Grundlage des Tondos ist der Kreis. Der Kreis aber ist gemäß Wölfflins
Definition Sinnbild der Vollendung. Denn er ist „ruhig, unveränderlich, notwendig,
abgeschlossen, fertig". Demgemäß würden wir den Kreis und vornehmlich den selb-
ständig gewordenen Kreis, den Tondo, hauptsächlich da vermuten, wo wir auf klas-
sischem Boden stehen und gewiß nicht da, wo malerische Elemente die Oberherrschaft
haben. Also nicht im Barock und nicht in Venedig. Das hat in seinen tiefgründigen
und weitausschauenden Darlegungen Hauptmann ausgiebig dargetan. Aber — und
hier beginnt die Kompliziertheit des Problems — warum vorwiegend im 15. Jahrhun-
dert und warum nur in Florenz? Ist der Tondo wirklich schlechthin Sinnbild der Voll-
endung, des Klassischen, so müßten wir ihn an erster Stelle in Rom, und zwar im
Rom des 16. Jahrhunderts erwarten. Aber an der Tatsache läßt sich nicht rütteln:
seine eigentliche Blütezeit findet er in Florenz, und Florenz selbst kommt zur Ent-
359
sondern ein Swann, wie er im Bewußtsein des Tischkreises lebt, wie er Inhalte dieses
Bewußtseins anspricht und erfüllt. Natürlich stellen nicht allein solche Tatbestände
ein Blickzentrum her . . . Zur Gewinnung des Blickzentrums, seiner Sphäre und
Atmosphäre, tragen alle möglichen Gebiete der Bewußtseinsbetätigung bei. In jedem
Falle sind dann Merkmale oder Beziehungen nicht als allgemein gültige, als von
jedermann anerkannte gegeben, sondern nur als von der Tafelrunde gewußte, not-
wendig und allein berechtigt in der Beziehung Swann-Tafelrunde, kennzeichnend für
diesen Swann. Wie weit sie an Swann überhaupt existieren, welche Realität sie
außerhalb der Tafelrunde-Schau haben, spielt für die Tafelrunde keine Rolle, für sie
haben sie Realität und allein diese Realität. Die im Satztiefton erwähnten Angaben
über die eingeführte Person entsprechen denen, die im Satzton als Blickzentrums-
angaben stehen. Es schließen sich etwa Angaben über soziale Stellung zu Angaben
über soziale Beziehungen und Ansichten des Tischkreises, wie sich im obigen Bei-
spiel Tatbeständen des Tischkreises tatsächliche Angaben über das Aussehen zu-
ordnen. Der Blick auf die einzuführende Person wird also in jedem Fall eines be-
sonderen Themas erst durch die Tischkreis-Struktur geführt, erhält dabei die be-
sondere Struktur dieses Blickzentrums und läuft so vorkonstruiert erst auf die ein-
zuführende Person, und zwar im gleichen Thema bleibend..." (S. 28/29).
So geht es noch eine Weile weiter. Es sind etwas reichlich Worte zur Erklärung
eines einzigen Satzes des Textes. Und am Schluß des Buches kennt man sich vor
lauter verschiedenen „Bewußtseinsformen" und „Bewußtseinsebenen" mit „Wertungs-
elementen", „Tatsächlichkeits"- und „Gefühlsäußerungselementen", „Einführungs-
räumen" „Bewußtseinsströmen" (S. 22), „inneren Tatsachen des Bewußtseins, seeli-
schen, geistigen, rein elementar-psychologischen (optischen u. dgl.) eines Zentrums"
> (S. 30), „Zentrierungen", „Perspektiven" (S. 31), „Zentrierungsinhalten" (S. 32),
„Zentrierungen zu Wertungslinien", „Perspektiven der ersten Eindruckswertung"
(S. 63), „Ichebenen", „Zwischenschaltungen" (s. Inhaltsübersicht), Verschachtelun-
gen, Nebeneinander und Durcheinander von „Ebenen" überhaupt nicht mehr aus,
was nur zum Teil an Proust, zum größeren an der geringen methodischen Zucht des
unzweifelhaft scharfsinnigen und stilbegabten Dissertanten Hermann Blackert liegen
dürfte. Was mit Erörterungen wie der zitierten, die das Buch zur Gänze füllen,
für die literarische, künstlerische, philosophische oder sonstige Erkenntnis Prousts
gewonnen sein soll, wüßte ich jedenfalls nicht zu sagen.
Heidelberg. Emil Winkler.
Moritz Hauptmann: Der Tondo, Ursprung, Bedeutung und Geschichte
des italienischen Rundbildes in Relief und Malerei. Verlag Vittorio Klostermann,
Frankfurt a. M. 1936.
Die Grundlage des Tondos ist der Kreis. Der Kreis aber ist gemäß Wölfflins
Definition Sinnbild der Vollendung. Denn er ist „ruhig, unveränderlich, notwendig,
abgeschlossen, fertig". Demgemäß würden wir den Kreis und vornehmlich den selb-
ständig gewordenen Kreis, den Tondo, hauptsächlich da vermuten, wo wir auf klas-
sischem Boden stehen und gewiß nicht da, wo malerische Elemente die Oberherrschaft
haben. Also nicht im Barock und nicht in Venedig. Das hat in seinen tiefgründigen
und weitausschauenden Darlegungen Hauptmann ausgiebig dargetan. Aber — und
hier beginnt die Kompliziertheit des Problems — warum vorwiegend im 15. Jahrhun-
dert und warum nur in Florenz? Ist der Tondo wirklich schlechthin Sinnbild der Voll-
endung, des Klassischen, so müßten wir ihn an erster Stelle in Rom, und zwar im
Rom des 16. Jahrhunderts erwarten. Aber an der Tatsache läßt sich nicht rütteln:
seine eigentliche Blütezeit findet er in Florenz, und Florenz selbst kommt zur Ent-