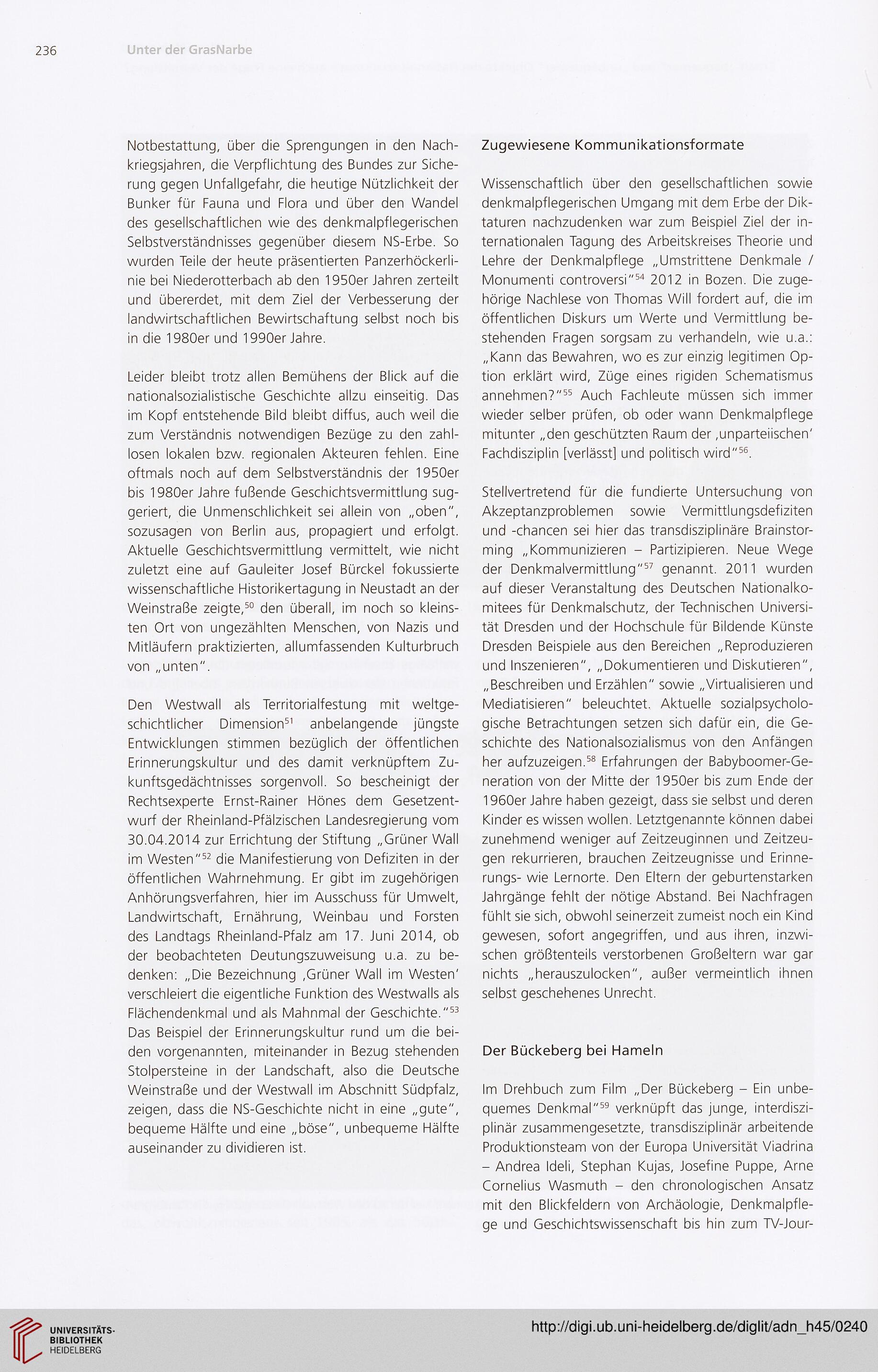236
Unter der GrasNarbe
Notbestattung, über die Sprengungen in den Nach-
kriegsjahren, die Verpflichtung des Bundes zur Siche-
rung gegen Unfallgefahr, die heutige Nützlichkeit der
Bunker für Fauna und Flora und über den Wandel
des gesellschaftlichen wie des denkmalpflegerischen
Selbstverständnisses gegenüber diesem NS-Erbe. So
wurden Teile der heute präsentierten Panzerhöckerli-
nie bei Niederotterbach ab den 1950er Jahren zerteilt
und übererdet, mit dem Ziel der Verbesserung der
landwirtschaftlichen Bewirtschaftung selbst noch bis
in die 1980er und 1990er Jahre.
Leider bleibt trotz allen Bemühens der Blick auf die
nationalsozialistische Geschichte allzu einseitig. Das
im Kopf entstehende Bild bleibt diffus, auch weil die
zum Verständnis notwendigen Bezüge zu den zahl-
losen lokalen bzw. regionalen Akteuren fehlen. Eine
oftmals noch auf dem Selbstverständnis der 1950er
bis 1980er Jahre fußende Geschichtsvermittlung sug-
geriert, die Unmenschlichkeit sei allein von „oben",
sozusagen von Berlin aus, propagiert und erfolgt.
Aktuelle Geschichtsvermittlung vermittelt, wie nicht
zuletzt eine auf Gauleiter Josef Bürckel fokussierte
wissenschaftliche Historikertagung in Neustadt an der
Weinstraße zeigte,50 den überall, im noch so kleins-
ten Ort von ungezählten Menschen, von Nazis und
Mitläufern praktizierten, allumfassenden Kulturbruch
von „unten".
Den Westwall als Territorialfestung mit weltge-
schichtlicher Dimension51 anbelangende jüngste
Entwicklungen stimmen bezüglich der öffentlichen
Erinnerungskultur und des damit verknüpftem Zu-
kunftsgedächtnisses sorgenvoll. So bescheinigt der
Rechtsexperte Ernst-Rainer Hönes dem Gesetzent-
wurf der Rheinland-Pfälzischen Landesregierung vom
30.04.2014 zur Errichtung der Stiftung „Grüner Wall
im Westen"52 die Manifestierung von Defiziten in der
öffentlichen Wahrnehmung. Er gibt im zugehörigen
Anhörungsverfahren, hier im Ausschuss für Umwelt,
Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten
des Landtags Rheinland-Pfalz am 17. Juni 2014, ob
der beobachteten Deutungszuweisung u.a. zu be-
denken: „Die Bezeichnung .Grüner Wall im Westen'
verschleiert die eigentliche Funktion des Westwalls als
Flächendenkmal und als Mahnmal der Geschichte."53
Das Beispiel der Erinnerungskultur rund um die bei-
den vorgenannten, miteinander in Bezug stehenden
Stolpersteine in der Landschaft, also die Deutsche
Weinstraße und der Westwall im Abschnitt Südpfalz,
zeigen, dass die NS-Geschichte nicht in eine „gute",
bequeme Hälfte und eine „böse", unbequeme Hälfte
auseinander zu dividieren ist.
Zugewiesene Kommunikationsformate
Wissenschaftlich über den gesellschaftlichen sowie
denkmalpflegerischen Umgang mit dem Erbe der Dik-
taturen nachzudenken war zum Beispiel Ziel der in-
ternationalen Tagung des Arbeitskreises Theorie und
Lehre der Denkmalpflege „Umstrittene Denkmale /
Monumenti controversi"54 2012 in Bozen. Die zuge-
hörige Nachlese von Thomas Will fordert auf, die im
öffentlichen Diskurs um Werte und Vermittlung be-
stehenden Fragen sorgsam zu verhandeln, wie u.a.:
„Kann das Bewahren, wo es zur einzig legitimen Op-
tion erklärt wird, Züge eines rigiden Schematismus
annehmen?"55 Auch Fachleute müssen sich immer
wieder selber prüfen, ob oder wann Denkmalpflege
mitunter „den geschützten Raum der .unparteiischen'
Fachdisziplin [verlässt] und politisch wird"56.
Stellvertretend für die fundierte Untersuchung von
Akzeptanzproblemen sowie Vermittlungsdefiziten
und -chancen sei hier das transdisziplinäre Brainstor-
ming „Kommunizieren - Partizipieren. Neue Wege
der Denkmalvermittlung"57 genannt. 2011 wurden
auf dieser Veranstaltung des Deutschen Nationalko-
mitees für Denkmalschutz, der Technischen Universi-
tät Dresden und der Hochschule für Bildende Künste
Dresden Beispiele aus den Bereichen „Reproduzieren
und Inszenieren", „Dokumentieren und Diskutieren",
„Beschreiben und Erzählen" sowie „Virtualisieren und
Mediatisieren" beleuchtet. Aktuelle sozialpsycholo-
gische Betrachtungen setzen sich dafür ein, die Ge-
schichte des Nationalsozialismus von den Anfängen
her aufzuzeigen.58 Erfahrungen der Babyboomer-Ge-
neration von der Mitte der 1950er bis zum Ende der
1960er Jahre haben gezeigt, dass sie selbst und deren
Kinder es wissen wollen. Letztgenannte können dabei
zunehmend weniger auf Zeitzeuginnen und Zeitzeu-
gen rekurrieren, brauchen Zeitzeugnisse und Erinne-
rungs- wie Lernorte. Den Eltern der geburtenstarken
Jahrgänge fehlt der nötige Abstand. Bei Nachfragen
fühlt sie sich, obwohl seinerzeit zumeist noch ein Kind
gewesen, sofort angegriffen, und aus ihren, inzwi-
schen größtenteils verstorbenen Großeltern war gar
nichts „herauszulocken", außer vermeintlich ihnen
selbst geschehenes Unrecht.
Der Bückeberg bei Hameln
Im Drehbuch zum Film „Der Bückeberg - Ein unbe-
quemes Denkmal"59 verknüpft das junge, interdiszi-
plinär zusammengesetzte, transdisziplinär arbeitende
Produktionsteam von der Europa Universität Viadrina
- Andrea Ideli, Stephan Kujas, Josefine Puppe, Arne
Cornelius Wasmuth - den chronologischen Ansatz
mit den Blickfeldern von Archäologie, Denkmalpfle-
ge und Geschichtswissenschaft bis hin zum TV-Jour-
Unter der GrasNarbe
Notbestattung, über die Sprengungen in den Nach-
kriegsjahren, die Verpflichtung des Bundes zur Siche-
rung gegen Unfallgefahr, die heutige Nützlichkeit der
Bunker für Fauna und Flora und über den Wandel
des gesellschaftlichen wie des denkmalpflegerischen
Selbstverständnisses gegenüber diesem NS-Erbe. So
wurden Teile der heute präsentierten Panzerhöckerli-
nie bei Niederotterbach ab den 1950er Jahren zerteilt
und übererdet, mit dem Ziel der Verbesserung der
landwirtschaftlichen Bewirtschaftung selbst noch bis
in die 1980er und 1990er Jahre.
Leider bleibt trotz allen Bemühens der Blick auf die
nationalsozialistische Geschichte allzu einseitig. Das
im Kopf entstehende Bild bleibt diffus, auch weil die
zum Verständnis notwendigen Bezüge zu den zahl-
losen lokalen bzw. regionalen Akteuren fehlen. Eine
oftmals noch auf dem Selbstverständnis der 1950er
bis 1980er Jahre fußende Geschichtsvermittlung sug-
geriert, die Unmenschlichkeit sei allein von „oben",
sozusagen von Berlin aus, propagiert und erfolgt.
Aktuelle Geschichtsvermittlung vermittelt, wie nicht
zuletzt eine auf Gauleiter Josef Bürckel fokussierte
wissenschaftliche Historikertagung in Neustadt an der
Weinstraße zeigte,50 den überall, im noch so kleins-
ten Ort von ungezählten Menschen, von Nazis und
Mitläufern praktizierten, allumfassenden Kulturbruch
von „unten".
Den Westwall als Territorialfestung mit weltge-
schichtlicher Dimension51 anbelangende jüngste
Entwicklungen stimmen bezüglich der öffentlichen
Erinnerungskultur und des damit verknüpftem Zu-
kunftsgedächtnisses sorgenvoll. So bescheinigt der
Rechtsexperte Ernst-Rainer Hönes dem Gesetzent-
wurf der Rheinland-Pfälzischen Landesregierung vom
30.04.2014 zur Errichtung der Stiftung „Grüner Wall
im Westen"52 die Manifestierung von Defiziten in der
öffentlichen Wahrnehmung. Er gibt im zugehörigen
Anhörungsverfahren, hier im Ausschuss für Umwelt,
Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten
des Landtags Rheinland-Pfalz am 17. Juni 2014, ob
der beobachteten Deutungszuweisung u.a. zu be-
denken: „Die Bezeichnung .Grüner Wall im Westen'
verschleiert die eigentliche Funktion des Westwalls als
Flächendenkmal und als Mahnmal der Geschichte."53
Das Beispiel der Erinnerungskultur rund um die bei-
den vorgenannten, miteinander in Bezug stehenden
Stolpersteine in der Landschaft, also die Deutsche
Weinstraße und der Westwall im Abschnitt Südpfalz,
zeigen, dass die NS-Geschichte nicht in eine „gute",
bequeme Hälfte und eine „böse", unbequeme Hälfte
auseinander zu dividieren ist.
Zugewiesene Kommunikationsformate
Wissenschaftlich über den gesellschaftlichen sowie
denkmalpflegerischen Umgang mit dem Erbe der Dik-
taturen nachzudenken war zum Beispiel Ziel der in-
ternationalen Tagung des Arbeitskreises Theorie und
Lehre der Denkmalpflege „Umstrittene Denkmale /
Monumenti controversi"54 2012 in Bozen. Die zuge-
hörige Nachlese von Thomas Will fordert auf, die im
öffentlichen Diskurs um Werte und Vermittlung be-
stehenden Fragen sorgsam zu verhandeln, wie u.a.:
„Kann das Bewahren, wo es zur einzig legitimen Op-
tion erklärt wird, Züge eines rigiden Schematismus
annehmen?"55 Auch Fachleute müssen sich immer
wieder selber prüfen, ob oder wann Denkmalpflege
mitunter „den geschützten Raum der .unparteiischen'
Fachdisziplin [verlässt] und politisch wird"56.
Stellvertretend für die fundierte Untersuchung von
Akzeptanzproblemen sowie Vermittlungsdefiziten
und -chancen sei hier das transdisziplinäre Brainstor-
ming „Kommunizieren - Partizipieren. Neue Wege
der Denkmalvermittlung"57 genannt. 2011 wurden
auf dieser Veranstaltung des Deutschen Nationalko-
mitees für Denkmalschutz, der Technischen Universi-
tät Dresden und der Hochschule für Bildende Künste
Dresden Beispiele aus den Bereichen „Reproduzieren
und Inszenieren", „Dokumentieren und Diskutieren",
„Beschreiben und Erzählen" sowie „Virtualisieren und
Mediatisieren" beleuchtet. Aktuelle sozialpsycholo-
gische Betrachtungen setzen sich dafür ein, die Ge-
schichte des Nationalsozialismus von den Anfängen
her aufzuzeigen.58 Erfahrungen der Babyboomer-Ge-
neration von der Mitte der 1950er bis zum Ende der
1960er Jahre haben gezeigt, dass sie selbst und deren
Kinder es wissen wollen. Letztgenannte können dabei
zunehmend weniger auf Zeitzeuginnen und Zeitzeu-
gen rekurrieren, brauchen Zeitzeugnisse und Erinne-
rungs- wie Lernorte. Den Eltern der geburtenstarken
Jahrgänge fehlt der nötige Abstand. Bei Nachfragen
fühlt sie sich, obwohl seinerzeit zumeist noch ein Kind
gewesen, sofort angegriffen, und aus ihren, inzwi-
schen größtenteils verstorbenen Großeltern war gar
nichts „herauszulocken", außer vermeintlich ihnen
selbst geschehenes Unrecht.
Der Bückeberg bei Hameln
Im Drehbuch zum Film „Der Bückeberg - Ein unbe-
quemes Denkmal"59 verknüpft das junge, interdiszi-
plinär zusammengesetzte, transdisziplinär arbeitende
Produktionsteam von der Europa Universität Viadrina
- Andrea Ideli, Stephan Kujas, Josefine Puppe, Arne
Cornelius Wasmuth - den chronologischen Ansatz
mit den Blickfeldern von Archäologie, Denkmalpfle-
ge und Geschichtswissenschaft bis hin zum TV-Jour-