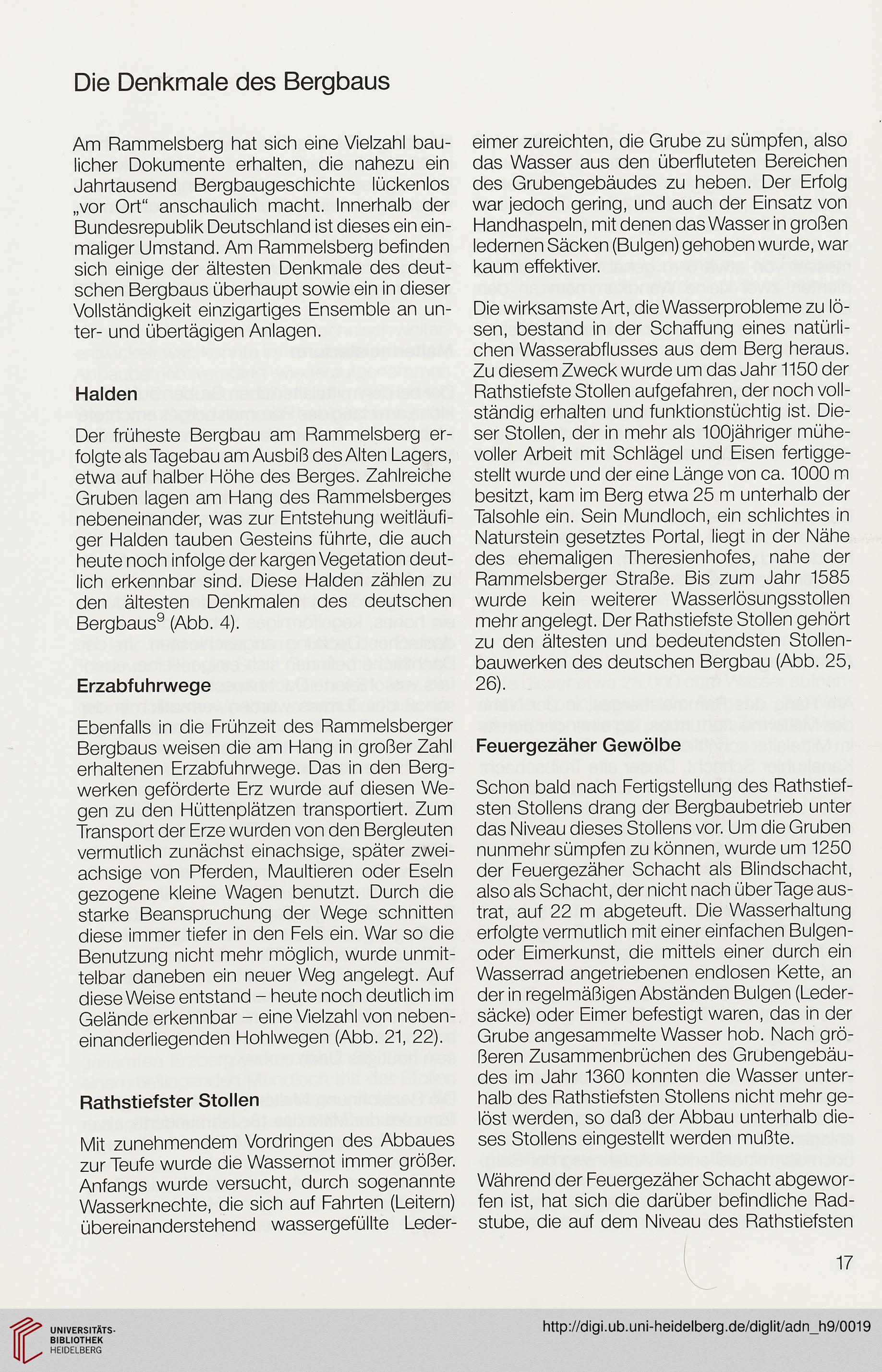Die Denkmale des Bergbaus
Am Rammeisberg hat sich eine Vielzahl bau-
licher Dokumente erhalten, die nahezu ein
Jahrtausend Bergbaugeschichte lückenlos
„vor Ort“ anschaulich macht. Innerhalb der
Bundesrepublik Deutschland ist dieses ein ein-
maliger Umstand. Am Rammeisberg befinden
sich einige der ältesten Denkmale des deut-
schen Bergbaus überhaupt sowie ein in dieser
Vollständigkeit einzigartiges Ensemble an un-
ter- und übertägigen Anlagen.
Halden
Der früheste Bergbau am Rammeisberg er-
folgte als Tagebau am Ausbiß des Alten Lagers,
etwa auf halber Höhe des Berges. Zahlreiche
Gruben lagen am Hang des Rammeisberges
nebeneinander, was zur Entstehung weitläufi-
ger Halden tauben Gesteins führte, die auch
heute noch infolge der kargen Vegetation deut-
lich erkennbar sind. Diese Halden zählen zu
den ältesten Denkmalen des deutschen
Bergbaus9 (Abb. 4).
Erzabfuhrwege
Ebenfalls in die Frühzeit des Rammeisberger
Bergbaus weisen die am Hang in großer Zahl
erhaltenen Erzabfuhrwege. Das in den Berg-
werken geförderte Erz wurde auf diesen We-
gen zu den Hüttenpiätzen transportiert. Zum
Transport der Erze wurden von den Bergleuten
vermutlich zunächst einachsige, später zwei-
achsige von Pferden, Maultieren oder Eseln
gezogene kleine Wagen benutzt. Durch die
starke Beanspruchung der Wege schnitten
diese immer tiefer in den Fels ein. War so die
Benutzung nicht mehr möglich, wurde unmit-
telbar daneben ein neuer Weg angelegt. Auf
diese Weise entstand - heute noch deutlich im
Gelände erkennbar - eine Vielzahl von neben-
einanderliegenden Hohlwegen (Abb. 21, 22).
Rathstiefster Stollen
Mit zunehmendem Vordringen des Abbaues
zur Teufe wurde die Wassernot immer größer.
Anfangs wurde versucht, durch sogenannte
Wasserknechte, die sich auf Fahrten (Leitern)
übereinanderstehend wassergefüllte Leder-
eimer zureichten, die Grube zu sümpfen, also
das Wasser aus den überfluteten Bereichen
des Grubengebäudes zu heben. Der Erfolg
war jedoch gering, und auch der Einsatz von
Handhaspeln, mit denen das Wasser in großen
ledernen Säcken (Bulgen) gehoben wurde, war
kaum effektiver.
Die wirksamste Art, die Wasserprobleme zu lö-
sen, bestand in der Schaffung eines natürli-
chen Wasserabflusses aus dem Berg heraus.
Zu diesem Zweck wurde um das Jahr 1150 der
Rathstiefste Stollen aufgefahren, der noch voll-
ständig erhalten und funktionstüchtig ist. Die-
ser Stollen, der in mehr als 10Ojähriger mühe-
voller Arbeit mit Schlägel und Eisen fertigge-
stellt wurde und der eine Länge von ca. 1000 m
besitzt, kam im Berg etwa 25 m unterhalb der
Talsohle ein. Sein Mundloch, ein schlichtes in
Naturstein gesetztes Portal, liegt in der Nähe
des ehemaligen Theresienhofes, nahe der
Rammeisberger Straße. Bis zum Jahr 1585
wurde kein weiterer Wasserlösungsstollen
mehr angelegt. Der Rathstiefste Stollen gehört
zu den ältesten und bedeutendsten Stollen-
bauwerken des deutschen Bergbau (Abb. 25,
26).
Feuergezäher Gewölbe
Schon bald nach Fertigstellung des Rathstief-
sten Stollens drang der Bergbaubetrieb unter
das Niveau dieses Stollens vor. Um die Gruben
nunmehr sümpfen zu können, wurde um 1250
der Feuergezäher Schacht als Blindschacht,
also als Schacht, der nicht nach überTage aus-
trat, auf 22 m abgeteuft. Die Wasserhaltung
erfolgte vermutlich mit einer einfachen Bulgen-
oder Eimerkunst, die mittels einer durch ein
Wasserrad angetriebenen endlosen Kette, an
der in regelmäßigen Abständen Bulgen (Leder-
säcke) oder Eimer befestigt waren, das in der
Grube angesammelte Wasser hob. Nach grö-
ßeren Zusammenbrüchen des Grubengebäu-
des im Jahr 1360 konnten die Wasser unter-
halb des Rathstiefsten Stollens nicht mehr ge-
löst werden, so daß der Abbau unterhalb die-
ses Stollens eingestellt werden mußte.
Während der Feuergezäher Schacht abgewor-
fen ist, hat sich die darüber befindliche Rad-
stube, die auf dem Niveau des Rathstiefsten
17
Am Rammeisberg hat sich eine Vielzahl bau-
licher Dokumente erhalten, die nahezu ein
Jahrtausend Bergbaugeschichte lückenlos
„vor Ort“ anschaulich macht. Innerhalb der
Bundesrepublik Deutschland ist dieses ein ein-
maliger Umstand. Am Rammeisberg befinden
sich einige der ältesten Denkmale des deut-
schen Bergbaus überhaupt sowie ein in dieser
Vollständigkeit einzigartiges Ensemble an un-
ter- und übertägigen Anlagen.
Halden
Der früheste Bergbau am Rammeisberg er-
folgte als Tagebau am Ausbiß des Alten Lagers,
etwa auf halber Höhe des Berges. Zahlreiche
Gruben lagen am Hang des Rammeisberges
nebeneinander, was zur Entstehung weitläufi-
ger Halden tauben Gesteins führte, die auch
heute noch infolge der kargen Vegetation deut-
lich erkennbar sind. Diese Halden zählen zu
den ältesten Denkmalen des deutschen
Bergbaus9 (Abb. 4).
Erzabfuhrwege
Ebenfalls in die Frühzeit des Rammeisberger
Bergbaus weisen die am Hang in großer Zahl
erhaltenen Erzabfuhrwege. Das in den Berg-
werken geförderte Erz wurde auf diesen We-
gen zu den Hüttenpiätzen transportiert. Zum
Transport der Erze wurden von den Bergleuten
vermutlich zunächst einachsige, später zwei-
achsige von Pferden, Maultieren oder Eseln
gezogene kleine Wagen benutzt. Durch die
starke Beanspruchung der Wege schnitten
diese immer tiefer in den Fels ein. War so die
Benutzung nicht mehr möglich, wurde unmit-
telbar daneben ein neuer Weg angelegt. Auf
diese Weise entstand - heute noch deutlich im
Gelände erkennbar - eine Vielzahl von neben-
einanderliegenden Hohlwegen (Abb. 21, 22).
Rathstiefster Stollen
Mit zunehmendem Vordringen des Abbaues
zur Teufe wurde die Wassernot immer größer.
Anfangs wurde versucht, durch sogenannte
Wasserknechte, die sich auf Fahrten (Leitern)
übereinanderstehend wassergefüllte Leder-
eimer zureichten, die Grube zu sümpfen, also
das Wasser aus den überfluteten Bereichen
des Grubengebäudes zu heben. Der Erfolg
war jedoch gering, und auch der Einsatz von
Handhaspeln, mit denen das Wasser in großen
ledernen Säcken (Bulgen) gehoben wurde, war
kaum effektiver.
Die wirksamste Art, die Wasserprobleme zu lö-
sen, bestand in der Schaffung eines natürli-
chen Wasserabflusses aus dem Berg heraus.
Zu diesem Zweck wurde um das Jahr 1150 der
Rathstiefste Stollen aufgefahren, der noch voll-
ständig erhalten und funktionstüchtig ist. Die-
ser Stollen, der in mehr als 10Ojähriger mühe-
voller Arbeit mit Schlägel und Eisen fertigge-
stellt wurde und der eine Länge von ca. 1000 m
besitzt, kam im Berg etwa 25 m unterhalb der
Talsohle ein. Sein Mundloch, ein schlichtes in
Naturstein gesetztes Portal, liegt in der Nähe
des ehemaligen Theresienhofes, nahe der
Rammeisberger Straße. Bis zum Jahr 1585
wurde kein weiterer Wasserlösungsstollen
mehr angelegt. Der Rathstiefste Stollen gehört
zu den ältesten und bedeutendsten Stollen-
bauwerken des deutschen Bergbau (Abb. 25,
26).
Feuergezäher Gewölbe
Schon bald nach Fertigstellung des Rathstief-
sten Stollens drang der Bergbaubetrieb unter
das Niveau dieses Stollens vor. Um die Gruben
nunmehr sümpfen zu können, wurde um 1250
der Feuergezäher Schacht als Blindschacht,
also als Schacht, der nicht nach überTage aus-
trat, auf 22 m abgeteuft. Die Wasserhaltung
erfolgte vermutlich mit einer einfachen Bulgen-
oder Eimerkunst, die mittels einer durch ein
Wasserrad angetriebenen endlosen Kette, an
der in regelmäßigen Abständen Bulgen (Leder-
säcke) oder Eimer befestigt waren, das in der
Grube angesammelte Wasser hob. Nach grö-
ßeren Zusammenbrüchen des Grubengebäu-
des im Jahr 1360 konnten die Wasser unter-
halb des Rathstiefsten Stollens nicht mehr ge-
löst werden, so daß der Abbau unterhalb die-
ses Stollens eingestellt werden mußte.
Während der Feuergezäher Schacht abgewor-
fen ist, hat sich die darüber befindliche Rad-
stube, die auf dem Niveau des Rathstiefsten
17