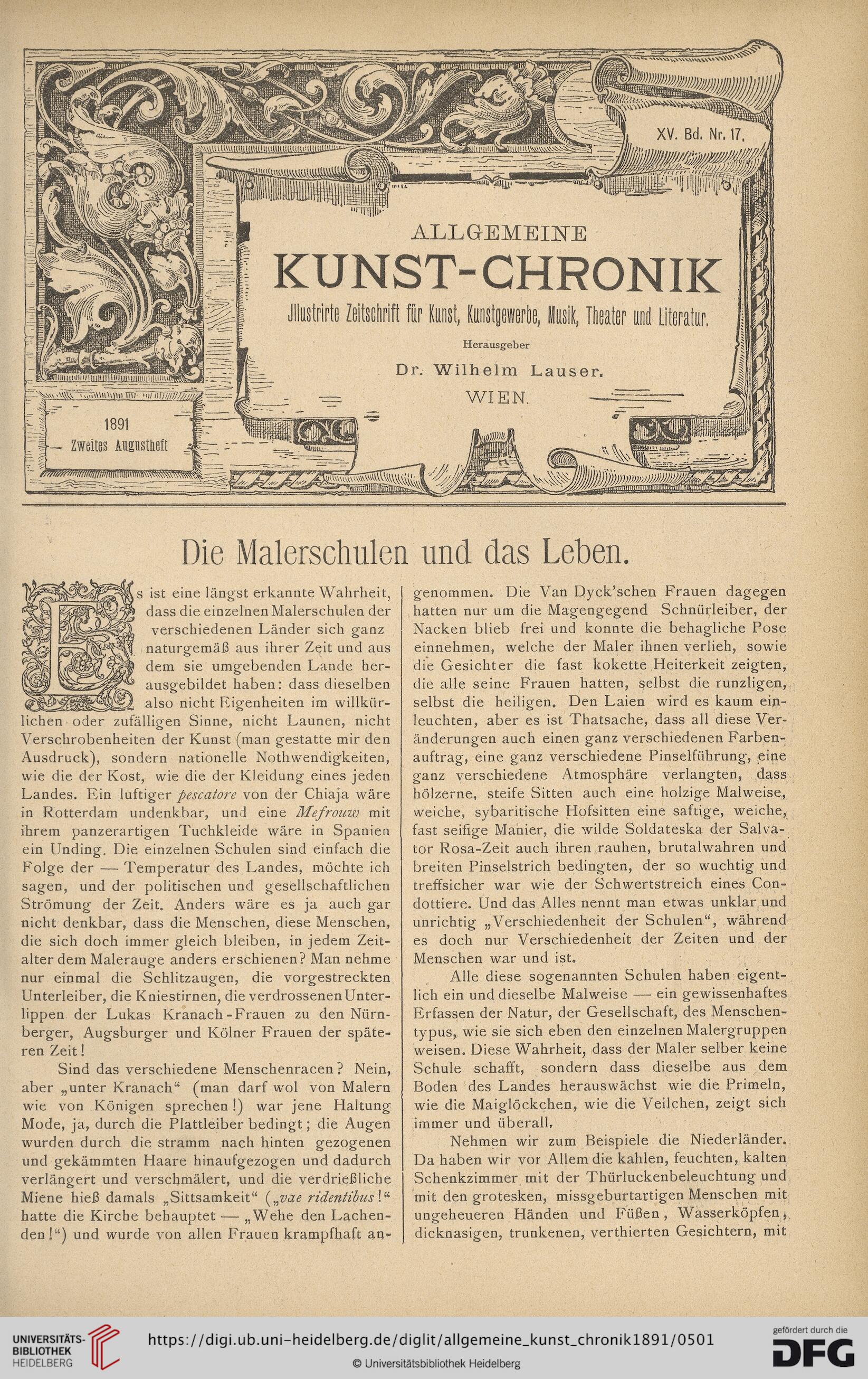Die Malerschulen und das Leben.
s ist eine längst erkannte Wahrheit,
dass die einzelnen Malerschulen der
verschiedenen Länder sich ganz
naturgemäß aus ihrer Zeit und aus
dem sie umgebenden Lande her-
ausgebildet haben: dass dieselben
also nicht Eigenheiten im willkür-
lichen oder zufälligen Sinne, nicht Launen, nicht
Verschrobenheiten der Kunst (man gestatte mir den
Ausdruck), sondern nationeile Nothwendigkeiten,
wie die der Kost, wie die der Kleidung eines jeden
Landes. Ein luftiger pescatore von der Chiaja wäre
in Rotterdam undenkbar, und eine Mefrouw mit
ihrem panzerartigen Tuchkleide wäre in Spanien
ein Unding. Die einzelnen Schulen sind einfach die
Folge der — Temperatur des Landes, möchte ich
sagen, und der politischen und gesellschaftlichen
Strömung der Zeit. Anders wäre es ja auch gar
nicht denkbar, dass die Menschen, diese Menschen,
die sich doch immer gleich bleiben, in jedem Zeit-
alter dem Malerauge anders erschienen? Man nehme
nur einmal die Schlitzaugen, die vorgestreckten
Unterleiber, die Kniestirnen, die verdrossenen Unter-
lippen der Lukas Kranach-Frauen zu den Nürn-
berger, Augsburger und Kölner Frauen der späte-
ren Zeit!
Sind das verschiedene Menschenracen ? Nein,
aber „unter Kranach" (man darf wol von Malern
wie von Königen sprechen!) war jene Haltung
Mode, ja, durch die Plattleiber bedingt; die Augen
wurden durch die stramm nach hinten gezogenen
und gekämmten Haare hinaufgezogen und dadurch
verlängert und verschmälert, und die verdrießliche
Miene hieß damals „Sittsamkeit" („vae ridentibus !"
hatte die Kirche behauptet — „Wehe den Lachen-
den !") und wurde von allen Frauen krampfhaft an-
genommen. Die Van Dyck'schen Frauen dagegen
hatten nur um die Magengegend Schnürleiber, der
Nacken blieb frei und konnte die behagliche Pose
einnehmen, welche der Maler ihnen verlieh, sowie
die Gesichter die fast kokette Heiterkeit zeigten,
die alle seine Frauen hatten, selbst die runzligen,
selbst die heiligen. Den Laien wird es kaum ein-
leuchten, aber es ist Thatsache, dass all diese Ver-
änderungen auch einen ganz verschiedenen Farben-
auftrag, eine ganz verschiedene Pinselführung, eine
ganz verschiedene Atmosphäre verlangten, dass
hölzerne, steife Sitten auch eine holzige Malweise,
weiche, sybaritische Hofsitten eine saftige, weiche,
fast seifige Manier, die wilde Soldateska der Salva-
tor Rosa-Zeit auch ihren rauhen, brutalwahren und
breiten Pinselstrich bedingten, der so wuchtig und
treffsicher war wie der Schwertstreich eines Con-
dottiere. Und das Alles nennt man etwas unklar und
unrichtig „Verschiedenheit der Schulen", während
es doch nur Verschiedenheit der Zeiten und der
Menschen war und ist.
Alle diese sogenannten Schulen haben eigent-
lich ein und dieselbe Malweise — ein gewissenhaftes
Erfassen der Natur, der Gesellschaft, des Menschen-
typus, wie sie sich eben den einzelnen Malergruppen
weisen. Diese Wahrheit, dass der Maler selber keine
Schule schafft, sondern dass dieselbe aus dem
Boden des Landes herauswächst wie die Primeln,
wie die Maiglöckchen, wie die Veilchen, zeigt sich
immer und überall.
Nehmen wir zum Beispiele die Niederländer.
Da haben wir vor Allem die kahlen, feuchten, kalten
Schenkzimmer mit der Thürluckenbeleuchtung und
mit den grotesken, missgeburtartigen Menschen mit
ungeheueren Händen und Füßen, Wasserköpfen,
dicknasigen, trunkenen, verthierten Gesichtern, mit