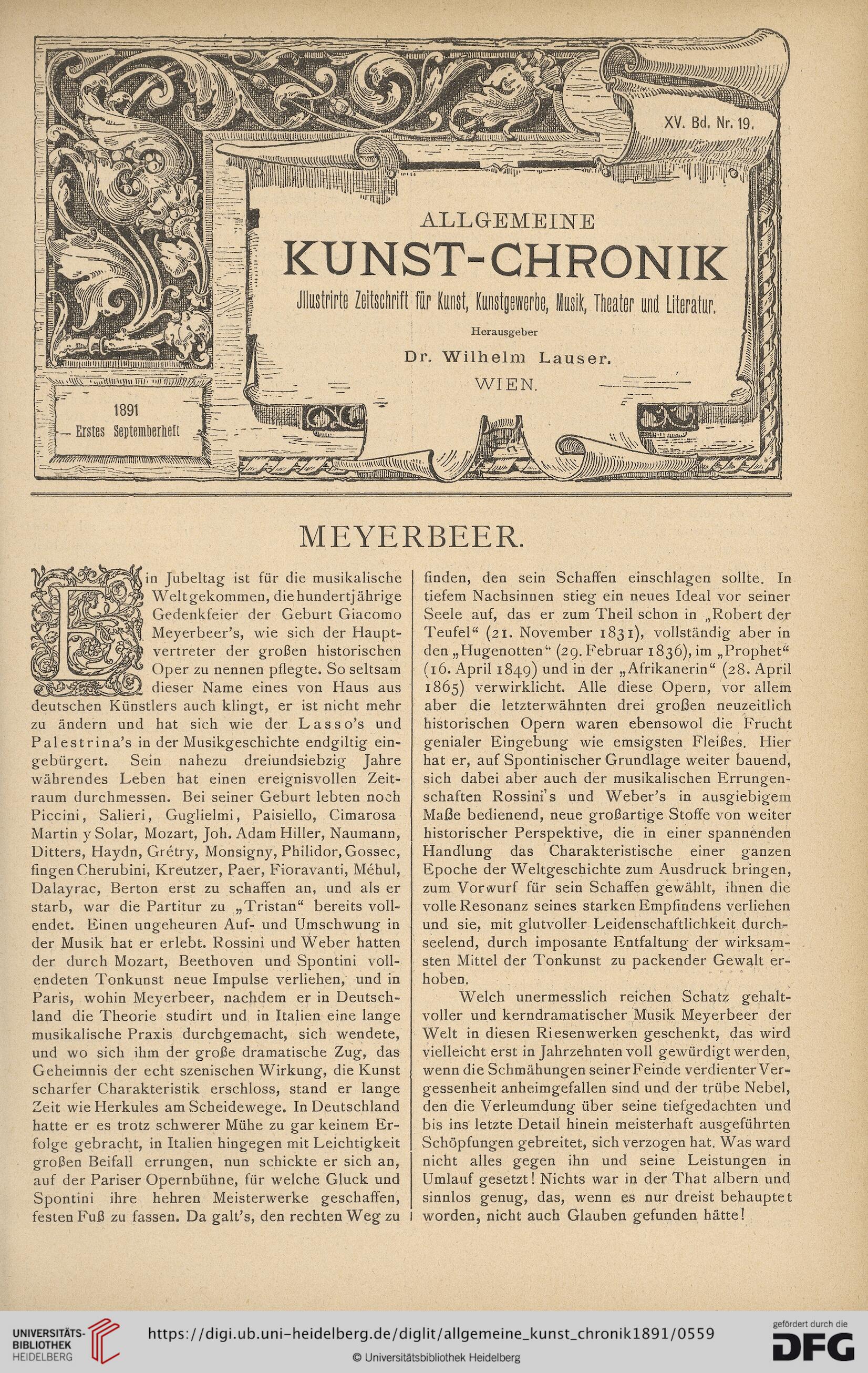XV. Bd. Nr. 19.
Ringln ^-^ffi
1891
Erstes Septemberlieft y
^mww/wmww^
ALLGEMEINE
KUNST-CHRONIK
^ Zeitschrift für Kunst, Kmstffle, II< Theater und Literatur.
Herausgeber
Dr. Wilhelm Lauser
WIEN.
MEYERBEER.
in Jubeltag ist für die musikalische
Weltgekommen, die hundertjährige
Gedenkfeier der Geburt Giacomo
Meyerbeer's, wie sich der Haupt-
vertreter der großen historischen
Oper zu nennen pflegte. So seltsam
dieser Name eines von Haus aus
deutschen Künstlers auch klingt, er ist nicht mehr
zu ändern und hat sich wie der Lasso's und
Palestrina's in der Musikgeschichte endgiltig ein-
gebürgert. Sein nahezu dreiundsiebzig Jahre
währendes Leben hat einen ereignisvollen Zeit-
raum durchmessen. Bei seiner Geburt lebten noch
Piccini, Salieri, Guglielmi, Paisiello, Cimarosa
Martin y Solar, Mozart, Joh. Adam Hiller, Naumann,
Ditters, Haydn, Gretry, Monsigny, Philidor, Gossec,
fingen Cherubini, Kreutzer, Paer, Fioravanti, Mehul,
Dalayrac, Berton erst zu schaffen an, und als er
starb, war die Partitur zu „Tristan" bereits voll-
endet. Einen ungeheuren Auf- und Umschwung in
der Musik hat er erlebt. Rossini und Weber hatten
der durch Mozart, Beethoven und Spontini voll-
endeten Tonkunst neue Impulse verliehen, und in
Paris, wohin Meyerbeer, nachdem er in Deutsch-
land die Theorie studirt und in Italien eine lange
musikalische Praxis durchgemacht, sich wendete,
und wo sich ihm der große dramatische Zug, das
Geheimnis der echt szenischen Wirkung, die Kunst
scharfer Charakteristik erschloss, stand er lange
Zeit wie Herkules am Scheidewege. In Deutschland
hatte er es trotz schwerer Mühe zu gar keinem Er-
folge gebracht, in Italien hingegen mit Leichtigkeit
großen Beifall errungen, nun schickte er sich an,
auf der Pariser Opernbühne, für welche Gluck und
Spontini ihre hehren Meisterwerke geschaffen,
festen Fuß zu fassen. Da galt's, den rechten Weg zu I
finden, den sein Schaffen einschlagen sollte. In
tiefem Nachsinnen stieg ein neues Ideal vor seiner
Seele auf, das er zum Theil schon in „Robert der
Teufel" (2 1. November 1831), vollständig aber in
den „Hugenotten" (29. Februar 1836), im „Prophet"
(16. April 1849) und in der „Afrikanerin" (28. April
1865) verwirklicht. Alle diese Opern, vor allem
aber die letzterwähnten drei großen neuzeitlich
historischen Opern waren ebensowol die Frucht
genialer Eingebung wie emsigsten Fleißes. Hier
hat er, auf Spontinischer Grundlage weiter bauend,
sich dabei aber auch der musikalischen Errungen-
schaften Rossini's und Weber's in ausgiebigem
Maße bedienend, neue großartige Stoffe von weiter
historischer Perspektive, die in einer spannenden
Handlung das Charakteristische einer ganzen
Epoche der Weltgeschichte zum Ausdruck bringen,
zum Vorwurf für sein Schaffen gewählt, ihnen die
volle Resonanz seines starken Empfindens verliehen
und sie, mit glutvoller Leidenschaftlichkeit durch-
seelend, durch imposante Entfaltung der wirksam-
sten Mittel der Tonkunst zu packender Gewalt er-
hoben.
Welch unermesslich reichen Schatz gehalt-
voller und kerndramatischer Musik Meyerbeer der
Welt in diesen Riesenwerken geschenkt, das wird
vielleicht erst in Jahrzehnten voll gewürdigt werden,
wenn die Schmähungen seiner Feinde verdienter Ver-
gessenheit anheimgefallen sind und der trübe Nebel,
den die Verleumdung über seine tiefgedachten und
bis ins letzte Detail hinein meisterhaft ausgeführten
Schöpfungen gebreitet, sich verzogen hat. Was ward
nicht alles gegen ihn und seine Leistungen in
Umlauf gesetzt! Nichts war in der That albern und
sinnlos genug, das, wenn es nur dreist behauptet
worden, nicht auch Glauben gefunden hätte!