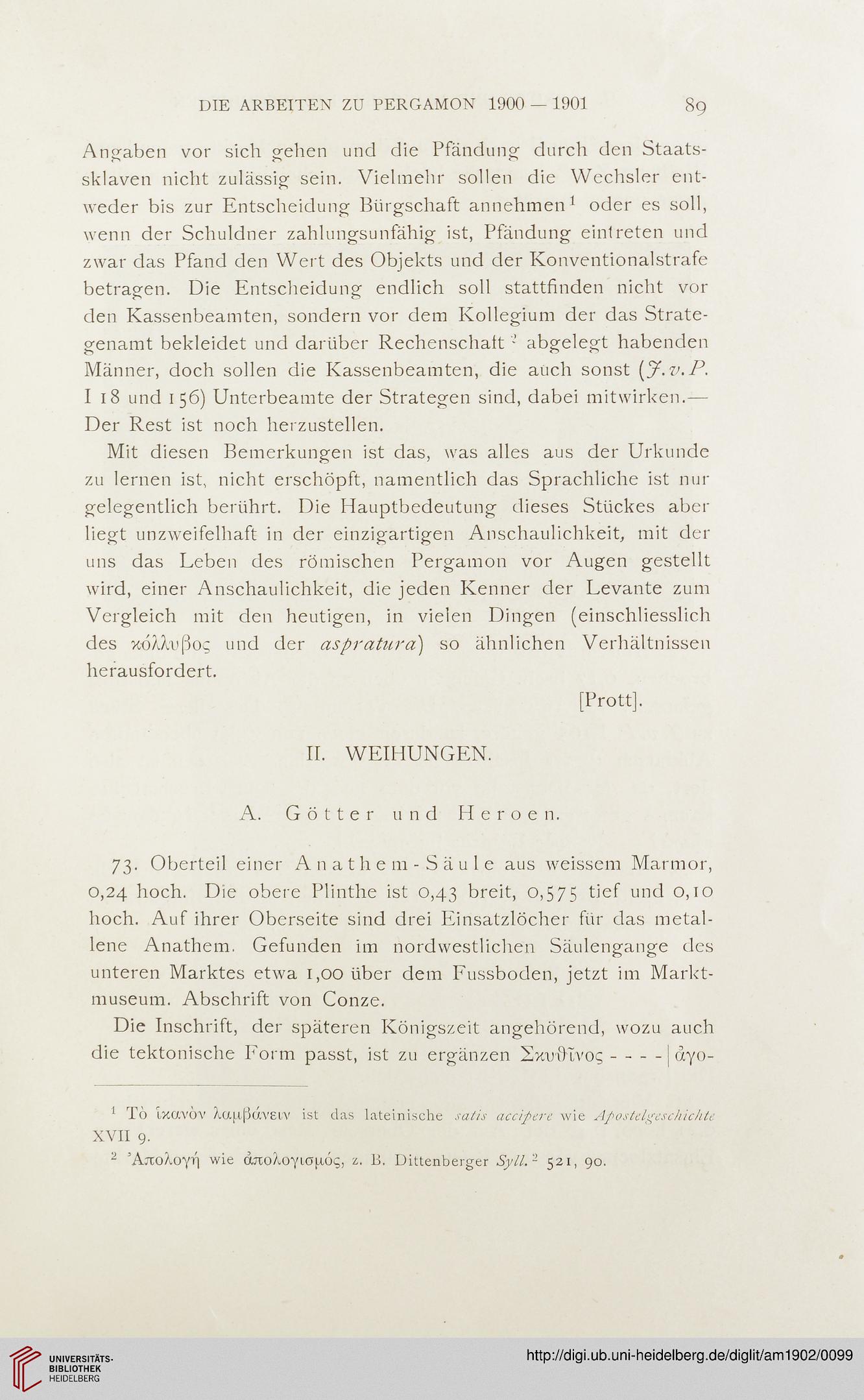DIE ARBEITEN ZU PERGAMON 1900 — 1901
89
Angaben vor sich gehen und die Pfändung durch den Staats-
sklaven nicht zulässig sein. Vielmehr sollen die Wechsler ent-
weder bis zur Entscheidung Bürgschaft annehmen1 oder es soll,
wenn der Schuldner zahlungsunfähig ist, Pfändung einlreten und
zwar das Pfand den Wert des Objekts und der Konventionalstrafe
betragen. Die Entscheidung endlich soll stattfinden nicht vor
den Kassenbeamten, sondern vor dem Kollegium der das Strate-
genamt bekleidet und darüber Rechenschaftabgelegt habenden
Männer, doch sollen die Kassenbeamten, die auch sonst (J.v.P.
I 18 und 156) Unterbeamte der Strategen sind, dabei mitwirken.—
Der Rest ist noch herzustellen.
Mit diesen Bemerkungen ist das, was alles aus der Urkunde
zu lernen ist, nicht erschöpft, namentlich das Sprachliche ist nur
gelegentlich berührt. Die Hauptbedeutung dieses Stückes aber
hegt unzweifelhaft in der einzigartigen Anschaulichkeit, mit der
uns das Leben des römischen Pergamon vor Augen gestellt
wird, einer Anschaulichkeit, die jeden Kenner der Levante zum
Vergleich mit den heutigen, in vielen Dingen (einschliesslich
des κόλλυβος und der aspratura) so ähnlichen Verhältnissen
herausfordert.
[Prott],
II. WEIHUNGEN.
A. Götter und Heroen.
73. Oberteil einer Anathem-Säule aus weissem Marmor,
0,24 hoch. Die obere Plinthe ist 0,43 breit, 0,575 tief und 0,10
hoch. Auf ihrer Oberseite sind drei Einsatzlöcher für das metal-
lene Anathem. Gefunden im nordwestlichen Säulengange des
unteren Marktes etwa 1,00 über dem Fussboden, jetzt im Markt-
museum. Abschrift von Conze.
Die Inschrift, der späteren Königszeit angehörend, wozu auch
die tektonische Form passt, ist zu ergänzen ΣκυΌΊνος-| άγο-
1 Τό Ικανόν λαμβάνειν ist das lateinische satis accipere wie Apostelgeschichte
XVII 9.
2 Άπολογή wie απολογισμός, z. B. Dittenberger Syll. 2 521, 90.
89
Angaben vor sich gehen und die Pfändung durch den Staats-
sklaven nicht zulässig sein. Vielmehr sollen die Wechsler ent-
weder bis zur Entscheidung Bürgschaft annehmen1 oder es soll,
wenn der Schuldner zahlungsunfähig ist, Pfändung einlreten und
zwar das Pfand den Wert des Objekts und der Konventionalstrafe
betragen. Die Entscheidung endlich soll stattfinden nicht vor
den Kassenbeamten, sondern vor dem Kollegium der das Strate-
genamt bekleidet und darüber Rechenschaftabgelegt habenden
Männer, doch sollen die Kassenbeamten, die auch sonst (J.v.P.
I 18 und 156) Unterbeamte der Strategen sind, dabei mitwirken.—
Der Rest ist noch herzustellen.
Mit diesen Bemerkungen ist das, was alles aus der Urkunde
zu lernen ist, nicht erschöpft, namentlich das Sprachliche ist nur
gelegentlich berührt. Die Hauptbedeutung dieses Stückes aber
hegt unzweifelhaft in der einzigartigen Anschaulichkeit, mit der
uns das Leben des römischen Pergamon vor Augen gestellt
wird, einer Anschaulichkeit, die jeden Kenner der Levante zum
Vergleich mit den heutigen, in vielen Dingen (einschliesslich
des κόλλυβος und der aspratura) so ähnlichen Verhältnissen
herausfordert.
[Prott],
II. WEIHUNGEN.
A. Götter und Heroen.
73. Oberteil einer Anathem-Säule aus weissem Marmor,
0,24 hoch. Die obere Plinthe ist 0,43 breit, 0,575 tief und 0,10
hoch. Auf ihrer Oberseite sind drei Einsatzlöcher für das metal-
lene Anathem. Gefunden im nordwestlichen Säulengange des
unteren Marktes etwa 1,00 über dem Fussboden, jetzt im Markt-
museum. Abschrift von Conze.
Die Inschrift, der späteren Königszeit angehörend, wozu auch
die tektonische Form passt, ist zu ergänzen ΣκυΌΊνος-| άγο-
1 Τό Ικανόν λαμβάνειν ist das lateinische satis accipere wie Apostelgeschichte
XVII 9.
2 Άπολογή wie απολογισμός, z. B. Dittenberger Syll. 2 521, 90.