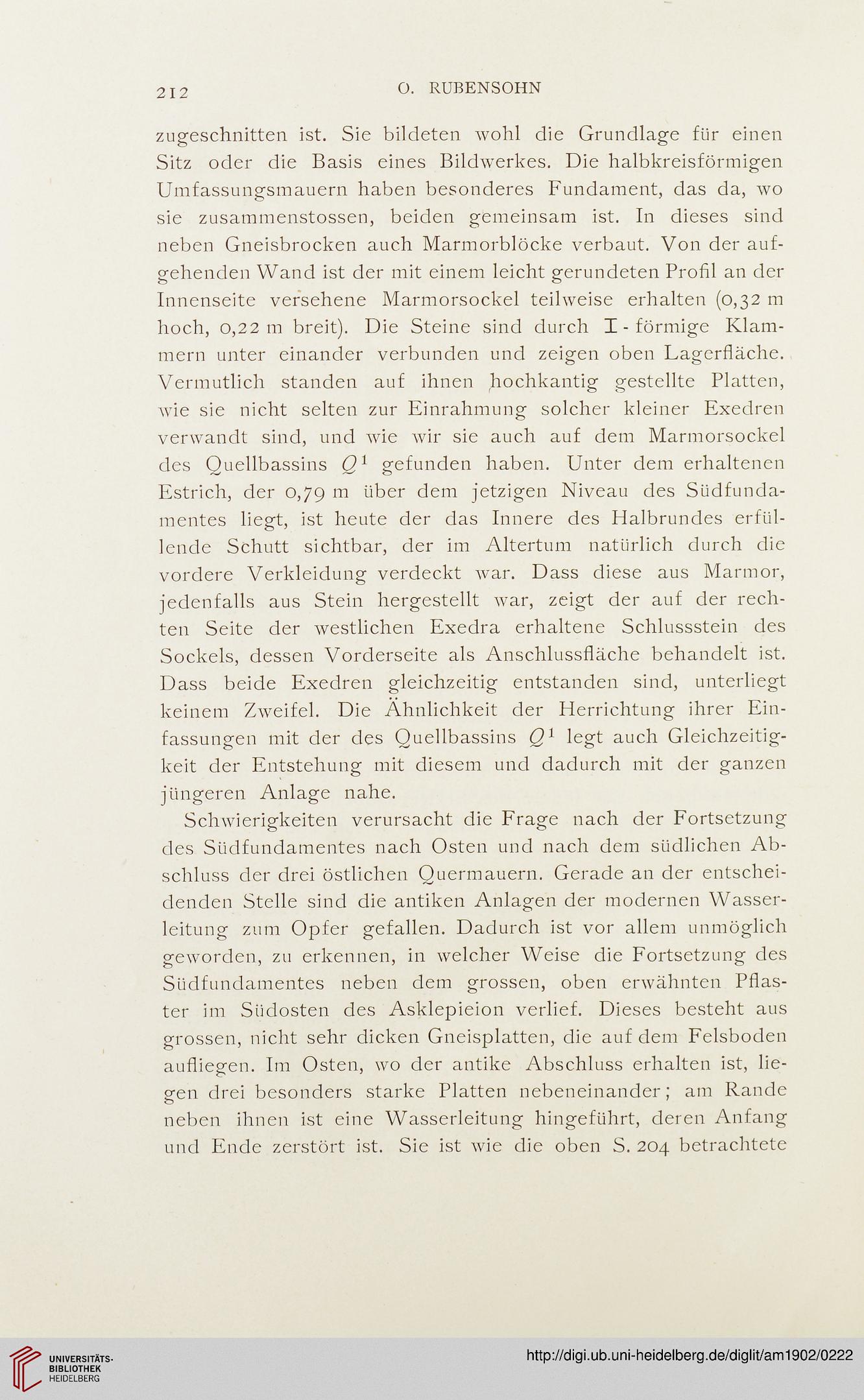212
O. RUBENSOHN
zugeschnitten ist. Sie bildeten wohl die Grundlage für einen
Sitz oder die Basis eines Bildwerkes. Die halbkreisförmigen
Umfassungsmauern haben besonderes Fundament, das da, wo
sie zusammenstossen, beiden gemeinsam ist. In dieses sind
neben Gneisbrocken auch Marmorblöcke verbaut. Von der auf-
gehenden Wand ist der mit einem leicht gerundeten Profil an der
Innenseite versehene Marmorsockel teilweise erhalten (0,32 m
hoch, 0,22m breit). Die Steine sind durch I-förmige Klam-
mern unter einander verbunden und zeigen oben Lagerfläche.
Vermutlich standen auf ihnen hochkantig gestellte Platten,
wie sie nicht selten zur Einrahmung solcher kleiner Exedren
verwandt sind, und wie wir sie auch auf dem Marmorsockel
des Quellbassins Q1 gefunden haben. Unter dem erhaltenen
Estrich, der 0,79 m über dem jetzigen Niveau des Südfunda-
mentes liegt, ist heute der das Innere des Halbrundes erfül-
lende Schutt sichtbar, der im Altertum natürlich durch die
vordere Verkleidung verdeckt war. Dass diese aus Marmor,
jedenfalls aus Stein hergestellt war, zeigt der auf der rech-
ten Seite der westlichen Exedra erhaltene Schlussstein des
Sockels, dessen Vorderseite als Anschlussfläche behandelt ist.
Dass beide Exedren gleichzeitig entstanden sind, unterliegt
keinem Zweifel. Die Ähnlichkeit der Herrichtung ihrer Ein-
fassungen mit der des Quellbassins Q1 legt auch Gleichzeitig-
keit der Entstehung mit diesem und dadurch mit der ganzen
jüngeren Anlage nahe.
Schwierigkeiten verursacht die Frage nach der Fortsetzung
des Südfundamentes nach Osten und nach dem südlichen Ab-
schluss der drei östlichen Ouermauern. Gerade an der entschei-
denden Stelle sind die antiken Anlagen der modernen Wasser-
leitung zum Opfer gefallen. Dadurch ist vor allem unmöglich
geworden, zu erkennen, in welcher Weise die Fortsetzung des
Südfundamentes neben dem grossen, oben erwähnten Pflas-
ter im Südosten des Asklepieion verlief. Dieses besteht aus
grossen, nicht sehr dicken Gneisplatten, die auf dem Felsboden
aufliegen. Im Osten, wo der antike Abschluss erhalten ist, lie-
gen drei besonders starke Platten nebeneinander; am Rande
neben ihnen ist eine Wasserleitung hingeführt, deren Anfang
und Ende zerstört ist. Sie ist wie die oben S. 204 betrachtete
O. RUBENSOHN
zugeschnitten ist. Sie bildeten wohl die Grundlage für einen
Sitz oder die Basis eines Bildwerkes. Die halbkreisförmigen
Umfassungsmauern haben besonderes Fundament, das da, wo
sie zusammenstossen, beiden gemeinsam ist. In dieses sind
neben Gneisbrocken auch Marmorblöcke verbaut. Von der auf-
gehenden Wand ist der mit einem leicht gerundeten Profil an der
Innenseite versehene Marmorsockel teilweise erhalten (0,32 m
hoch, 0,22m breit). Die Steine sind durch I-förmige Klam-
mern unter einander verbunden und zeigen oben Lagerfläche.
Vermutlich standen auf ihnen hochkantig gestellte Platten,
wie sie nicht selten zur Einrahmung solcher kleiner Exedren
verwandt sind, und wie wir sie auch auf dem Marmorsockel
des Quellbassins Q1 gefunden haben. Unter dem erhaltenen
Estrich, der 0,79 m über dem jetzigen Niveau des Südfunda-
mentes liegt, ist heute der das Innere des Halbrundes erfül-
lende Schutt sichtbar, der im Altertum natürlich durch die
vordere Verkleidung verdeckt war. Dass diese aus Marmor,
jedenfalls aus Stein hergestellt war, zeigt der auf der rech-
ten Seite der westlichen Exedra erhaltene Schlussstein des
Sockels, dessen Vorderseite als Anschlussfläche behandelt ist.
Dass beide Exedren gleichzeitig entstanden sind, unterliegt
keinem Zweifel. Die Ähnlichkeit der Herrichtung ihrer Ein-
fassungen mit der des Quellbassins Q1 legt auch Gleichzeitig-
keit der Entstehung mit diesem und dadurch mit der ganzen
jüngeren Anlage nahe.
Schwierigkeiten verursacht die Frage nach der Fortsetzung
des Südfundamentes nach Osten und nach dem südlichen Ab-
schluss der drei östlichen Ouermauern. Gerade an der entschei-
denden Stelle sind die antiken Anlagen der modernen Wasser-
leitung zum Opfer gefallen. Dadurch ist vor allem unmöglich
geworden, zu erkennen, in welcher Weise die Fortsetzung des
Südfundamentes neben dem grossen, oben erwähnten Pflas-
ter im Südosten des Asklepieion verlief. Dieses besteht aus
grossen, nicht sehr dicken Gneisplatten, die auf dem Felsboden
aufliegen. Im Osten, wo der antike Abschluss erhalten ist, lie-
gen drei besonders starke Platten nebeneinander; am Rande
neben ihnen ist eine Wasserleitung hingeführt, deren Anfang
und Ende zerstört ist. Sie ist wie die oben S. 204 betrachtete