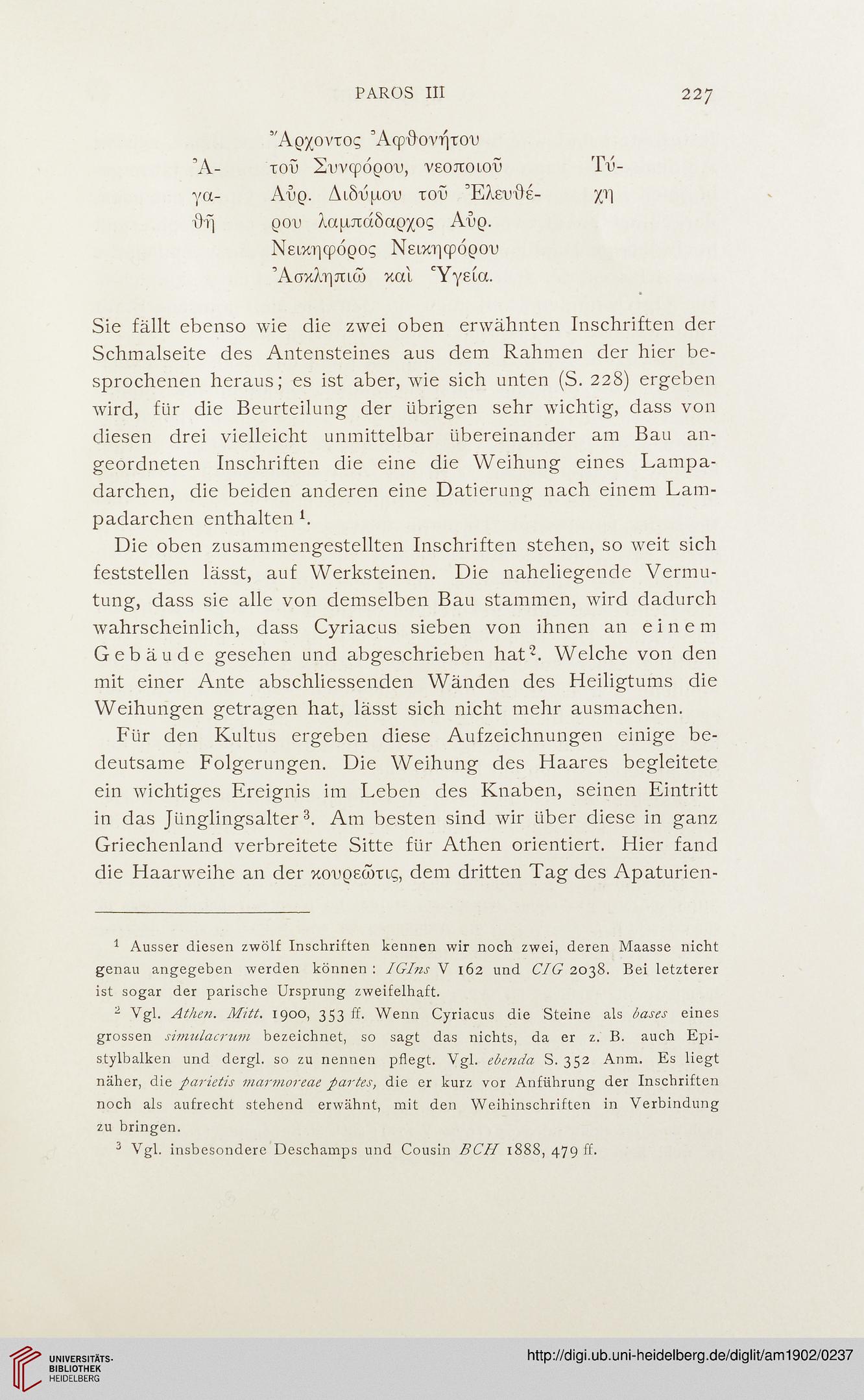PAROS III
227
Άρχοντος ’Αψθονήτου
Α-
τοΰ Συνφόρου, νεοποιοΰ
Τΰ
γα-
Αυρ. Δίδυμου τοΰ Ελευθέ-
χη
θή
ρου λαμπάδαρχος Αυρ.
Νεικηφόρος Νεικηφόρου
Άσκληπιώ και Υγεία.
Sie fällt ebenso wie die zwei oben erwähnten Inschriften der
Schmalseite des Antensteines aus dem Rahmen der hier be-
sprochenen heraus; es ist aber, wie sich unten (S. 228) ergeben
wird, für die Beurteilung der übrigen sehr wichtig, dass von
diesen drei vielleicht unmittelbar übereinander am Bau an-
geordneten Inschriften die eine die Weihung eines Lampa-
darchen, die beiden anderen eine Datierung nach einem Lam-
padarchen enthalten 1.
Die oben zusammengestellten Inschriften stehen, so weit sich
feststellen lässt, auf Werksteinen. Die naheliegende Vermu-
tung, dass sie alle von demselben Bau stammen, wird dadurch
wahrscheinlich, dass Cyriacus sieben von ihnen an eine m
Gebäude gesehen und abgeschrieben hat2. Welche von den
mit einer Ante abschliessenden Wänden des Heiligtums die
Weihungen getragen hat, lässt sich nicht mehr ausmachen.
Für den Kultus ergeben diese Aufzeichnungen einige be-
deutsame Folgerungen. Die Weihung des Haares begleitete
ein wichtiges Ereignis im Leben des Knaben, seinen Eintritt
in das Jünglingsalter3. Am besten sind wir über diese in ganz
Griechenland verbreitete Sitte für Athen orientiert. Hier fand
die Haarweihe an der κουρεώτις, dem dritten Tag des Apaturien-
1 Ausser diesen zwölf Inschriften kennen wir noch zwei, deren Maasse nicht
genau angegeben werden können : IGIns V 162 und CIG 2038. Bei letzterer
ist sogar der parische Ursprung zweifelhaft.
λ Vgl. Athen. Mitt. 1900, 353 ff. Wenn Cyriacus die Steine als bases eines
grossen shnulacrtt.ni bezeichnet, so sagt das nichts, da er z. B. auch Epi-
stylbalken und dergl. so zu nennen pflegt. Vgl. ebenda S. 352 Anm. Es liegt
näher, die parietis marmoreae partes, die er kurz vor Anführung der Inschriften
noch als aufrecht stehend erwähnt, mit den Weihinschriften in Verbindung
zu bringen.
3 Vgl. insbesondere Deschamps und Cousin BCH 1888, 479 ff.
227
Άρχοντος ’Αψθονήτου
Α-
τοΰ Συνφόρου, νεοποιοΰ
Τΰ
γα-
Αυρ. Δίδυμου τοΰ Ελευθέ-
χη
θή
ρου λαμπάδαρχος Αυρ.
Νεικηφόρος Νεικηφόρου
Άσκληπιώ και Υγεία.
Sie fällt ebenso wie die zwei oben erwähnten Inschriften der
Schmalseite des Antensteines aus dem Rahmen der hier be-
sprochenen heraus; es ist aber, wie sich unten (S. 228) ergeben
wird, für die Beurteilung der übrigen sehr wichtig, dass von
diesen drei vielleicht unmittelbar übereinander am Bau an-
geordneten Inschriften die eine die Weihung eines Lampa-
darchen, die beiden anderen eine Datierung nach einem Lam-
padarchen enthalten 1.
Die oben zusammengestellten Inschriften stehen, so weit sich
feststellen lässt, auf Werksteinen. Die naheliegende Vermu-
tung, dass sie alle von demselben Bau stammen, wird dadurch
wahrscheinlich, dass Cyriacus sieben von ihnen an eine m
Gebäude gesehen und abgeschrieben hat2. Welche von den
mit einer Ante abschliessenden Wänden des Heiligtums die
Weihungen getragen hat, lässt sich nicht mehr ausmachen.
Für den Kultus ergeben diese Aufzeichnungen einige be-
deutsame Folgerungen. Die Weihung des Haares begleitete
ein wichtiges Ereignis im Leben des Knaben, seinen Eintritt
in das Jünglingsalter3. Am besten sind wir über diese in ganz
Griechenland verbreitete Sitte für Athen orientiert. Hier fand
die Haarweihe an der κουρεώτις, dem dritten Tag des Apaturien-
1 Ausser diesen zwölf Inschriften kennen wir noch zwei, deren Maasse nicht
genau angegeben werden können : IGIns V 162 und CIG 2038. Bei letzterer
ist sogar der parische Ursprung zweifelhaft.
λ Vgl. Athen. Mitt. 1900, 353 ff. Wenn Cyriacus die Steine als bases eines
grossen shnulacrtt.ni bezeichnet, so sagt das nichts, da er z. B. auch Epi-
stylbalken und dergl. so zu nennen pflegt. Vgl. ebenda S. 352 Anm. Es liegt
näher, die parietis marmoreae partes, die er kurz vor Anführung der Inschriften
noch als aufrecht stehend erwähnt, mit den Weihinschriften in Verbindung
zu bringen.
3 Vgl. insbesondere Deschamps und Cousin BCH 1888, 479 ff.