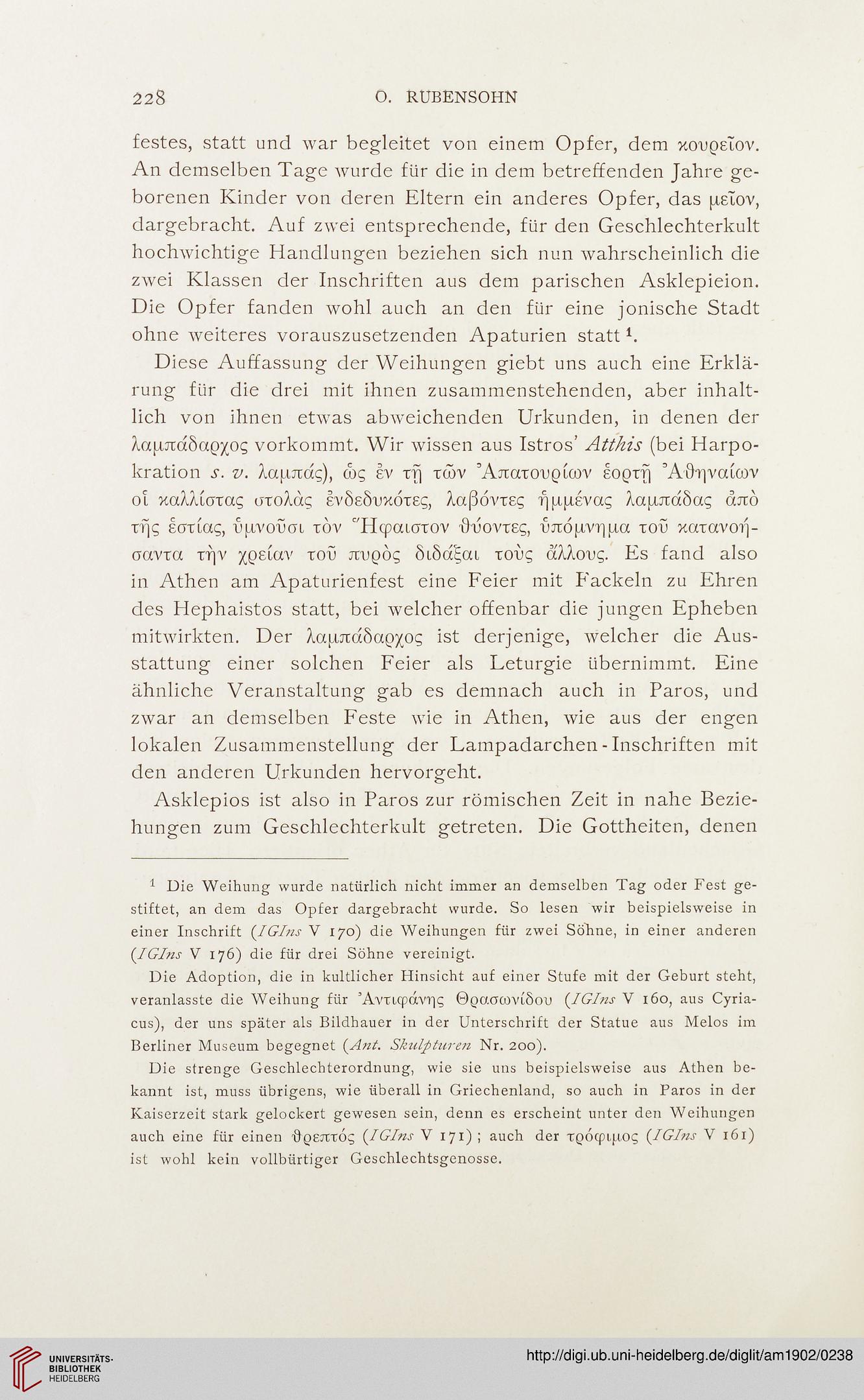228
O. RÜBENSOHN
festes, statt und war begleitet von einem Opfer, dem κουρειον.
An demselben Tage wurde für die in dem betreffenden Jahre ge-
borenen Kinder von deren Eltern ein anderes Opfer, das μεΐον,
dargebracht. Auf zwei entsprechende, für den Geschlechterkult
hochwichtige Handlungen beziehen sich nun wahrscheinlich die
zwei Klassen der Inschriften aus dem parischen Asklepieion.
Die Opfer fanden wohl auch an den für eine jonische Stadt
ohne weiteres vorauszusetzenden Apaturien statt1.
Diese Auffassung der Weihungen giebt uns auch eine Erklä-
rung für die drei mit ihnen zusammenstehenden, aber inhalt-
lich von ihnen etwas abweichenden Urkunden, in denen der
λαμπάδαρχος vorkommt. Wir wissen aus Istros’ Atthis (bei Harpo-
kration 5. v. λαμπάς), ώς εν τή των "Απατουρίων εορτή "Αθηναίων
οι καλλίστας σχολάς ένδεδυκότες, λαβόντες ήμμένας λαμπάδας από
τής εστίας, ϋμνοϋσι τον “Ηφαιστον θϋοντες, υπόμνημα τοϋ κατανοή-
σαντα τήν χρείαν τοϋ πυρός διδάξαι τους άλλους. Es fand also
in Athen am Apaturienfest eine Feier mit Fackeln zu Ehren
des Hephaistos statt, bei welcher offenbar die jungen Epheben
mitwirkten. Der λαμπάδαρχος ist derjenige, welcher die Aus-
stattung einer solchen Feier als Leturgie übernimmt. Eine
ähnliche Veranstaltung gab es demnach auch in Paros, und
zwar an demselben Feste wie in Athen, wie aus der engen
lokalen Zusammenstellung der Lampadarchen - Inschriften mit
den anderen Urkunden hervorgeht.
Asklepios ist also in Paros zur römischen Zeit in nahe Bezie-
hungen zum Geschlechterkult getreten. Die Gottheiten, denen
1 Die Weihung wurde natürlich nicht immer an demselben Tag oder Fest ge-
stiftet, an dem das Opfer dargebracht wurde. So lesen wir beispielsweise in
einer Inschrift (IGIns V 170) die Weihungen für zwei Söhne, in einer anderen
(IGIns V 176) die für drei Söhne vereinigt.
Die Adoption, die in kultlicher Hinsicht auf einer Stufe mit der Geburt steht,
veranlasste die Weihung für Άντιφάνης Θρασωνίδου (IGIns V 160, aus Cyria-
cus), der uns später als Bildhauer in der Unterschrift der Statue aus Melos im
Berliner Museum begegnet (Ant. Skulpturen Nr. 200).
Die strenge Geschlechterordnung, wie sie uns beispielsweise aus Athen be-
kannt ist, muss übrigens, wie überall in Griechenland, so auch in Paros in der
Kaiserzeit stark gelockert gewesen sein, denn es erscheint unter den Weihungen
auch eine für einen Όρεπτός (IGIns V 171) ; auch der τρόφιμος (IGIns V 161)
ist wohl kein vollblütiger Geschlechtsgenosse.
O. RÜBENSOHN
festes, statt und war begleitet von einem Opfer, dem κουρειον.
An demselben Tage wurde für die in dem betreffenden Jahre ge-
borenen Kinder von deren Eltern ein anderes Opfer, das μεΐον,
dargebracht. Auf zwei entsprechende, für den Geschlechterkult
hochwichtige Handlungen beziehen sich nun wahrscheinlich die
zwei Klassen der Inschriften aus dem parischen Asklepieion.
Die Opfer fanden wohl auch an den für eine jonische Stadt
ohne weiteres vorauszusetzenden Apaturien statt1.
Diese Auffassung der Weihungen giebt uns auch eine Erklä-
rung für die drei mit ihnen zusammenstehenden, aber inhalt-
lich von ihnen etwas abweichenden Urkunden, in denen der
λαμπάδαρχος vorkommt. Wir wissen aus Istros’ Atthis (bei Harpo-
kration 5. v. λαμπάς), ώς εν τή των "Απατουρίων εορτή "Αθηναίων
οι καλλίστας σχολάς ένδεδυκότες, λαβόντες ήμμένας λαμπάδας από
τής εστίας, ϋμνοϋσι τον “Ηφαιστον θϋοντες, υπόμνημα τοϋ κατανοή-
σαντα τήν χρείαν τοϋ πυρός διδάξαι τους άλλους. Es fand also
in Athen am Apaturienfest eine Feier mit Fackeln zu Ehren
des Hephaistos statt, bei welcher offenbar die jungen Epheben
mitwirkten. Der λαμπάδαρχος ist derjenige, welcher die Aus-
stattung einer solchen Feier als Leturgie übernimmt. Eine
ähnliche Veranstaltung gab es demnach auch in Paros, und
zwar an demselben Feste wie in Athen, wie aus der engen
lokalen Zusammenstellung der Lampadarchen - Inschriften mit
den anderen Urkunden hervorgeht.
Asklepios ist also in Paros zur römischen Zeit in nahe Bezie-
hungen zum Geschlechterkult getreten. Die Gottheiten, denen
1 Die Weihung wurde natürlich nicht immer an demselben Tag oder Fest ge-
stiftet, an dem das Opfer dargebracht wurde. So lesen wir beispielsweise in
einer Inschrift (IGIns V 170) die Weihungen für zwei Söhne, in einer anderen
(IGIns V 176) die für drei Söhne vereinigt.
Die Adoption, die in kultlicher Hinsicht auf einer Stufe mit der Geburt steht,
veranlasste die Weihung für Άντιφάνης Θρασωνίδου (IGIns V 160, aus Cyria-
cus), der uns später als Bildhauer in der Unterschrift der Statue aus Melos im
Berliner Museum begegnet (Ant. Skulpturen Nr. 200).
Die strenge Geschlechterordnung, wie sie uns beispielsweise aus Athen be-
kannt ist, muss übrigens, wie überall in Griechenland, so auch in Paros in der
Kaiserzeit stark gelockert gewesen sein, denn es erscheint unter den Weihungen
auch eine für einen Όρεπτός (IGIns V 171) ; auch der τρόφιμος (IGIns V 161)
ist wohl kein vollblütiger Geschlechtsgenosse.