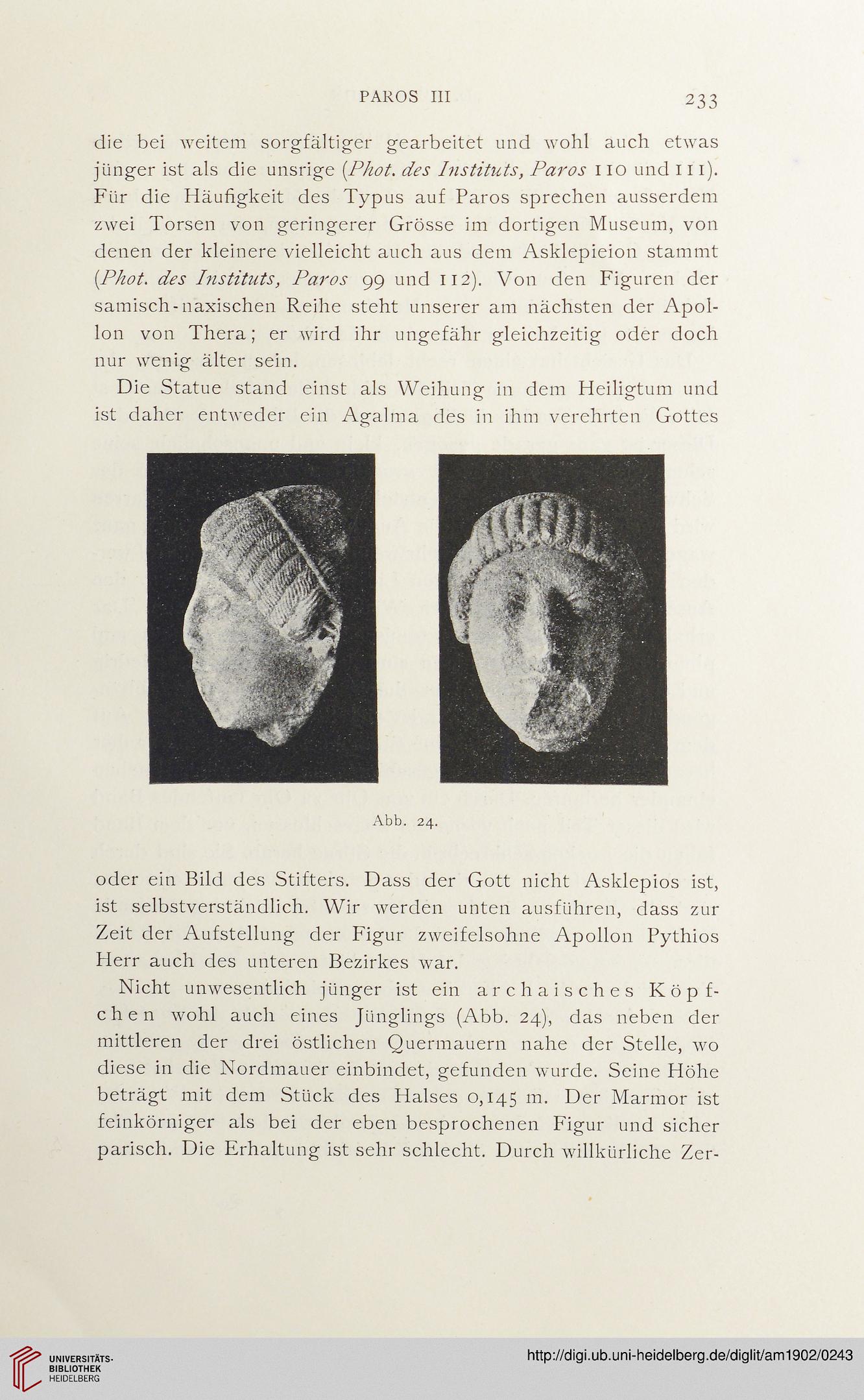PAROS III
233
die bei weitem sorgfältiger gearbeitet und wohl auch etwas
jünger ist als die unsrige [Phot, des Instituts, Paros 110 und 111).
Für die Häufigkeit des Typus auf Paros sprechen ausserdem
zwei Torsen von geringerer Grösse im dortigen Museum, von
denen der kleinere vielleicht auch aus dem Asklepieion stammt
[Phot, des Instituts, Paros 99 und 112). Von den Figuren der
samisch-naxischen Reihe steht unserer am nächsten der Apol-
lon von Thera; er wird ihr ungefähr gleichzeitig oder doch
nur wenig älter sein.
Die Statue stand einst als Weihung in dem Heiligtum und
ist daher entweder ein Agalma des in ihm verehrten Gottes
Abb. 24.
oder ein Bild des Stifters. Dass der Gott nicht Asklepios ist,
ist selbstverständlich. Wir werden unten ausführen, dass zur
Zeit der Aufstellung der Figur zweifelsohne Apollon Pythios
Herr auch des unteren Bezirkes war.
Nicht unwesentlich jünger ist ein archaisches Köpf-
chen wohl auch eines Jünglings (Abb. 24), das neben der
mittleren der drei östlichen Quermauern nahe der Stelle, wo
diese in die Nordmauer einbindet, gefunden wurde. Seine Höhe
beträgt mit dem Stück des Halses 0,145 m. Der Marmor ist
feinkörniger als bei der eben besprochenen Figur und sicher
parisch. Die Erhaltung ist sehr schlecht. Durch willkürliche Zer-
233
die bei weitem sorgfältiger gearbeitet und wohl auch etwas
jünger ist als die unsrige [Phot, des Instituts, Paros 110 und 111).
Für die Häufigkeit des Typus auf Paros sprechen ausserdem
zwei Torsen von geringerer Grösse im dortigen Museum, von
denen der kleinere vielleicht auch aus dem Asklepieion stammt
[Phot, des Instituts, Paros 99 und 112). Von den Figuren der
samisch-naxischen Reihe steht unserer am nächsten der Apol-
lon von Thera; er wird ihr ungefähr gleichzeitig oder doch
nur wenig älter sein.
Die Statue stand einst als Weihung in dem Heiligtum und
ist daher entweder ein Agalma des in ihm verehrten Gottes
Abb. 24.
oder ein Bild des Stifters. Dass der Gott nicht Asklepios ist,
ist selbstverständlich. Wir werden unten ausführen, dass zur
Zeit der Aufstellung der Figur zweifelsohne Apollon Pythios
Herr auch des unteren Bezirkes war.
Nicht unwesentlich jünger ist ein archaisches Köpf-
chen wohl auch eines Jünglings (Abb. 24), das neben der
mittleren der drei östlichen Quermauern nahe der Stelle, wo
diese in die Nordmauer einbindet, gefunden wurde. Seine Höhe
beträgt mit dem Stück des Halses 0,145 m. Der Marmor ist
feinkörniger als bei der eben besprochenen Figur und sicher
parisch. Die Erhaltung ist sehr schlecht. Durch willkürliche Zer-