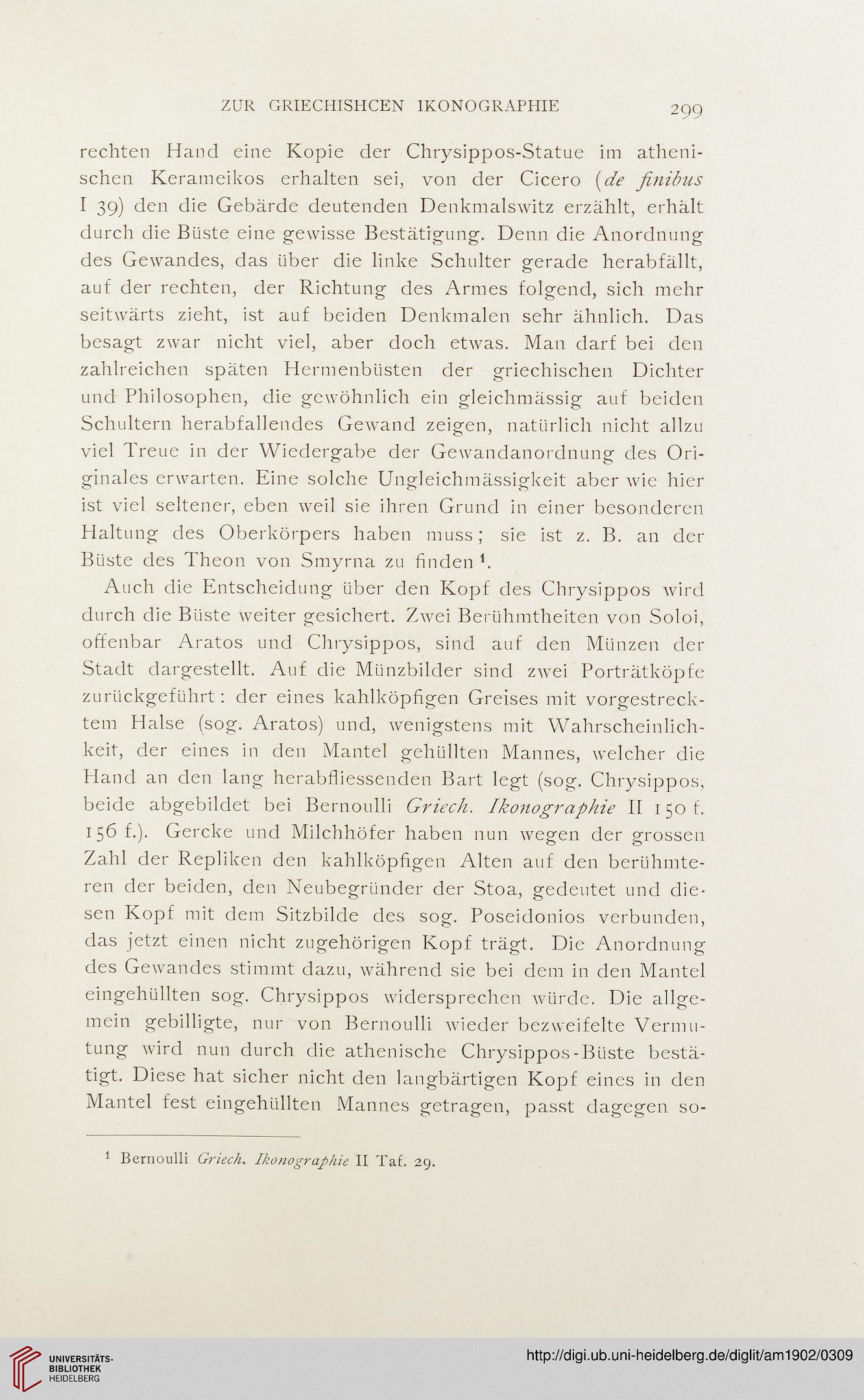ZUR GRIECHISHCEN IKONOGRAPHIE
299
rechten Hand eine Kopie der Chrysippos-Statue im atheni-
schen Kerameikos erhalten sei, von der Cicero (de finibus
I 39) den die Gebärde deutenden Denkmalswitz erzählt, erhält
durch die Büste eine gewisse Bestätigung. Denn die Anordnung
des Gewandes, das über die linke Schulter gerade herabfällt,
auf der rechten, der Richtung des Armes folgend, sich mehr
seitwärts zieht, ist auf beiden Denkmalen sehr ähnlich. Das
besagt zwar nicht viel, aber doch etwas. Man darf bei den
zahlreichen späten Hermenbüsten der griechischen Dichter
und Philosophen, die gewöhnlich ein gleichmässig auf beiden
Schultern herabfallendes Gewand zeigen, natürlich nicht allzu
viel Treue in der Wiedergabe der Gewandanordnung des Ori-
ginales erwarten. Eine solche Ungleichmässigkeit aber wie hier
ist viel seltener, eben weil sie ihren Grund in einer besonderen
Haltung des Oberkörpers haben muss; sie ist z. B. an der
Büste des Theon von Smyrna zu finden h
Auch die Entscheidung über den Kopf des Chrysippos wird
durch die Büste weiter gesichert. Zwei Berühmtheiten von Soloi,
offenbar Aratos und Chrysippos, sind auf den Münzen der
Stadt dargestellt. Auf die Münzbilder sind zwei Porträtköpfe
zurückgeführt: der eines kahlköpfigen Greises mit vorgestreck-
tem Halse (sog. Aratos) und, wenigstens mit Wahrscheinlich-
keit, der eines in den Mantel gehüllten Mannes, welcher die
Hand an den lang herabfliessenden Bart legt (sog. Chrysippos,
beide abgebildet bei Bernoulli Griech. Ikonographie II 150 t.
I56f.). Gercke und Milchhöfer haben nun wegen der grossen
Zahl der Repliken den kahlköpfigen Alten auf den berühmte-
ren der beiden, den Neubegründer der Stoa, gedeutet und die-
sen Kopf mit dem Sitzbilde des sog. Poseidonios verbunden,
das jetzt einen nicht zugehörigen Kopf trägt. Die Anordnung
des Gewandes stimmt dazu, während sie bei dem in den Mantel
eingehüllten sog. Chrysippos widersprechen würde. Die allge-
mein gebilligte, nur von Bernoulli wieder bezweifelte Vermu-
tung wird nun durch die athenische Chrysippos-Büste bestä-
tigt. Diese hat sicher nicht den langbärtigen Kopf eines in den
Mantel fest eingehüllten Mannes getragen, passt dagegen so-
1 Bernoulli Griech. Ikonographie II Taf. 29.
299
rechten Hand eine Kopie der Chrysippos-Statue im atheni-
schen Kerameikos erhalten sei, von der Cicero (de finibus
I 39) den die Gebärde deutenden Denkmalswitz erzählt, erhält
durch die Büste eine gewisse Bestätigung. Denn die Anordnung
des Gewandes, das über die linke Schulter gerade herabfällt,
auf der rechten, der Richtung des Armes folgend, sich mehr
seitwärts zieht, ist auf beiden Denkmalen sehr ähnlich. Das
besagt zwar nicht viel, aber doch etwas. Man darf bei den
zahlreichen späten Hermenbüsten der griechischen Dichter
und Philosophen, die gewöhnlich ein gleichmässig auf beiden
Schultern herabfallendes Gewand zeigen, natürlich nicht allzu
viel Treue in der Wiedergabe der Gewandanordnung des Ori-
ginales erwarten. Eine solche Ungleichmässigkeit aber wie hier
ist viel seltener, eben weil sie ihren Grund in einer besonderen
Haltung des Oberkörpers haben muss; sie ist z. B. an der
Büste des Theon von Smyrna zu finden h
Auch die Entscheidung über den Kopf des Chrysippos wird
durch die Büste weiter gesichert. Zwei Berühmtheiten von Soloi,
offenbar Aratos und Chrysippos, sind auf den Münzen der
Stadt dargestellt. Auf die Münzbilder sind zwei Porträtköpfe
zurückgeführt: der eines kahlköpfigen Greises mit vorgestreck-
tem Halse (sog. Aratos) und, wenigstens mit Wahrscheinlich-
keit, der eines in den Mantel gehüllten Mannes, welcher die
Hand an den lang herabfliessenden Bart legt (sog. Chrysippos,
beide abgebildet bei Bernoulli Griech. Ikonographie II 150 t.
I56f.). Gercke und Milchhöfer haben nun wegen der grossen
Zahl der Repliken den kahlköpfigen Alten auf den berühmte-
ren der beiden, den Neubegründer der Stoa, gedeutet und die-
sen Kopf mit dem Sitzbilde des sog. Poseidonios verbunden,
das jetzt einen nicht zugehörigen Kopf trägt. Die Anordnung
des Gewandes stimmt dazu, während sie bei dem in den Mantel
eingehüllten sog. Chrysippos widersprechen würde. Die allge-
mein gebilligte, nur von Bernoulli wieder bezweifelte Vermu-
tung wird nun durch die athenische Chrysippos-Büste bestä-
tigt. Diese hat sicher nicht den langbärtigen Kopf eines in den
Mantel fest eingehüllten Mannes getragen, passt dagegen so-
1 Bernoulli Griech. Ikonographie II Taf. 29.