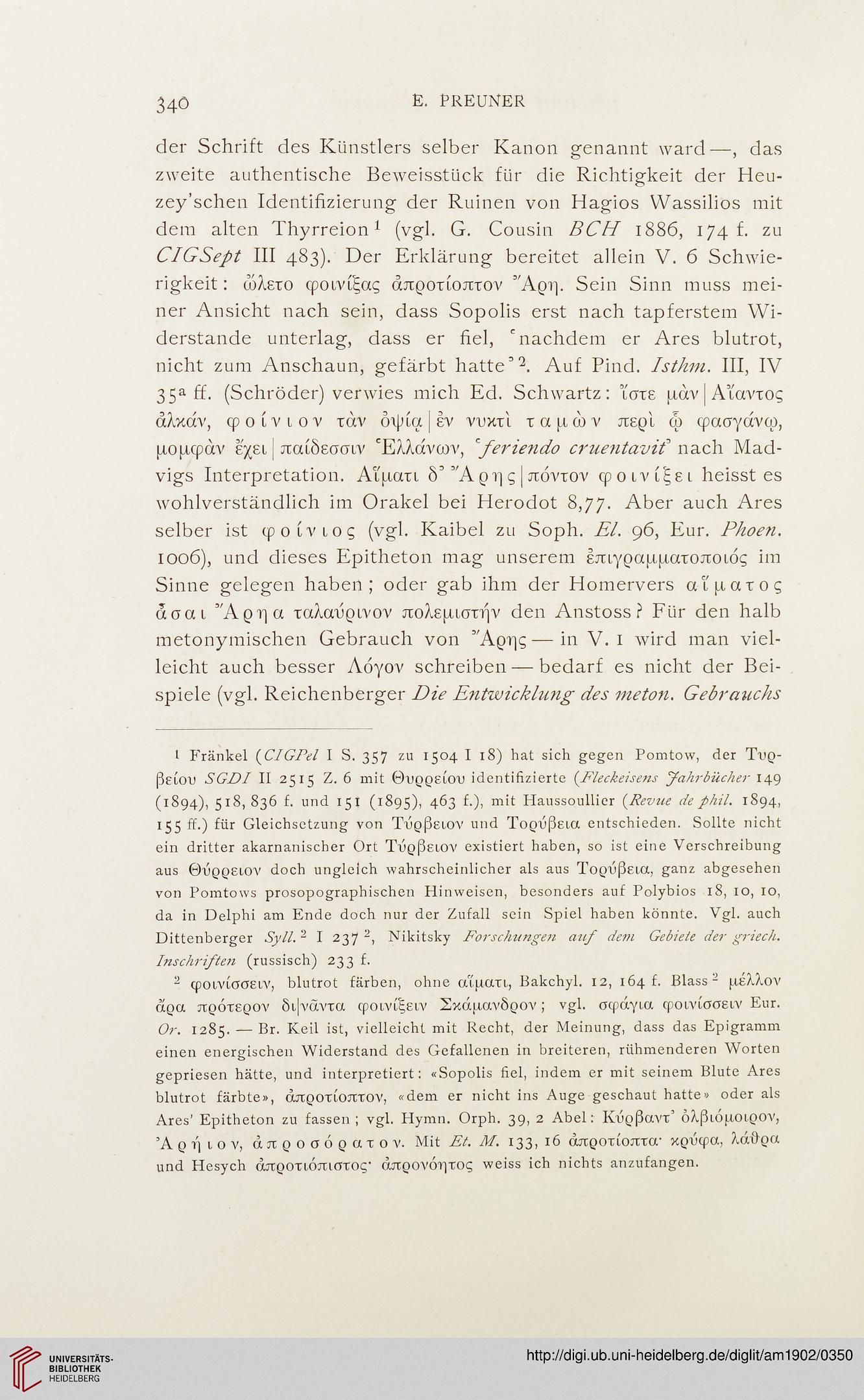340
E. PREUNER
der Schrift des Künstlers selber Kanon genannt ward—, das
zweite authentische Beweisstück für die Richtigkeit der Heu-
zey’schen Identifizierung der Ruinen von Hagios Wassilios mit
dem alten Thyrreion1 (vgl. G. Cousin BCH 1886, 174 f. zu
CIGSept III 483). Der Erklärung bereitet allein V. 6 Schwie-
rigkeit : ώλετο φοινίξας απροτίοπτον Άρη. Sein Sinn muss mei-
ner Ansicht nach sein, dass Sopolis erst nach tapferstem Wi-
derstande unterlag, dass er fiel, 'nachdem er Ares blutrot,
nicht zum Anschaun, gefärbt hatte'2. Auf Find. Isthm. III, IV
35a ff. (Schröder) verwies mich Ed. Schwartz : ϊστε μάν | Αΐαντος
αλκάν, φ ο ί ν ι ο ν τάν όψία | έν νυκτ'ι τ α μ ώ ν περ'ι φ φασγάνω,
μομφάν εχει j παίδεσσιν Έλλάνων, "feriendo cruentavif nach Mad-
vigs Interpretation. Αΐματι δ' Ά ρη ς | πόντον φοινίξει heisst es
wohlverständlich im Orakel bei Herodot 8,77. Aber auch Ares
selber ist φοίνιος (vgl. Kaibel zu Soph. El. 96, Eur. Phoen.
1006), und dieses Epitheton mag unserem επιγραμματοποιός im
Sinne gelegen haben; oder gab ihm der Homervers αίματος
ασαι ’Άρηα ταλαΰρινον πολεμιστήν den Anstoss f Für den halb
metonymischen Gebrauch von Άρης—in V. 1 wird man viel-
leicht auch besser Λόγον schreiben — bedarf es nicht der Bei-
spiele (vgl. Reichenberger Die Entwicklung des meton. Gebrauchs
1 Frankel (CIGPel I S. 357 zu 1504 I 18) hat sich gegen Pomtow, der Τυρ-
βείου SGDI II 2515 Z. 6 mit Θυρρείου identifizierte (.Fleckeisefts Jahrbücher 149
(1894), 518,836 f. und 151 (1895), 4^3 E)i mit Hausspullier (Revtee de phil. 1894,
155 ff.) für Gleichsetzung von Τύρβειον und Τορΰβεια entschieden. Sollte nicht
ein dritter akarnanischer Ort Τύρβειον existiert haben, so ist eine Verschreibung
aus Θύρρειον doch ungleich wahrscheinlicher als aus Τορΰβεια, ganz abgesehen
von Pomtows prosopographischen Hinweisen, besonders auf Polybios 18, 10, 10,
da in Delphi am Ende doch nur der Zufall sein Spiel haben könnte. Vgl. auch
Dittenberger Sylt.'1 I 237 2, Nikitsky Forschungett auf dem Gebiete der griech.
Inschriften (russisch) 233 f.
2 φοινίσσεΐν, blutrot färben, ohne αΐματι, Bakchyl. 12, 164 f. Blass 2 μέλλον
άρα πρότερον δι|νάντα φοινίξειν Σκάμανδρον; vgl. σφάγια φοινίσσειν Eur.
Or. 1285. — Br. Keil ist, vielleicht mit Recht, der Meinung, dass das Epigramm
einen energischen Widerstand des Gefallenen in breiteren, riihmenderen Worten
gepriesen hätte, und interpretiert: «Sopolis fiel, indem er mit seinem Blute Ares
blutrot färbte», απροτίοπτον, «dem er nicht ins Auge geschaut hatte» oder als
Ares’ Epitheton zu fassen; vgl. Hymn. Orph. 39, 2 Abel: Ινύρβαντ’ όλβιόμοιρον,
’A ρ ή ι ο ν, ά π ρ ο σ ό ρ α τ o v. Mit Et. Μ. 133» ι6 άπροτίοπτα· κρυφά, λάθρα
und Hesych άπροτιόπιστος· απρονόητος weiss ich nichts anzufangen.
E. PREUNER
der Schrift des Künstlers selber Kanon genannt ward—, das
zweite authentische Beweisstück für die Richtigkeit der Heu-
zey’schen Identifizierung der Ruinen von Hagios Wassilios mit
dem alten Thyrreion1 (vgl. G. Cousin BCH 1886, 174 f. zu
CIGSept III 483). Der Erklärung bereitet allein V. 6 Schwie-
rigkeit : ώλετο φοινίξας απροτίοπτον Άρη. Sein Sinn muss mei-
ner Ansicht nach sein, dass Sopolis erst nach tapferstem Wi-
derstande unterlag, dass er fiel, 'nachdem er Ares blutrot,
nicht zum Anschaun, gefärbt hatte'2. Auf Find. Isthm. III, IV
35a ff. (Schröder) verwies mich Ed. Schwartz : ϊστε μάν | Αΐαντος
αλκάν, φ ο ί ν ι ο ν τάν όψία | έν νυκτ'ι τ α μ ώ ν περ'ι φ φασγάνω,
μομφάν εχει j παίδεσσιν Έλλάνων, "feriendo cruentavif nach Mad-
vigs Interpretation. Αΐματι δ' Ά ρη ς | πόντον φοινίξει heisst es
wohlverständlich im Orakel bei Herodot 8,77. Aber auch Ares
selber ist φοίνιος (vgl. Kaibel zu Soph. El. 96, Eur. Phoen.
1006), und dieses Epitheton mag unserem επιγραμματοποιός im
Sinne gelegen haben; oder gab ihm der Homervers αίματος
ασαι ’Άρηα ταλαΰρινον πολεμιστήν den Anstoss f Für den halb
metonymischen Gebrauch von Άρης—in V. 1 wird man viel-
leicht auch besser Λόγον schreiben — bedarf es nicht der Bei-
spiele (vgl. Reichenberger Die Entwicklung des meton. Gebrauchs
1 Frankel (CIGPel I S. 357 zu 1504 I 18) hat sich gegen Pomtow, der Τυρ-
βείου SGDI II 2515 Z. 6 mit Θυρρείου identifizierte (.Fleckeisefts Jahrbücher 149
(1894), 518,836 f. und 151 (1895), 4^3 E)i mit Hausspullier (Revtee de phil. 1894,
155 ff.) für Gleichsetzung von Τύρβειον und Τορΰβεια entschieden. Sollte nicht
ein dritter akarnanischer Ort Τύρβειον existiert haben, so ist eine Verschreibung
aus Θύρρειον doch ungleich wahrscheinlicher als aus Τορΰβεια, ganz abgesehen
von Pomtows prosopographischen Hinweisen, besonders auf Polybios 18, 10, 10,
da in Delphi am Ende doch nur der Zufall sein Spiel haben könnte. Vgl. auch
Dittenberger Sylt.'1 I 237 2, Nikitsky Forschungett auf dem Gebiete der griech.
Inschriften (russisch) 233 f.
2 φοινίσσεΐν, blutrot färben, ohne αΐματι, Bakchyl. 12, 164 f. Blass 2 μέλλον
άρα πρότερον δι|νάντα φοινίξειν Σκάμανδρον; vgl. σφάγια φοινίσσειν Eur.
Or. 1285. — Br. Keil ist, vielleicht mit Recht, der Meinung, dass das Epigramm
einen energischen Widerstand des Gefallenen in breiteren, riihmenderen Worten
gepriesen hätte, und interpretiert: «Sopolis fiel, indem er mit seinem Blute Ares
blutrot färbte», απροτίοπτον, «dem er nicht ins Auge geschaut hatte» oder als
Ares’ Epitheton zu fassen; vgl. Hymn. Orph. 39, 2 Abel: Ινύρβαντ’ όλβιόμοιρον,
’A ρ ή ι ο ν, ά π ρ ο σ ό ρ α τ o v. Mit Et. Μ. 133» ι6 άπροτίοπτα· κρυφά, λάθρα
und Hesych άπροτιόπιστος· απρονόητος weiss ich nichts anzufangen.