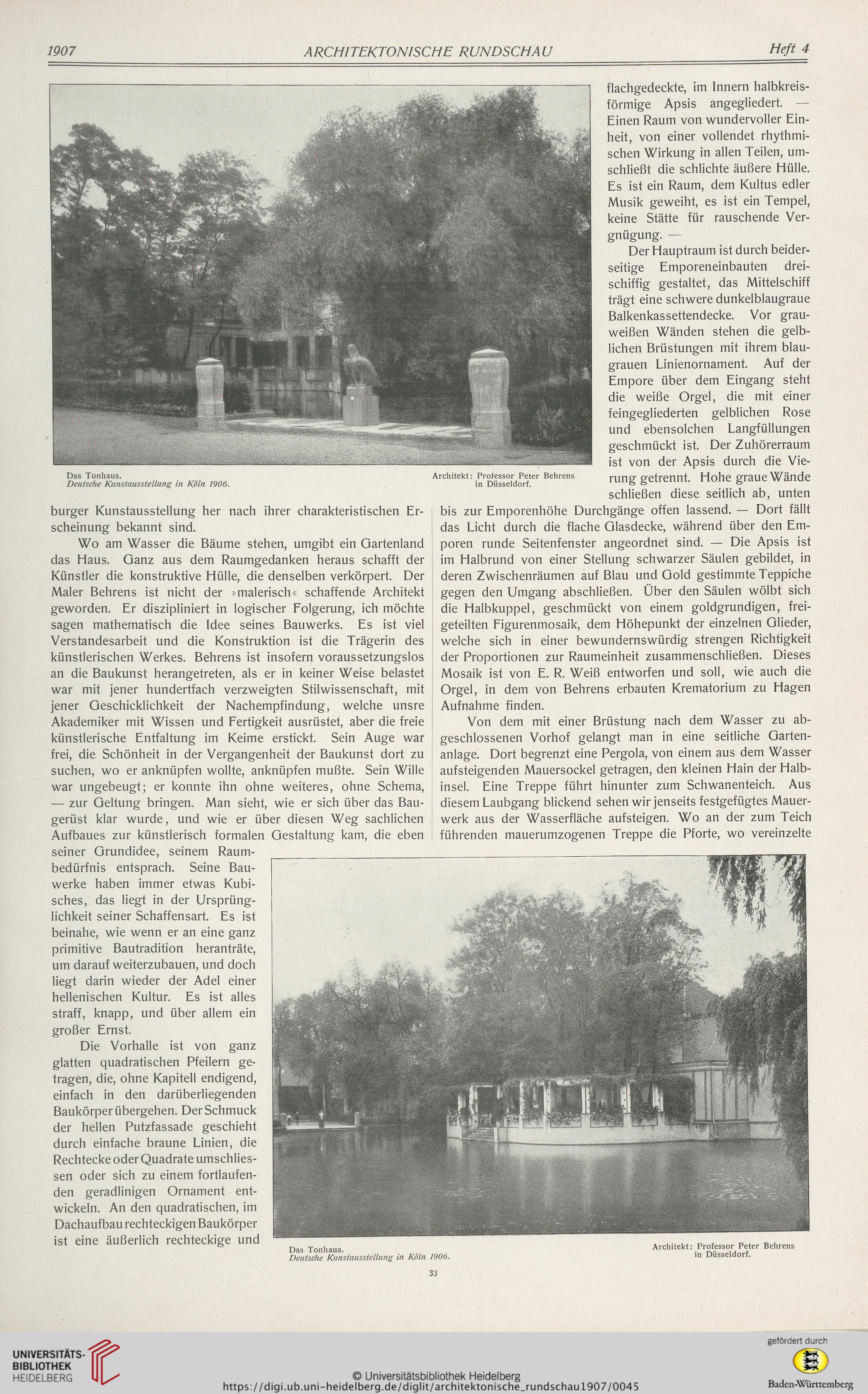1907
ARCHITEKTONISCHE RUNDSCHAU
Heft 4
Das Tonhaus. Architekt: Professor Peter Behrens
Deutsche Kunstausstellung in Köln 1906. in Düsseldorf.
flachgedeckte, im Innern halbkreis-
förmige Apsis angegliedert. —
Einen Raum von wundervoller Ein-
heit, von einer vollendet rhythmi-
schen Wirkung in allen Teilen, um-
schließt die schlichte äußere Hülle.
Es ist ein Raum, dem Kultus edler
Musik geweiht, es ist ein Tempel,
keine Stätte für rauschende Ver-
gnügung. —
Der Hauptraum ist durch beider-
seitige Emporeneinbauten drei-
schiffig gestaltet, das Mittelschiff
trägt eine schwere dunkelblaugraue
Balkenkassettendecke. Vor grau-
weißen Wänden stehen die gelb-
lichen Brüstungen mit ihrem blau-
grauen Linienornament. Auf der
Empore über dem Eingang steht
die weiße Orgel, die mit einer
feingegliederten gelblichen Rose
und ebensolchen Langfüllungen
geschmückt ist. Der Zuhörerraum
ist von der Apsis durch die Vie-
rung getrennt. Hohe graue Wände
schließen diese seitlich ab, unten
burger Kunstausstellung her nach ihrer charakteristischen Er-
scheinung bekannt sind.
Wo am Wasser die Bäume stehen, umgibt ein Gartenland
das Haus. Ganz aus dem Raumgedanken heraus schafft der
Künstler die konstruktive Hülle, die denselben verkörpert. Der
Maler Behrens ist nicht der »malerisch« schaffende Architekt
geworden. Er diszipliniert in logischer Folgerung, ich möchte
sagen mathematisch die Idee seines Bauwerks. Es ist viel
Verstandesarbeit und die Konstruktion ist die Trägerin des
künstlerischen Werkes. Behrens ist insofern voraussetzungslos
an die Baukunst herangetreten, als er in keiner Weise belastet
war mit jener hundertfach verzweigten Stilwissenschaft, mit
jener Geschicklichkeit der Nachempfindung, welche unsre
Akademiker mit Wissen und Fertigkeit ausrüstet, aber die freie
künstlerische Entfaltung im Keime erstickt. Sein Auge war
frei, die Schönheit in der Vergangenheit der Baukunst dort zu
suchen, wo er anknüpfen wollte, anknüpfen mußte. Sein Wille
war ungebeugt; er konnte ihn ohne weiteres, ohne Schema,
— zur Geltung bringen. Man sieht, wie er sich über das Bau-
gerüst klar wurde, und wie er über diesen Weg sachlichen
Aufbaues zur künstlerisch formalen Gestaltung kam, die eben
bis zur Emporenhöhe Durchgänge offen lassend. — Dort fällt
das Licht durch die flache Glasdecke, während über den Em-
poren runde Seitenfenster angeordnet sind. — Die Apsis ist
im Halbrund von einer Stellung schwarzer Säulen gebildet, in
deren Zwischenräumen auf Blau und Gold gestimmte Teppiche
gegen den Umgang abschließen. Über den Säulen wölbt sich
die Halbkuppel, geschmückt von einem goldgrundigen, frei-
geteilten Figurenmosaik, dem Höhepunkt der einzelnen Glieder,
welche sich in einer bewundernswürdig strengen Richtigkeit
der Proportionen zur Raumeinheit zusammenschließen. Dieses
Mosaik ist von E. R. Weiß entworfen und soll, wie auch die
Orgel, in dem von Behrens erbauten Krematorium zu Hagen
Aufnahme finden.
Von dem mit einer Brüstung nach dem Wasser zu ab-
geschlossenen Vorhof gelangt man in eine seitliche Garten-
anlage. Dort begrenzt eine Pergola, von einem aus dem Wasser
aufsteigenden Mauersockel getragen, den kleinen Hain der Halb-
insel. Eine Treppe führt hinunter zum Schwanenteich. Aus
diesem Laubgang blickend sehen wir jenseits festgefügtes Mauer-
werk aus der Wasserfläche aufsteigen. Wo an der zum Teich
führenden mauerumzogenen Treppe die Pforte, wo vereinzelte
seiner Grundidee, seinem Raum-
bedürfnis entsprach. Seine Bau-
werke haben immer etwas Kubi-
sches, das liegt in der Ursprüng-
lichkeit seiner Schaffensart. Es ist
beinahe, wie wenn er an eine ganz
primitive Bautradition heranträte,
um darauf weiterzubauen, und doch
liegt darin wieder der Adel einer
hellenischen Kultur. Es ist alles
straff, knapp, und über allem ein
großer Ernst.
Die Vorhalle ist von ganz
glatten quadratischen Pfeilern ge-
tragen, die, ohne Kapitell endigend,
einfach in den darüberliegenden
Baukörper übergehen. Der Schmuck
der hellen Putzfassade geschieht
durch einfache braune Linien, die
Rechtecke oder Quadrate umschlies-
sen oder sich zu einem fortlaufen-
den geradlinigen Ornament ent-
wickeln. An den quadratischen, im
Dachaufbau rechteckigen Baukörper
ist eine äußerlich rechteckige und
Das Tonhaus. Architekt: Professor Peter Behrens
Deutsche Kunstausstellung in Köln 1906. ’n Düsseldorf.
33
ARCHITEKTONISCHE RUNDSCHAU
Heft 4
Das Tonhaus. Architekt: Professor Peter Behrens
Deutsche Kunstausstellung in Köln 1906. in Düsseldorf.
flachgedeckte, im Innern halbkreis-
förmige Apsis angegliedert. —
Einen Raum von wundervoller Ein-
heit, von einer vollendet rhythmi-
schen Wirkung in allen Teilen, um-
schließt die schlichte äußere Hülle.
Es ist ein Raum, dem Kultus edler
Musik geweiht, es ist ein Tempel,
keine Stätte für rauschende Ver-
gnügung. —
Der Hauptraum ist durch beider-
seitige Emporeneinbauten drei-
schiffig gestaltet, das Mittelschiff
trägt eine schwere dunkelblaugraue
Balkenkassettendecke. Vor grau-
weißen Wänden stehen die gelb-
lichen Brüstungen mit ihrem blau-
grauen Linienornament. Auf der
Empore über dem Eingang steht
die weiße Orgel, die mit einer
feingegliederten gelblichen Rose
und ebensolchen Langfüllungen
geschmückt ist. Der Zuhörerraum
ist von der Apsis durch die Vie-
rung getrennt. Hohe graue Wände
schließen diese seitlich ab, unten
burger Kunstausstellung her nach ihrer charakteristischen Er-
scheinung bekannt sind.
Wo am Wasser die Bäume stehen, umgibt ein Gartenland
das Haus. Ganz aus dem Raumgedanken heraus schafft der
Künstler die konstruktive Hülle, die denselben verkörpert. Der
Maler Behrens ist nicht der »malerisch« schaffende Architekt
geworden. Er diszipliniert in logischer Folgerung, ich möchte
sagen mathematisch die Idee seines Bauwerks. Es ist viel
Verstandesarbeit und die Konstruktion ist die Trägerin des
künstlerischen Werkes. Behrens ist insofern voraussetzungslos
an die Baukunst herangetreten, als er in keiner Weise belastet
war mit jener hundertfach verzweigten Stilwissenschaft, mit
jener Geschicklichkeit der Nachempfindung, welche unsre
Akademiker mit Wissen und Fertigkeit ausrüstet, aber die freie
künstlerische Entfaltung im Keime erstickt. Sein Auge war
frei, die Schönheit in der Vergangenheit der Baukunst dort zu
suchen, wo er anknüpfen wollte, anknüpfen mußte. Sein Wille
war ungebeugt; er konnte ihn ohne weiteres, ohne Schema,
— zur Geltung bringen. Man sieht, wie er sich über das Bau-
gerüst klar wurde, und wie er über diesen Weg sachlichen
Aufbaues zur künstlerisch formalen Gestaltung kam, die eben
bis zur Emporenhöhe Durchgänge offen lassend. — Dort fällt
das Licht durch die flache Glasdecke, während über den Em-
poren runde Seitenfenster angeordnet sind. — Die Apsis ist
im Halbrund von einer Stellung schwarzer Säulen gebildet, in
deren Zwischenräumen auf Blau und Gold gestimmte Teppiche
gegen den Umgang abschließen. Über den Säulen wölbt sich
die Halbkuppel, geschmückt von einem goldgrundigen, frei-
geteilten Figurenmosaik, dem Höhepunkt der einzelnen Glieder,
welche sich in einer bewundernswürdig strengen Richtigkeit
der Proportionen zur Raumeinheit zusammenschließen. Dieses
Mosaik ist von E. R. Weiß entworfen und soll, wie auch die
Orgel, in dem von Behrens erbauten Krematorium zu Hagen
Aufnahme finden.
Von dem mit einer Brüstung nach dem Wasser zu ab-
geschlossenen Vorhof gelangt man in eine seitliche Garten-
anlage. Dort begrenzt eine Pergola, von einem aus dem Wasser
aufsteigenden Mauersockel getragen, den kleinen Hain der Halb-
insel. Eine Treppe führt hinunter zum Schwanenteich. Aus
diesem Laubgang blickend sehen wir jenseits festgefügtes Mauer-
werk aus der Wasserfläche aufsteigen. Wo an der zum Teich
führenden mauerumzogenen Treppe die Pforte, wo vereinzelte
seiner Grundidee, seinem Raum-
bedürfnis entsprach. Seine Bau-
werke haben immer etwas Kubi-
sches, das liegt in der Ursprüng-
lichkeit seiner Schaffensart. Es ist
beinahe, wie wenn er an eine ganz
primitive Bautradition heranträte,
um darauf weiterzubauen, und doch
liegt darin wieder der Adel einer
hellenischen Kultur. Es ist alles
straff, knapp, und über allem ein
großer Ernst.
Die Vorhalle ist von ganz
glatten quadratischen Pfeilern ge-
tragen, die, ohne Kapitell endigend,
einfach in den darüberliegenden
Baukörper übergehen. Der Schmuck
der hellen Putzfassade geschieht
durch einfache braune Linien, die
Rechtecke oder Quadrate umschlies-
sen oder sich zu einem fortlaufen-
den geradlinigen Ornament ent-
wickeln. An den quadratischen, im
Dachaufbau rechteckigen Baukörper
ist eine äußerlich rechteckige und
Das Tonhaus. Architekt: Professor Peter Behrens
Deutsche Kunstausstellung in Köln 1906. ’n Düsseldorf.
33