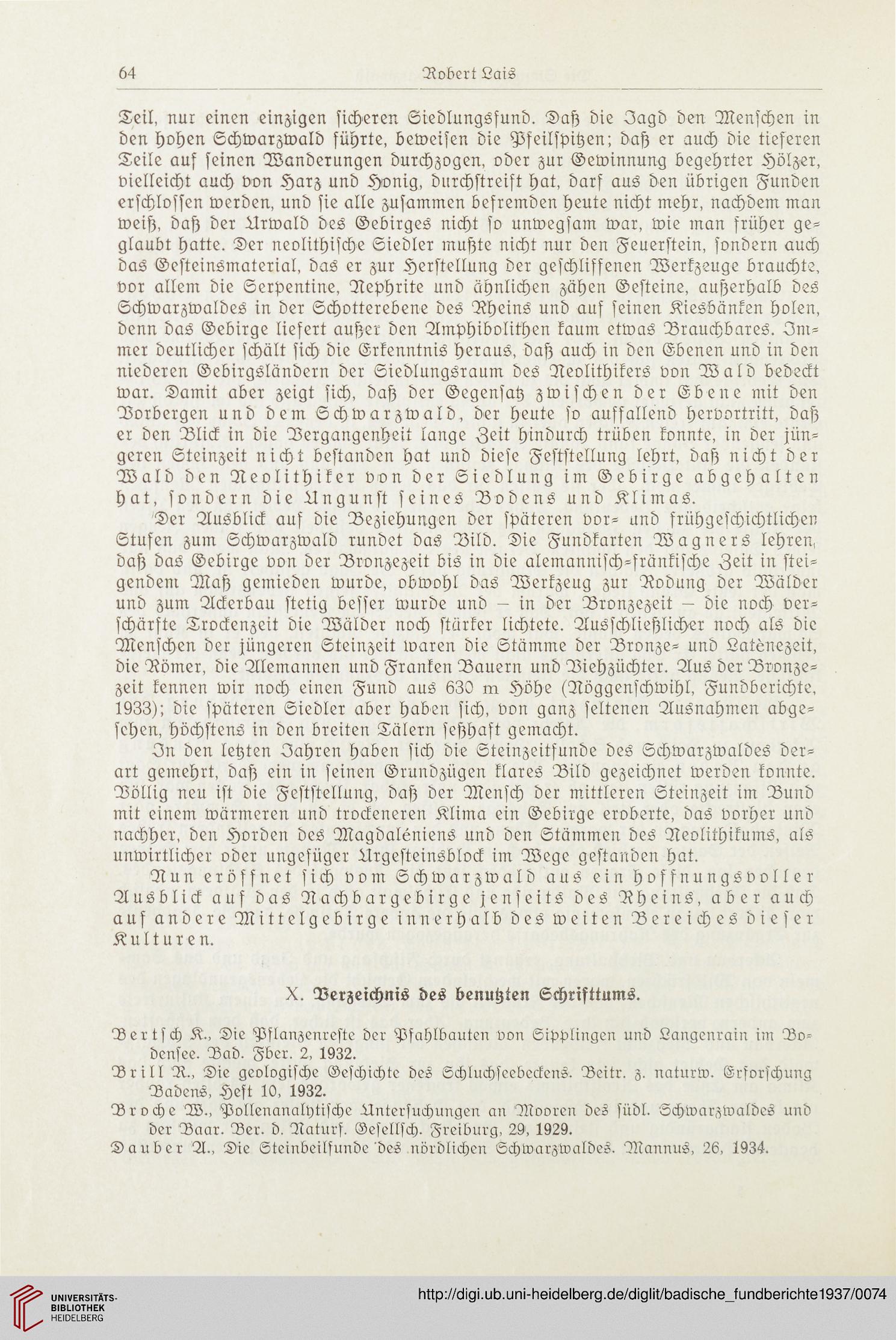64
Robert Lais
Teil, nur einen einzigen sicheren Siedlungsfund. Daß die Jagd den Menschen in
den hohen Schwarzwald führte, beweisen die Pfeilspitzen; daß er auch die tieferen
Teile auf seinen Wanderungen durchzogen, oder zur Gewinnung begehrter Hölzer,
vielleicht auch von Harz und Honig, durchstreift hat, darf aus den übrigen Funden
erschlossen werden, und sie alle zusammen befremden heute nicht mehr, nachdem man
weih, dah der Arwald des Gebirges nicht so unwegsam war, wie man früher ge-
glaubt hatte. Der neolithische Siedler mußte nicht nur den Feuerstein, sondern auch
das Gesteinsmaterial, das er zur Herstellung der geschlissenen Werkzeuge brauchte,
vor allem die Serpentine, Nephrite und ähnlichen zähen Gesteine, außerhalb des
Schwarzwaldes in der Schotterebene des Rheins und aus seinen Kiesbänken holen,
denn das Gebirge liefert außer den Amphibolithen kaum etwas Brauchbares. Im-
mer deutlicher schält sich die Erkenntnis heraus, daß auch in den Ebenen und in den
niederen Gebirgsländern der Siedlungsraum des Reolithikers von Wald bedeckt
war. Damit aber zeigt sich, daß der Gegensatz zwischen der Ebene mit den
Borbergen und dem Schwarzwald, der heute so auffallend hervortritt, daß
er den Blick in die Vergangenheit lange Zeit hindurch trüben konnte, in der jün-
geren Steinzeit nicht bestanden hat und diese Feststellung lehrt, dah nicht der
Wald den Reolithiker von der Siedlung im Gebirge abgehalten
hat, sondern die Angunst seines Bodens und Klimas.
Der Ausblick auf die Beziehungen der späteren vor- und frühgeschichtlichen
Stufen zum Schwarzwald rundet das Bild. Die Fundkarten Wagners lehren,
dah das Gebirge von der Bronzezeit bis in die alemannisch-fränkische Zeit in stei-
gendem Maß gemieden wurde, obwohl das Werkzeug zur Rodung der Wälder
und zum Ackerbau stetig besser wurde und - in der Bronzezeit - die noch ver-
schärfte Trockenzeit die Wälder noch stärker lichtete. Ausschließlicher noch als die
Menschen der jüngeren Steinzeit waren die Stämme der Bronze- und Latenezeit,
die Römer, die Alemannen und Franken Bauern und Viehzüchter. Nus der Bronze-
zeit kennen wir noch einen Fund aus 633 ra Höhe (Nöggenschwihl, Fundberichte,
1933); die späteren Siedler aber haben sich, von ganz seltenen Ausnahmen abge-
sehen, höchstens in den breiten Tälern seßhaft gemacht.
In den letzten Iahren haben sich die Steinzeitfunde des Schwarzwaldes der-
art gemehrt, dah ein in seinen Grundzügen klares Bild gezeichnet werden konnte.
Völlig neu ist die Feststellung, daß der Mensch der mittleren Steinzeit im Bund
mit einem wärmeren und trockeneren Klima ein Gebirge eroberte, das vorher und
nachher, den Horden des Magdaleniens und den Stämmen des Neolithikums, als
unwirtlicher oder ungefüger Argesteinsblock im Wege gestanden hat.
Nun eröffnet sich vom Schwarzwald aus ein hoffnungsvoller
Ausblick auf das Nachbargebirge jenseits des Rheins, aber auch
auf andere Mittelgebirge innerhalb des weiten Bereiches dieser
Kulturen.
X. Verzeichnis des benutzten Schrifttums.
Bertsch K., Die Pflanzenreste der Pfahlbauten von Sipplingen und Langenrain im Bo-
densee. Bad. Fber. 2, 1932.
Brill R., Die geologische Geschichte des Schluchseebeckens. Beitr. z. naturw. Erforschung
Badens, Heft 10, 1932.
Broche W„ Pollenanalytische Ltntersuchungen an Mooren des südl. Schwarzwaldcs und
der Baar. Ber. d. Naturf. Gesellsch. Freiburg, 29, 1929.
Dauber 2l., Die Steinbeilsunde des nördlichen Schwarzwaldes. Mannus, 26, 1934.
Robert Lais
Teil, nur einen einzigen sicheren Siedlungsfund. Daß die Jagd den Menschen in
den hohen Schwarzwald führte, beweisen die Pfeilspitzen; daß er auch die tieferen
Teile auf seinen Wanderungen durchzogen, oder zur Gewinnung begehrter Hölzer,
vielleicht auch von Harz und Honig, durchstreift hat, darf aus den übrigen Funden
erschlossen werden, und sie alle zusammen befremden heute nicht mehr, nachdem man
weih, dah der Arwald des Gebirges nicht so unwegsam war, wie man früher ge-
glaubt hatte. Der neolithische Siedler mußte nicht nur den Feuerstein, sondern auch
das Gesteinsmaterial, das er zur Herstellung der geschlissenen Werkzeuge brauchte,
vor allem die Serpentine, Nephrite und ähnlichen zähen Gesteine, außerhalb des
Schwarzwaldes in der Schotterebene des Rheins und aus seinen Kiesbänken holen,
denn das Gebirge liefert außer den Amphibolithen kaum etwas Brauchbares. Im-
mer deutlicher schält sich die Erkenntnis heraus, daß auch in den Ebenen und in den
niederen Gebirgsländern der Siedlungsraum des Reolithikers von Wald bedeckt
war. Damit aber zeigt sich, daß der Gegensatz zwischen der Ebene mit den
Borbergen und dem Schwarzwald, der heute so auffallend hervortritt, daß
er den Blick in die Vergangenheit lange Zeit hindurch trüben konnte, in der jün-
geren Steinzeit nicht bestanden hat und diese Feststellung lehrt, dah nicht der
Wald den Reolithiker von der Siedlung im Gebirge abgehalten
hat, sondern die Angunst seines Bodens und Klimas.
Der Ausblick auf die Beziehungen der späteren vor- und frühgeschichtlichen
Stufen zum Schwarzwald rundet das Bild. Die Fundkarten Wagners lehren,
dah das Gebirge von der Bronzezeit bis in die alemannisch-fränkische Zeit in stei-
gendem Maß gemieden wurde, obwohl das Werkzeug zur Rodung der Wälder
und zum Ackerbau stetig besser wurde und - in der Bronzezeit - die noch ver-
schärfte Trockenzeit die Wälder noch stärker lichtete. Ausschließlicher noch als die
Menschen der jüngeren Steinzeit waren die Stämme der Bronze- und Latenezeit,
die Römer, die Alemannen und Franken Bauern und Viehzüchter. Nus der Bronze-
zeit kennen wir noch einen Fund aus 633 ra Höhe (Nöggenschwihl, Fundberichte,
1933); die späteren Siedler aber haben sich, von ganz seltenen Ausnahmen abge-
sehen, höchstens in den breiten Tälern seßhaft gemacht.
In den letzten Iahren haben sich die Steinzeitfunde des Schwarzwaldes der-
art gemehrt, dah ein in seinen Grundzügen klares Bild gezeichnet werden konnte.
Völlig neu ist die Feststellung, daß der Mensch der mittleren Steinzeit im Bund
mit einem wärmeren und trockeneren Klima ein Gebirge eroberte, das vorher und
nachher, den Horden des Magdaleniens und den Stämmen des Neolithikums, als
unwirtlicher oder ungefüger Argesteinsblock im Wege gestanden hat.
Nun eröffnet sich vom Schwarzwald aus ein hoffnungsvoller
Ausblick auf das Nachbargebirge jenseits des Rheins, aber auch
auf andere Mittelgebirge innerhalb des weiten Bereiches dieser
Kulturen.
X. Verzeichnis des benutzten Schrifttums.
Bertsch K., Die Pflanzenreste der Pfahlbauten von Sipplingen und Langenrain im Bo-
densee. Bad. Fber. 2, 1932.
Brill R., Die geologische Geschichte des Schluchseebeckens. Beitr. z. naturw. Erforschung
Badens, Heft 10, 1932.
Broche W„ Pollenanalytische Ltntersuchungen an Mooren des südl. Schwarzwaldcs und
der Baar. Ber. d. Naturf. Gesellsch. Freiburg, 29, 1929.
Dauber 2l., Die Steinbeilsunde des nördlichen Schwarzwaldes. Mannus, 26, 1934.