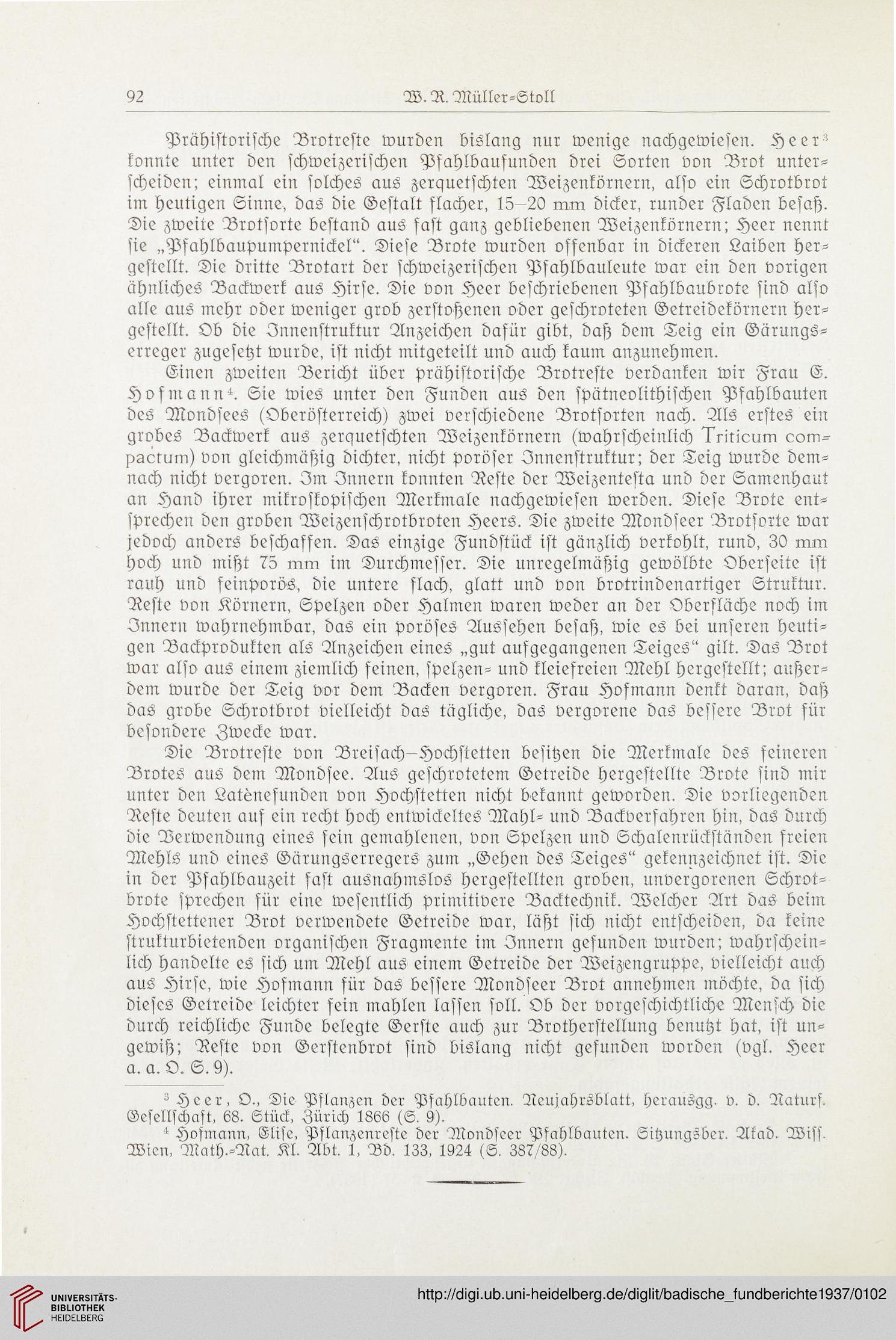92
W.R. Müller-Stoll
Prähistorische Brotreste wurden bislang nur wenige nachgewiesen. Heer^
konnte unter den schweizerischen Psahlbausunden drei Sorten von Brot unter-
scheiden; einmal ein solches aus zerquetschten Weizenkörnern, also ein Schrotbrot
im heutigen Sinne, das die Gestalt slacher, 15-2O mm dicker, runder Fladen besah.
Die zweite Brotsorte bestand aus säst ganz gebliebenen Weizenkörnern; Heer nennt
sie „Pfahlbaupumpernickel". Diese Brote wurden offenbar in dickeren Laiben her-
gestellt. Die dritte Brotart der schweizerischen Pfahlbauleute war ein den vorigen
ähnliches Backwerk aus Hirse. Die von Heer beschriebenen Pfahlbaubrote sind also
alle aus mehr oder weniger grob zerstoßenen oder geschroteten Getreidekörnern her-
gestellt. Ob die Innenstruktur Anzeichen dafür gibt, daß dem Teig ein Gärungs-
erreger zugesetzt wurde, ist nicht mitgeteilt und auch kaum anzunehmen.
Einen zweiten Bericht über prähistorische Brotreste verdanken wir Frau E.
Hofmann ü Sie wies unter den Funden aus den spätneolithischen Pfahlbauten
des Mondsees (Oberösterreich) zwei verschiedene Brotsorten nach. Als erstes ein
grobes Backwerk aus zerquetschten Weizenkörnern (wahrscheinlich Prüicum aom-
paetum) von gleichmäßig dichter, nicht poröser Innenstruktur; der Teig wurde dem-
nach nicht vergoren. Im Innern konnten Reste der Weizentesta und der Samenhaut
an Hand ihrer mikroskopischen Merkmale nachgewiesen werden. Diese Brote ent-
sprechen den groben Weizenschrotbroten Heers. Die zweite Mondseer Brotsorte war
jedoch anders beschaffen. Das einzige Fundstück ist gänzlich verkohlt, rund, 30 nnm
hoch und mißt 75 mm im Durchmesser. Die unregelmäßig gewölbte Oberseite ist
rauh und seinporös, die untere flach, glatt und von brotrindenartiger Struktur.
Reste von Körnern, Spelzen oder Halmen waren weder an der Oberfläche noch im
Innern wahrnehmbar, das ein poröses Aussehen besaß, wie es bei unseren heuti-
gen Backprodukten als Anzeichen eines „gut aufgegangenen Teiges" gilt. Das Brot
war also aus einem ziemlich feinen, fpelzen- und kleiefreien Mehl hergestellt; außer-
dem wurde der Teig vor dem Backen vergoren. Frau Hofmann denkt daran, daß
das grobe Schrotbrot vielleicht das tägliche, das vergorene das bessere Brot für
besondere Zwecke war.
Die Brotreste von Breisach-Hochstetten besitzen die Merkmale des feineren
Brotes aus dem Mondsee. Aus geschrotetem Getreide hergestellte Brote sind mir
unter den Latenefunden von Hochstetten nicht bekannt geworden. Die vorliegenden
Reste deuten auf ein recht hoch entwickeltes Mahl- und Backverfahren hin, das durch
die Verwendung eines fein gemahlenen, von Spelzen und Schalenrückständen freien
Mehls und eines Gärungserregers zum „Gehen des Teiges" gekennzeichnet ist. Die
in der Psahlbauzeit fast ausnahmslos hergestellten groben, unvergorenen Schrot-
brote sprechen für eine wesentlich primitivere Backtechnik. Welcher Art das beim
Hochstettener Brot verwendete Getreide war, läßt sich nicht entscheiden, da keine
strukturbietenden organischen Fragmente im Innern gefunden wurden; wahrschein-
lich handelte es sich um Mehl aus einem Getreide der Weizengruppe, vielleicht auch
aus Hirse, wie Hofmann für das bessere Mondseer Brot annehmen möchte, da sich
dieses Getreide leichter fein mahlen lassen soll. Ob der vorgeschichtliche Mensch die
durch reichliche Funde belegte Gerste auch zur Brotherstellung benutzt hat, ist un-
gewiß; Reste von Gerstenbrot sind bislang nicht gefunden worden (vgl. Heer
a. a. O. S. 9).
3 Heer, O., Die Pflanzen der Pfahlbauten. Aeujahrsblatt, herausgg. v. d. Naturf.
Gesellschaft, 68. Stück, Zürich 1866 (S. 9).
Hofmann, Elise, Pflanzenreste der Mondseer Pfahlbauten. Sitzungober. Akad. Miss.
Wien, Math.-Rat. Kl. Abt. 1, Bd. 133, 1924 (S. 387/88).
W.R. Müller-Stoll
Prähistorische Brotreste wurden bislang nur wenige nachgewiesen. Heer^
konnte unter den schweizerischen Psahlbausunden drei Sorten von Brot unter-
scheiden; einmal ein solches aus zerquetschten Weizenkörnern, also ein Schrotbrot
im heutigen Sinne, das die Gestalt slacher, 15-2O mm dicker, runder Fladen besah.
Die zweite Brotsorte bestand aus säst ganz gebliebenen Weizenkörnern; Heer nennt
sie „Pfahlbaupumpernickel". Diese Brote wurden offenbar in dickeren Laiben her-
gestellt. Die dritte Brotart der schweizerischen Pfahlbauleute war ein den vorigen
ähnliches Backwerk aus Hirse. Die von Heer beschriebenen Pfahlbaubrote sind also
alle aus mehr oder weniger grob zerstoßenen oder geschroteten Getreidekörnern her-
gestellt. Ob die Innenstruktur Anzeichen dafür gibt, daß dem Teig ein Gärungs-
erreger zugesetzt wurde, ist nicht mitgeteilt und auch kaum anzunehmen.
Einen zweiten Bericht über prähistorische Brotreste verdanken wir Frau E.
Hofmann ü Sie wies unter den Funden aus den spätneolithischen Pfahlbauten
des Mondsees (Oberösterreich) zwei verschiedene Brotsorten nach. Als erstes ein
grobes Backwerk aus zerquetschten Weizenkörnern (wahrscheinlich Prüicum aom-
paetum) von gleichmäßig dichter, nicht poröser Innenstruktur; der Teig wurde dem-
nach nicht vergoren. Im Innern konnten Reste der Weizentesta und der Samenhaut
an Hand ihrer mikroskopischen Merkmale nachgewiesen werden. Diese Brote ent-
sprechen den groben Weizenschrotbroten Heers. Die zweite Mondseer Brotsorte war
jedoch anders beschaffen. Das einzige Fundstück ist gänzlich verkohlt, rund, 30 nnm
hoch und mißt 75 mm im Durchmesser. Die unregelmäßig gewölbte Oberseite ist
rauh und seinporös, die untere flach, glatt und von brotrindenartiger Struktur.
Reste von Körnern, Spelzen oder Halmen waren weder an der Oberfläche noch im
Innern wahrnehmbar, das ein poröses Aussehen besaß, wie es bei unseren heuti-
gen Backprodukten als Anzeichen eines „gut aufgegangenen Teiges" gilt. Das Brot
war also aus einem ziemlich feinen, fpelzen- und kleiefreien Mehl hergestellt; außer-
dem wurde der Teig vor dem Backen vergoren. Frau Hofmann denkt daran, daß
das grobe Schrotbrot vielleicht das tägliche, das vergorene das bessere Brot für
besondere Zwecke war.
Die Brotreste von Breisach-Hochstetten besitzen die Merkmale des feineren
Brotes aus dem Mondsee. Aus geschrotetem Getreide hergestellte Brote sind mir
unter den Latenefunden von Hochstetten nicht bekannt geworden. Die vorliegenden
Reste deuten auf ein recht hoch entwickeltes Mahl- und Backverfahren hin, das durch
die Verwendung eines fein gemahlenen, von Spelzen und Schalenrückständen freien
Mehls und eines Gärungserregers zum „Gehen des Teiges" gekennzeichnet ist. Die
in der Psahlbauzeit fast ausnahmslos hergestellten groben, unvergorenen Schrot-
brote sprechen für eine wesentlich primitivere Backtechnik. Welcher Art das beim
Hochstettener Brot verwendete Getreide war, läßt sich nicht entscheiden, da keine
strukturbietenden organischen Fragmente im Innern gefunden wurden; wahrschein-
lich handelte es sich um Mehl aus einem Getreide der Weizengruppe, vielleicht auch
aus Hirse, wie Hofmann für das bessere Mondseer Brot annehmen möchte, da sich
dieses Getreide leichter fein mahlen lassen soll. Ob der vorgeschichtliche Mensch die
durch reichliche Funde belegte Gerste auch zur Brotherstellung benutzt hat, ist un-
gewiß; Reste von Gerstenbrot sind bislang nicht gefunden worden (vgl. Heer
a. a. O. S. 9).
3 Heer, O., Die Pflanzen der Pfahlbauten. Aeujahrsblatt, herausgg. v. d. Naturf.
Gesellschaft, 68. Stück, Zürich 1866 (S. 9).
Hofmann, Elise, Pflanzenreste der Mondseer Pfahlbauten. Sitzungober. Akad. Miss.
Wien, Math.-Rat. Kl. Abt. 1, Bd. 133, 1924 (S. 387/88).