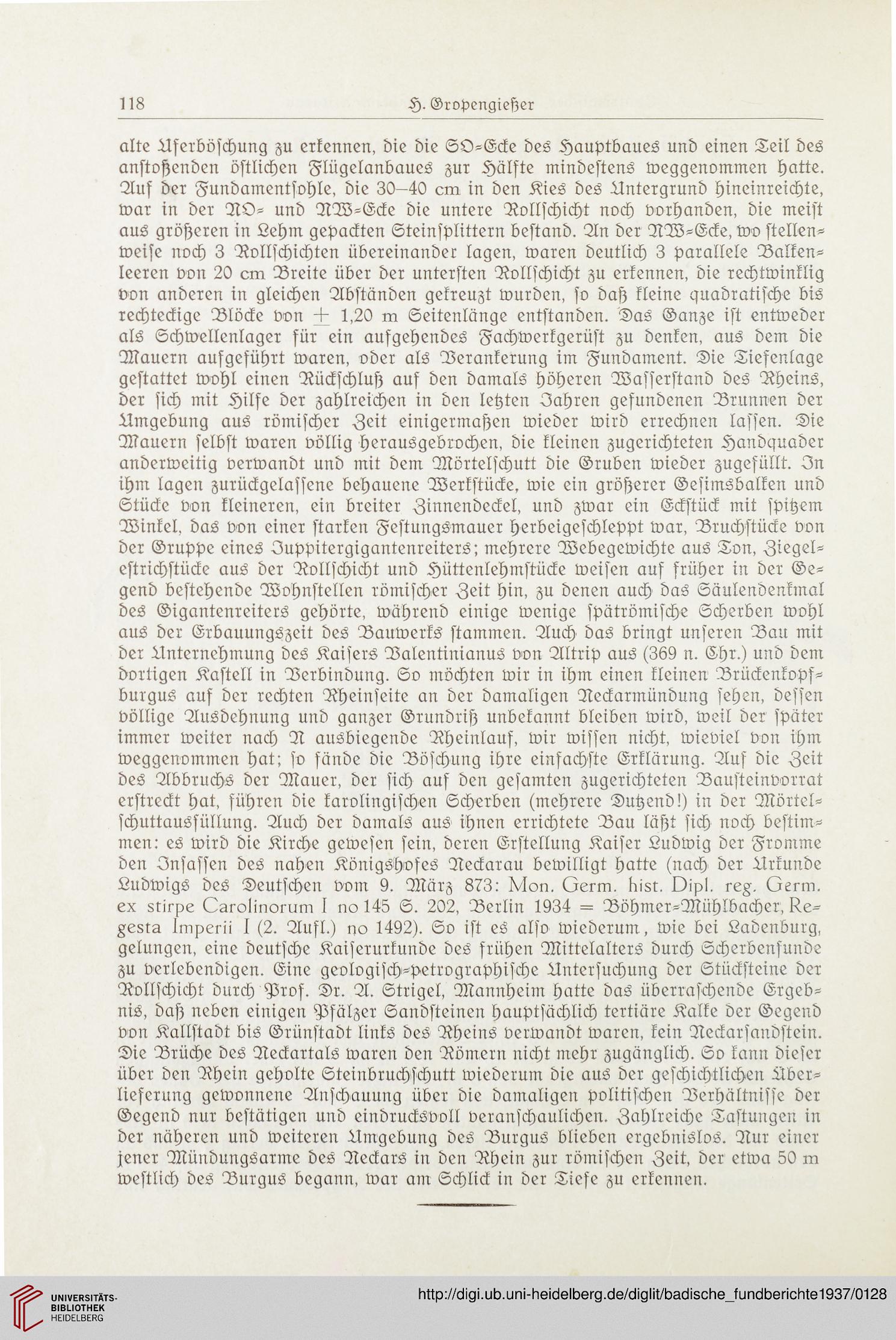118
H. Gropengießer
alte Uferböschung zu erkennen, die die SO-Ecke des Hauptbaues und einen Teil des
anstoßenden östlichen Flügelanbaues zur Hälfte mindestens weggenommen hatte.
Auf der Fundamentsohle, die 30-40 coa in den Kies des Antergrund hineinreichte,
war in der AO- und NW-Ecke die untere Rollschicht noch vorhanden, die meist
aus größeren in Lehm gepackten Steinsplittern bestand. An der AW-Ecke, wo stellen-
weise noch 3 Rollschichten übereinander lagen, waren deutlich 3 parallele Balken-
leeren von 20 em Breite über der untersten Rollschicht zu erkennen, die rechtwinklig
von anderen in gleichen Abständen gekreuzt wurden, so daß kleine quadratische bis
rechteckige Blöcke von 7P 1,20 in Seitenlänge entstanden. Das Ganze ist entweder
als Schwellenlager für ein aufgehendes Fachwerkgerüst zu denken, aus dem die
Mauern aufgeführt waren, oder als Verankerung im Fundament. Die Tiefenlage
gestattet wohl einen Rückschluß auf den damals höheren Wasserstand des Rheins,
der sich mit Hilfe der zahlreichen in den letzten Iahren gefundenen Brunnen der
Umgebung aus römischer Zeit einigermaßen wieder wird errechnen lassen. Die
Mauern selbst waren völlig herausgebrochen, die kleinen zugerichteten Handquader
anderweitig verwandt und mit dem Mörtelschutt die Gruben wieder zugefüllt. Zn
ihm lagen zurückgelassene behauene Werkstücke, wie ein größerer Gesimsbalken und
Stücke von kleineren, ein breiter Zinnendeckel, und zwar ein Eckstück mit spitzem
Winkel, das von einer starken Festungsmauer herbeigeschleppt war, Bruchstücke von
der Gruppe eines Iuppitergigantenreiters; mehrere Webegewichte aus Ton, Ziegel-
estrichstücke aus der Rollschicht und Hüttenlehmstücke weisen auf früher in der Ge-
gend bestehende Wohnstellen römischer Zeit hin, zu denen auch das Säulendenkmal
des Gigantenreiters gehörte, während einige wenige spätrömische Scherben Wohl
aus der Erbauungszeit des Bauwerks stammen. Auch das bringt unseren Bau mit
der Unternehmung des Kaisers Valentinianus von Altrip aus (369 n. Ehr.) und dem
dortigen Kastell in Verbindung. So möchten wir in ihm einen kleinen Brückenkopf-
burgus auf der rechten Rheinseite an der damaligen Aeckarmündung sehen, dessen
völlige Ausdehnung und ganzer Grundriß unbekannt bleiben wird, weil der später
immer weiter nach N ausbiegende Rheinlauf, wir wissen nicht, wieviel von ihm
weggenommen hat; so fände die Böschung ihre einfachste Erklärung. Auf die Zeit
des Abbruchs der Mauer, der sich auf den gesamten zugerichteten Bausteinvorrat
erstreckt hat, führen die karolingischen Scherben (mehrere Dutzend!) in der Mörtel-
schuttaussüllung. Auch der damals aus ihnen errichtete Bau läßt sich noch bestim-
men: es wird die Kirche gewesen sein, deren Erstellung Kaiser Ludwig der Fromme
den Insassen des nahen Königshofes Neckarau bewilligt hatte (nach der Rrkunde
Ludwigs des Deutschen vom 9. März 873: tvlon. Oerm. bist. Dipl. re§. Oerm.
ex 8tirpe Larolinoinim I no 145 S. 202, Berlin 1934 -- Böhmer-Mühlbacher, ke-
§e8ta Imperii I (2. Aufl.) no 1492). So ist es also wiederum, wie bei Ladenburg,
gelungen, eine deutsche Kaiserurkunde des frühen Mittelalters durch Scherbenfunde
zu verlebendigen. Eine geologisch-petrographische Antersuchung der Stücksteine der
Rollschicht durch Prof. Dr. A. Strigel, Mannheim hatte das überraschende Ergeb-
nis, daß neben einigen Pfälzer Sandsteinen hauptsächlich tertiäre Kalke der Gegend
von Kallstadt bis Grünstadt links des Rheins verwandt waren, kein Neckarsandstein.
Die Brüche des Neckartals waren den Römern nicht mehr zugänglich. So kann dieser
über den Rhein geholte Steinbruchschutt wiederum die aus der geschichtlichen Äber-
lieferung gewonnene Anschauung über die damaligen politischen Verhältnisse der
Gegend nur bestätigen und eindrucksvoll veranschaulichen. Zahlreiche Tastungen in
der näheren und weiteren Umgebung des Burgus blieben ergebnislos. Nur einer
jener Mündungsarme des Neckars in den Rhein zur römischen Zeit, der etwa 50 in
westlich des Burgus begann, war am Schlick in der Tiefe zu erkennen.
H. Gropengießer
alte Uferböschung zu erkennen, die die SO-Ecke des Hauptbaues und einen Teil des
anstoßenden östlichen Flügelanbaues zur Hälfte mindestens weggenommen hatte.
Auf der Fundamentsohle, die 30-40 coa in den Kies des Antergrund hineinreichte,
war in der AO- und NW-Ecke die untere Rollschicht noch vorhanden, die meist
aus größeren in Lehm gepackten Steinsplittern bestand. An der AW-Ecke, wo stellen-
weise noch 3 Rollschichten übereinander lagen, waren deutlich 3 parallele Balken-
leeren von 20 em Breite über der untersten Rollschicht zu erkennen, die rechtwinklig
von anderen in gleichen Abständen gekreuzt wurden, so daß kleine quadratische bis
rechteckige Blöcke von 7P 1,20 in Seitenlänge entstanden. Das Ganze ist entweder
als Schwellenlager für ein aufgehendes Fachwerkgerüst zu denken, aus dem die
Mauern aufgeführt waren, oder als Verankerung im Fundament. Die Tiefenlage
gestattet wohl einen Rückschluß auf den damals höheren Wasserstand des Rheins,
der sich mit Hilfe der zahlreichen in den letzten Iahren gefundenen Brunnen der
Umgebung aus römischer Zeit einigermaßen wieder wird errechnen lassen. Die
Mauern selbst waren völlig herausgebrochen, die kleinen zugerichteten Handquader
anderweitig verwandt und mit dem Mörtelschutt die Gruben wieder zugefüllt. Zn
ihm lagen zurückgelassene behauene Werkstücke, wie ein größerer Gesimsbalken und
Stücke von kleineren, ein breiter Zinnendeckel, und zwar ein Eckstück mit spitzem
Winkel, das von einer starken Festungsmauer herbeigeschleppt war, Bruchstücke von
der Gruppe eines Iuppitergigantenreiters; mehrere Webegewichte aus Ton, Ziegel-
estrichstücke aus der Rollschicht und Hüttenlehmstücke weisen auf früher in der Ge-
gend bestehende Wohnstellen römischer Zeit hin, zu denen auch das Säulendenkmal
des Gigantenreiters gehörte, während einige wenige spätrömische Scherben Wohl
aus der Erbauungszeit des Bauwerks stammen. Auch das bringt unseren Bau mit
der Unternehmung des Kaisers Valentinianus von Altrip aus (369 n. Ehr.) und dem
dortigen Kastell in Verbindung. So möchten wir in ihm einen kleinen Brückenkopf-
burgus auf der rechten Rheinseite an der damaligen Aeckarmündung sehen, dessen
völlige Ausdehnung und ganzer Grundriß unbekannt bleiben wird, weil der später
immer weiter nach N ausbiegende Rheinlauf, wir wissen nicht, wieviel von ihm
weggenommen hat; so fände die Böschung ihre einfachste Erklärung. Auf die Zeit
des Abbruchs der Mauer, der sich auf den gesamten zugerichteten Bausteinvorrat
erstreckt hat, führen die karolingischen Scherben (mehrere Dutzend!) in der Mörtel-
schuttaussüllung. Auch der damals aus ihnen errichtete Bau läßt sich noch bestim-
men: es wird die Kirche gewesen sein, deren Erstellung Kaiser Ludwig der Fromme
den Insassen des nahen Königshofes Neckarau bewilligt hatte (nach der Rrkunde
Ludwigs des Deutschen vom 9. März 873: tvlon. Oerm. bist. Dipl. re§. Oerm.
ex 8tirpe Larolinoinim I no 145 S. 202, Berlin 1934 -- Böhmer-Mühlbacher, ke-
§e8ta Imperii I (2. Aufl.) no 1492). So ist es also wiederum, wie bei Ladenburg,
gelungen, eine deutsche Kaiserurkunde des frühen Mittelalters durch Scherbenfunde
zu verlebendigen. Eine geologisch-petrographische Antersuchung der Stücksteine der
Rollschicht durch Prof. Dr. A. Strigel, Mannheim hatte das überraschende Ergeb-
nis, daß neben einigen Pfälzer Sandsteinen hauptsächlich tertiäre Kalke der Gegend
von Kallstadt bis Grünstadt links des Rheins verwandt waren, kein Neckarsandstein.
Die Brüche des Neckartals waren den Römern nicht mehr zugänglich. So kann dieser
über den Rhein geholte Steinbruchschutt wiederum die aus der geschichtlichen Äber-
lieferung gewonnene Anschauung über die damaligen politischen Verhältnisse der
Gegend nur bestätigen und eindrucksvoll veranschaulichen. Zahlreiche Tastungen in
der näheren und weiteren Umgebung des Burgus blieben ergebnislos. Nur einer
jener Mündungsarme des Neckars in den Rhein zur römischen Zeit, der etwa 50 in
westlich des Burgus begann, war am Schlick in der Tiefe zu erkennen.