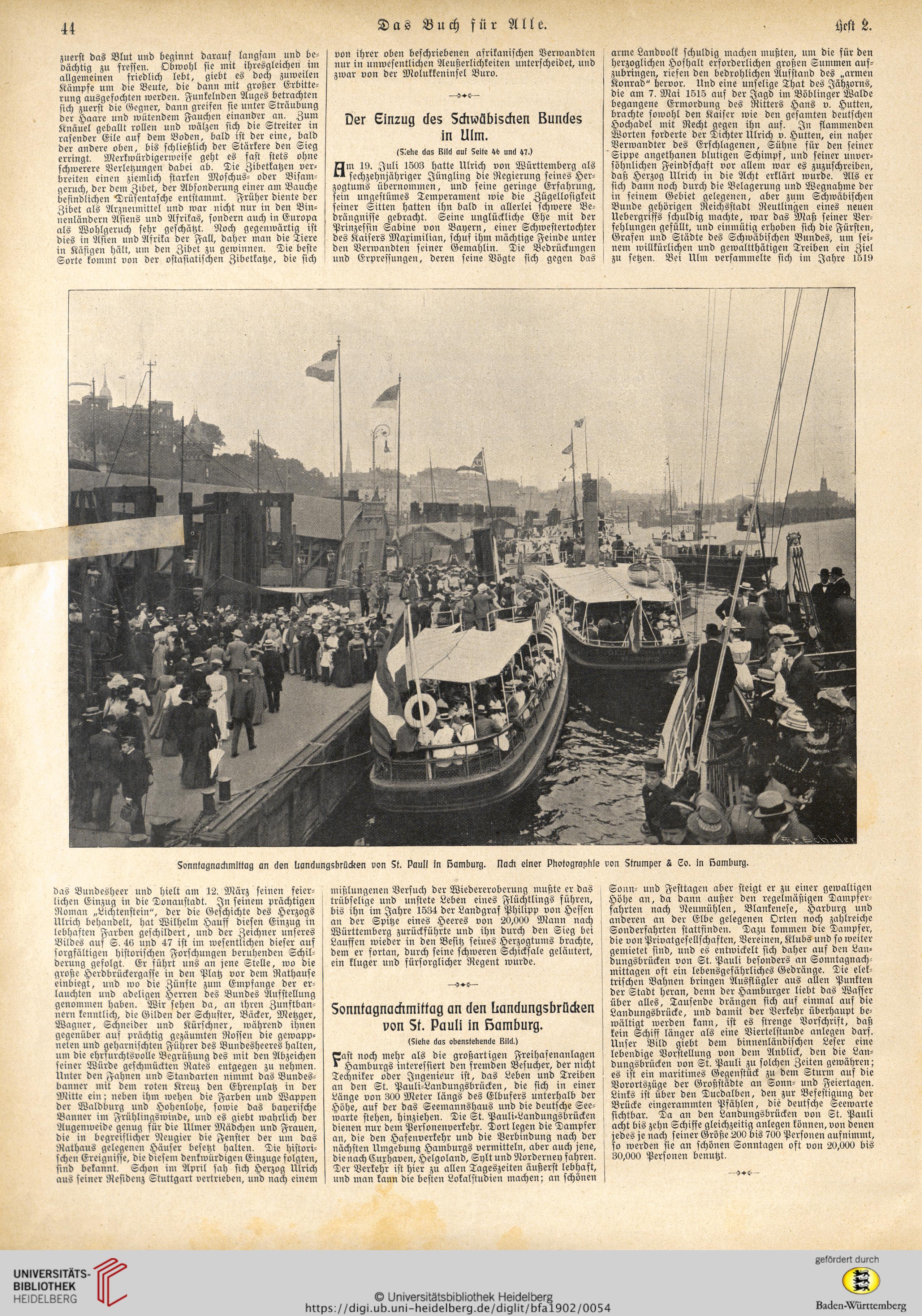44
Das Buch für Alle.
Lieft 2.
zuerst das Blut und beginnt darauf langsam und be-
dächtig zu fressen. Obwohl sie mit ihresgleichen un
allgemeinen friedlich lebt, giebt es doch zuweilen
Kämpfe um die Beute, die dann mit großer Erbitte-
rung ausgefochten werden. Funkelnden Auges betrachten
sich zuerst die Gegner, dann greifen sie unter Sträubung
der Haare und wütendem Fauchen einander an. Zum
Knäuel geballt rollen und wälzen sich die Streiter in
rasender Eile auf dem Boden, bald ist der eine, bald
der andere oben, bis schließlich der Stärkere den Sieg
erringt. Merkwürdigerweise geht es fast stets ohne
schwerere Verletzungen dabei ab. Die Zibetkatzen ver-
breiten einen ziemlich starken Moschus- oder Bisam-
geruch, der dem Zibet, der Absonderung einer am Bauche
befindlichen Drüsentasche entstammt. Früher diente der
Zibet als Arzneimittel und war nicht nur in den Bin-
nenländern Asiens und Afrikas, sondern auch in Europa
als Wohlgeruch sehr geschätzt. Noch gegenwärtig ist
dies in Asien und Afrika der Fall, daher man die Tiere
in Käfigen hält, um den Zibet zu gewinnen. Die beste
Sorte kommt von der ostasiatischen Zibetkatze, die sich
von ihrer oben beschriebenen afrikanischen Verwandten
nur in unwesentlichen Aeußerlichkeiten unterscheidet, und
zwar von der Molukkeninsel Büro.
Oer Cinrug ZcklocibisckLN kuliüss
in Ulm.
(Lieks llas kttö au! Leite 4b uml 47.1
LIm 19. Juli IMS hatte Ulrich von Württemberg als
H sechzehnjähriger Jüngling die Regierung seines Her-
zogtums übernommen, und seine geringe Erfahrung,
sein ungestümes Temperament wie die Zügellosigkeit
seiner Sitten hatten ihn bald in allerlei schwere Be-
drängnisse gebracht. Seine unglückliche Ehe mit der
Prinzessin Sabine von Bayern, einer Schwestertochter
des Kaisers Maximilian, schuf ihm mächtige Feinde unter
den Verwandten seiner Gemahlin. Die Bedrückungen !
und Erpressungen, deren seine Vögte sich gegen das I
arme Landvolk schuldig machen mußten, um die für den
herzoglichen Hofhalt erforderlichen großen Summen auf-
zubringen, riefen den bedrohlichen Aufstand des „armen
Konrad" hervor. Und eine unselige That des Jähzorns,
die am 7. Mai 1518 auf der Jagd im Böblinger Walde
begangene Ermordung des Ritters Hans v. Hutten,
brachte sowohl den Kaiser wie den gesamten deutschen
Hochadel mit Recht gegen ihn auf. In flammenden
Worten forderte der Dichter Ulrich v. Hutten, ein naher
Verwandter des Erschlagenen, Sühne sür den seiner
Sippe angethanen blutigen Schimpf, und seiner unver-
söhnlichen Feindschaft vor allem war es zuzuschreiben,
daß Herzog Ulrich in die Acht erklärt wurde. Als er
sich dann noch durch die Belagerung und Wegnahme der
in seinem Gebiet gelegenen, aber zum Schwäbischen
Bunde gehörigen Reichsstadt Reutlingen eines neuen
Uebergriffs schuldig machte, war das AAch seiner Ver-
fehlungen gefüllt, und einmütig erhoben sich die Fürsten,
Grafen und Städte des Schwäbischen Bundes, um sei-
nem willkürlichen und gewaltthätigen Treiben ein Ziel
zu setzen. Bei Ulm versammelte sich im Jahre 1519
Zonntagnactunittag an äsn liainlungsbrücken von 5t. Pauli in kaniburg. llactz einer pliotograpiile von Rruniper L Co. in Hamburg.
das Bundesheer und hielt am 12. März seinen feier-
lichen Einzug in die Donaustadt. In seinem prächtigen
Roman „Lichtenstein", der die Geschichte des Herzogs
Ulrich behandelt, hat Wilhelm Hauff diesen Einzug in
lebhaften Farben geschildert, und der Zeichner unseres
Bildes aus S. 46 und 47 ist im wesentlichen dieser auf
sorgfältigen historischen Forschungen beruhenden Schil-
derung gefolgt. Er führt uns an jene Stelle, wo die
große Herobrückergasse in den Platz vor dem Rathause
einbiegt, und wo die Zünfte zum Empfange der er-
lauchten und adeligen Herren des Bundes Aufstellung
genommen haben. Wir sehen da, an ihren Zunftban-
nern kenntlich, die Gilden der Schuster, Bäcker, Metzger,
Wagner, Schneider und Kürschner, während ihnen
gegenüber auf prächtig gezäumten Rossen die gewapp-
neten und geharnischten Führer des Bundesheeres halten,
um die ehrfurchtsvolle Begrüßung des mit den Abzeichen
seiner Würde geschmückten Rates entgegen zu nehmen.
Unter den Fahnen und Standarten nimmt das Bundes-
banner mit dem roten Kreuz den Ehrenplatz in der
Mitte ein; neben ihm wehen die Farben und Wappen
der Waldburg und Hohenlohe, sowie das bayerische
Banner im Frühlingswinde, und es giebt wahrlich der
Augenweide genug für die Ulmer Mädchen und Frauen,
die in begreiflicher Neugier die Fenster der um das
Rathaus gelegenen Häuser besetzt halten. Die histori-
schen Ereignisse, die diesem denkwürdigen Einzuge folgten,
sind bekannt. Schon im April sah sich Herzog Ulrich
aus seiner Residenz Stuttgart vertriebe», und nach einem
mißlungenen Versuch der Wiedereroberung mußte er das
trübselige und unstete Leben eines Flüchtlings führen,
bis ihn im Jahre 1534 der Landgraf Philipp von Hessen
an der Spitze eines Heeres von 20,000 Mann^ nach
Württemberg zurückführte und ihn durch den Sieg bei
Lauffen wieder in den Besitz seines Herzogtums brachte,
dem er fortan, durch seine schweren Schicksale geläutert,
ein kluger und fürsorglicher Regent wurde.
Toimtciglicickmittag cin 6sn kcmllungzbrllckeli
von 5t. Pauli in üaniburg.
(Lieks lies obsnstsksnäe 8116.)
^ast noch mehr als die großartigen Freihafenanlaben
Hamburgs interessiert den fremden Besucher, der nicht
Techniker oder Ingenieur ist, das Leben und Treiben
an den St. Pauli-Landungsbrücken, die sich in einer
Länge von 300 Meter längs des Elbufers unterhalb der
Höhe, auf der das Seemannshaus und die deutsche See-
warte stehen, hinziehen. Die St. Pauli-Landungsbrücken
dienen nur dem Personenverkehr. Dort legen die Dampfer
an, die den Hafenverkehr und die Verbindung nach der
nächsten Umgebung Hamburgs vermitteln, aber auch jene,
die nach Cuxhaven, Helgoland, Sylt und Norderney fahren.
Der Verkehr ist hier zu allen Tageszeiten äußerst lebhaft,
und man kann die besten Lokalstudien machen; an schönen
Sonn- und Festtagen aber steigt er zu einer gewaltigen
Höhe an, da dann außer den regelmäßigen Dampfer-
fahrten nach Neumühlen, Blankenese, Harburg und
anderen an der Elbe gelegenen Orten noch zahlreiche
Sonderfahrten stattfinden. Dazu kommen die Dampfer,
die von Privatgesellschaften, Vereinen, Klubs und so weiter
gemietet sind, und es entwickelt sich daher auf den Lan-
dungsbrücken von St. Pauli besonders an Sonntagnach-
mittagen oft ein lebensgefährliches Gedränge. Die elek-
trischen Bahnen bringen Ausflügler aus allen Punkten
der Stadt heran, denn der Hamburger liebt das Wasser
über alles, Tausende drängen sich auf einmal auf die
Landungsbrücke, und damit der Verkehr überhaupt be-
wältigt werden kann, ist es strenge Vorschrift, daß
kein Schiff länger als eine Viertelstunde anlegen darf.
Unser Bild giebt dem binnenländischen Leser eine
lebendige Vorstellung von dem Anblick, den die Lan-
dungsbrücken von St. Pauli zu solchen Zeiten gewähre»;
es ist ein maritimes Gegenstück zu dem Sturm auf die
Vorortszüge der Großstädte an Sonn- und Feiertagen.
Links ist über den Ducdalben, den zur Befestigung der
Brücke eingerammten Pfählen, die deutsche Seewarte
sichtbar. Da an den Landungsbrücken von St. Pauli
acht bis zehn Schiffe gleichzeitig anlegen können, von denen
jedes je nach seiner Größe 200 bis 700 Personen aufnimmt,
so werden sie an schönen Sonntagen oft von 20,000 bis
30,000 Personen benutzt.
Das Buch für Alle.
Lieft 2.
zuerst das Blut und beginnt darauf langsam und be-
dächtig zu fressen. Obwohl sie mit ihresgleichen un
allgemeinen friedlich lebt, giebt es doch zuweilen
Kämpfe um die Beute, die dann mit großer Erbitte-
rung ausgefochten werden. Funkelnden Auges betrachten
sich zuerst die Gegner, dann greifen sie unter Sträubung
der Haare und wütendem Fauchen einander an. Zum
Knäuel geballt rollen und wälzen sich die Streiter in
rasender Eile auf dem Boden, bald ist der eine, bald
der andere oben, bis schließlich der Stärkere den Sieg
erringt. Merkwürdigerweise geht es fast stets ohne
schwerere Verletzungen dabei ab. Die Zibetkatzen ver-
breiten einen ziemlich starken Moschus- oder Bisam-
geruch, der dem Zibet, der Absonderung einer am Bauche
befindlichen Drüsentasche entstammt. Früher diente der
Zibet als Arzneimittel und war nicht nur in den Bin-
nenländern Asiens und Afrikas, sondern auch in Europa
als Wohlgeruch sehr geschätzt. Noch gegenwärtig ist
dies in Asien und Afrika der Fall, daher man die Tiere
in Käfigen hält, um den Zibet zu gewinnen. Die beste
Sorte kommt von der ostasiatischen Zibetkatze, die sich
von ihrer oben beschriebenen afrikanischen Verwandten
nur in unwesentlichen Aeußerlichkeiten unterscheidet, und
zwar von der Molukkeninsel Büro.
Oer Cinrug ZcklocibisckLN kuliüss
in Ulm.
(Lieks llas kttö au! Leite 4b uml 47.1
LIm 19. Juli IMS hatte Ulrich von Württemberg als
H sechzehnjähriger Jüngling die Regierung seines Her-
zogtums übernommen, und seine geringe Erfahrung,
sein ungestümes Temperament wie die Zügellosigkeit
seiner Sitten hatten ihn bald in allerlei schwere Be-
drängnisse gebracht. Seine unglückliche Ehe mit der
Prinzessin Sabine von Bayern, einer Schwestertochter
des Kaisers Maximilian, schuf ihm mächtige Feinde unter
den Verwandten seiner Gemahlin. Die Bedrückungen !
und Erpressungen, deren seine Vögte sich gegen das I
arme Landvolk schuldig machen mußten, um die für den
herzoglichen Hofhalt erforderlichen großen Summen auf-
zubringen, riefen den bedrohlichen Aufstand des „armen
Konrad" hervor. Und eine unselige That des Jähzorns,
die am 7. Mai 1518 auf der Jagd im Böblinger Walde
begangene Ermordung des Ritters Hans v. Hutten,
brachte sowohl den Kaiser wie den gesamten deutschen
Hochadel mit Recht gegen ihn auf. In flammenden
Worten forderte der Dichter Ulrich v. Hutten, ein naher
Verwandter des Erschlagenen, Sühne sür den seiner
Sippe angethanen blutigen Schimpf, und seiner unver-
söhnlichen Feindschaft vor allem war es zuzuschreiben,
daß Herzog Ulrich in die Acht erklärt wurde. Als er
sich dann noch durch die Belagerung und Wegnahme der
in seinem Gebiet gelegenen, aber zum Schwäbischen
Bunde gehörigen Reichsstadt Reutlingen eines neuen
Uebergriffs schuldig machte, war das AAch seiner Ver-
fehlungen gefüllt, und einmütig erhoben sich die Fürsten,
Grafen und Städte des Schwäbischen Bundes, um sei-
nem willkürlichen und gewaltthätigen Treiben ein Ziel
zu setzen. Bei Ulm versammelte sich im Jahre 1519
Zonntagnactunittag an äsn liainlungsbrücken von 5t. Pauli in kaniburg. llactz einer pliotograpiile von Rruniper L Co. in Hamburg.
das Bundesheer und hielt am 12. März seinen feier-
lichen Einzug in die Donaustadt. In seinem prächtigen
Roman „Lichtenstein", der die Geschichte des Herzogs
Ulrich behandelt, hat Wilhelm Hauff diesen Einzug in
lebhaften Farben geschildert, und der Zeichner unseres
Bildes aus S. 46 und 47 ist im wesentlichen dieser auf
sorgfältigen historischen Forschungen beruhenden Schil-
derung gefolgt. Er führt uns an jene Stelle, wo die
große Herobrückergasse in den Platz vor dem Rathause
einbiegt, und wo die Zünfte zum Empfange der er-
lauchten und adeligen Herren des Bundes Aufstellung
genommen haben. Wir sehen da, an ihren Zunftban-
nern kenntlich, die Gilden der Schuster, Bäcker, Metzger,
Wagner, Schneider und Kürschner, während ihnen
gegenüber auf prächtig gezäumten Rossen die gewapp-
neten und geharnischten Führer des Bundesheeres halten,
um die ehrfurchtsvolle Begrüßung des mit den Abzeichen
seiner Würde geschmückten Rates entgegen zu nehmen.
Unter den Fahnen und Standarten nimmt das Bundes-
banner mit dem roten Kreuz den Ehrenplatz in der
Mitte ein; neben ihm wehen die Farben und Wappen
der Waldburg und Hohenlohe, sowie das bayerische
Banner im Frühlingswinde, und es giebt wahrlich der
Augenweide genug für die Ulmer Mädchen und Frauen,
die in begreiflicher Neugier die Fenster der um das
Rathaus gelegenen Häuser besetzt halten. Die histori-
schen Ereignisse, die diesem denkwürdigen Einzuge folgten,
sind bekannt. Schon im April sah sich Herzog Ulrich
aus seiner Residenz Stuttgart vertriebe», und nach einem
mißlungenen Versuch der Wiedereroberung mußte er das
trübselige und unstete Leben eines Flüchtlings führen,
bis ihn im Jahre 1534 der Landgraf Philipp von Hessen
an der Spitze eines Heeres von 20,000 Mann^ nach
Württemberg zurückführte und ihn durch den Sieg bei
Lauffen wieder in den Besitz seines Herzogtums brachte,
dem er fortan, durch seine schweren Schicksale geläutert,
ein kluger und fürsorglicher Regent wurde.
Toimtciglicickmittag cin 6sn kcmllungzbrllckeli
von 5t. Pauli in üaniburg.
(Lieks lies obsnstsksnäe 8116.)
^ast noch mehr als die großartigen Freihafenanlaben
Hamburgs interessiert den fremden Besucher, der nicht
Techniker oder Ingenieur ist, das Leben und Treiben
an den St. Pauli-Landungsbrücken, die sich in einer
Länge von 300 Meter längs des Elbufers unterhalb der
Höhe, auf der das Seemannshaus und die deutsche See-
warte stehen, hinziehen. Die St. Pauli-Landungsbrücken
dienen nur dem Personenverkehr. Dort legen die Dampfer
an, die den Hafenverkehr und die Verbindung nach der
nächsten Umgebung Hamburgs vermitteln, aber auch jene,
die nach Cuxhaven, Helgoland, Sylt und Norderney fahren.
Der Verkehr ist hier zu allen Tageszeiten äußerst lebhaft,
und man kann die besten Lokalstudien machen; an schönen
Sonn- und Festtagen aber steigt er zu einer gewaltigen
Höhe an, da dann außer den regelmäßigen Dampfer-
fahrten nach Neumühlen, Blankenese, Harburg und
anderen an der Elbe gelegenen Orten noch zahlreiche
Sonderfahrten stattfinden. Dazu kommen die Dampfer,
die von Privatgesellschaften, Vereinen, Klubs und so weiter
gemietet sind, und es entwickelt sich daher auf den Lan-
dungsbrücken von St. Pauli besonders an Sonntagnach-
mittagen oft ein lebensgefährliches Gedränge. Die elek-
trischen Bahnen bringen Ausflügler aus allen Punkten
der Stadt heran, denn der Hamburger liebt das Wasser
über alles, Tausende drängen sich auf einmal auf die
Landungsbrücke, und damit der Verkehr überhaupt be-
wältigt werden kann, ist es strenge Vorschrift, daß
kein Schiff länger als eine Viertelstunde anlegen darf.
Unser Bild giebt dem binnenländischen Leser eine
lebendige Vorstellung von dem Anblick, den die Lan-
dungsbrücken von St. Pauli zu solchen Zeiten gewähre»;
es ist ein maritimes Gegenstück zu dem Sturm auf die
Vorortszüge der Großstädte an Sonn- und Feiertagen.
Links ist über den Ducdalben, den zur Befestigung der
Brücke eingerammten Pfählen, die deutsche Seewarte
sichtbar. Da an den Landungsbrücken von St. Pauli
acht bis zehn Schiffe gleichzeitig anlegen können, von denen
jedes je nach seiner Größe 200 bis 700 Personen aufnimmt,
so werden sie an schönen Sonntagen oft von 20,000 bis
30,000 Personen benutzt.