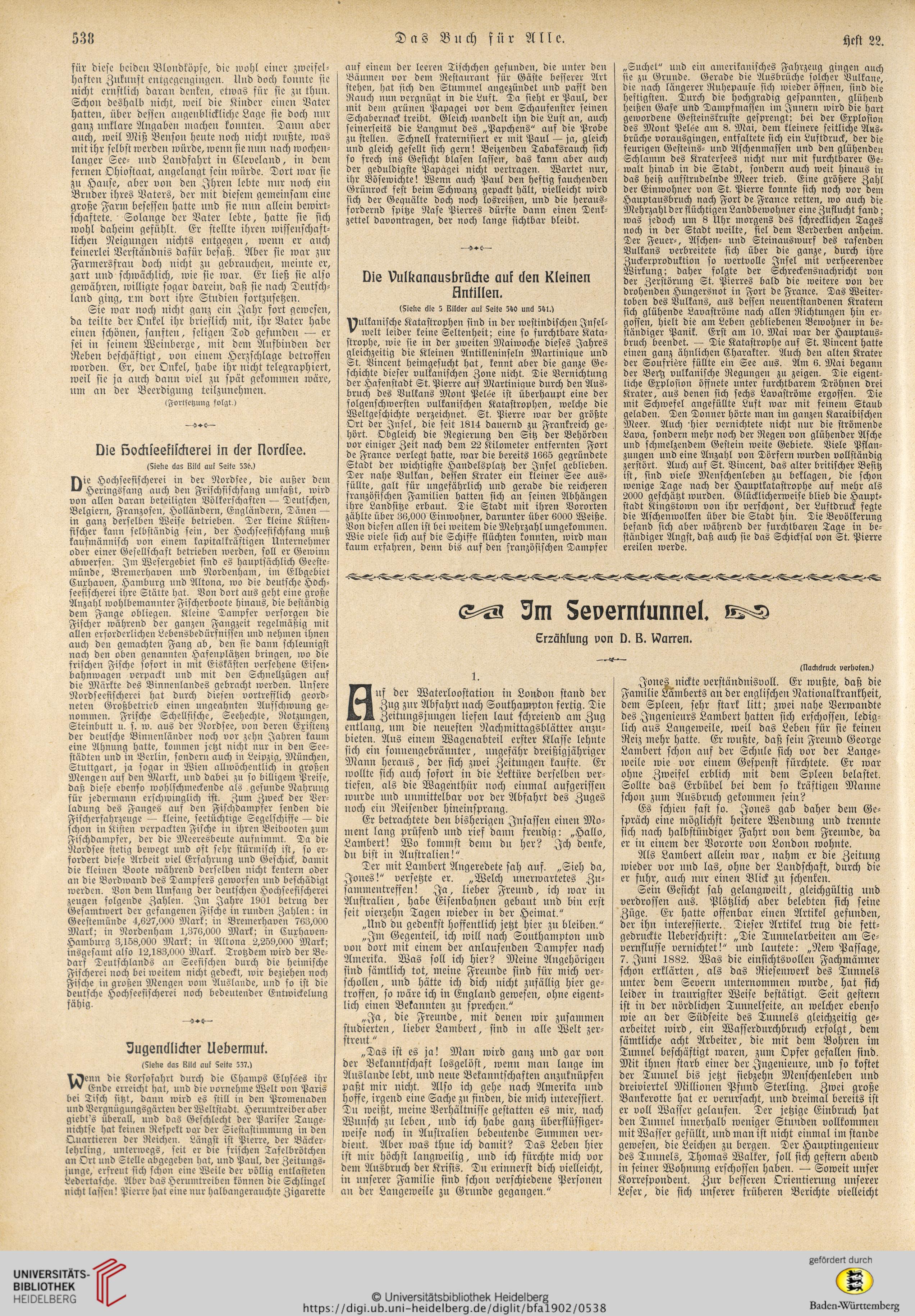538
Das Buch für Alle.
Hch ZS.
für diese beiden Blondköpfe, die wohl einer zweifel-
haften Znknnft entgegengingen. lind doch konnte sie
nicht ernstlich daran denken, etwas für sie zu thun.
Schon deshalb nicht, weil die Kinder einen Vater
hatten, über dessen augenblickliche Lage sie doch nur
ganz unklare Angaben machen konnten. Dann aber
auch, weil Miß Benson heute noch nicht wußte, was
nütihr selbst werden würde, wenn sie uun nach wochen-
langer See- und Landfahrt in Cleveland, in dem
fernen Ohiostaat, angelangt fein würde. Dort war sie
zu Hause, aber von den Ihren lebte nur noch ein
Bruder ihres Vaters, der mit diesem gemeinsam eine
große Farm besessen hatte und sie nun allein bewirt-
schaftete. Solange der Vater lebte, hatte sie sich
wohl daheim gefühlt. Er stellte ihren wissenschaft-
lichen Neigungen nichts entgegen, wenn er auch
keinerlei Verständnis dafür besaß. Aber sie war zur
Farmersfrau doch nicht zu gebrauchen, meinte er,
zart und schwächlich, wie sic war. Er ließ sie also
gewähren, willigte sogar darein, daß sie nach Deutsch-
land ging, nm dort ihre Studien fortzusetzen.
Sie war noch nicht ganz ein Jahr fort gewesen,
da teilte der Onkel ihr brieflich mit, ihr Vater habe
einen schönen, sanften, seligen Tod gefunden — er
sei in seinem Weinberge, mit dem Anfbinden der
Reben beschäftigt, von einem Herzschlage betroffen
worden. Er, der Onkel, habe ihr nicht telegraphiert,
weil sie ja auch dann viel zu spät gekommen wäre,
um an der Beerdigung teilzunehmen.
(Fortsetzung folgt !
——-
Qis kockleMckersi in 6er Nordsee.
Atolle das 8ild ouk 5sits 5Z('.)
s^ie Hochseefischerei in der Nordsee, die außer dem
" Heringsfang auch den Frischsischsang umfaßt, wird
von allen daran beteiligten Völkerschaften — Deutschen,
Belgiern, Franzosen, Holländern, Engländern, Dänen —
in ganz derselben Weise betrieben. Der kleine Küsten-
fischer kann selbständig sein, der Hochseefischfang muß
kaufmännisch von einem kapitalkräftigen Unternehmer
oder einer Gesellschaft betrieben werden, soll er Gewinn
abwerfen. Im Wesergebiet sind es hauptsächlich Geeste-
münde, Bremerhaven und Nordenham, im Elbgebiet
Cuxhaven, Hamburg und Altona, wo die deutsche Hoch-
seefischerei ihre Stätte hat. Von dort aus geht eine große
Anzahl wohlbemannter Fischerboote hinaus, die beständig
dem Fange obliegen. Kleine Dampfer versorgen die
Fischer während der ganzen Fangzeit regelmäßig mit
allen erforderlichen Lebensbedürfnissen und nehmen ihnen
auch den gemachten Fang ab, den sie dann schleunigst
nach den oben genannten Hafenplätzen bringen, wo die
frischen Fische sofort in mit Eiskästen versehene Eisen-
bahnwagen verpackt und mit den Schnellzügen auf
die Märkte des Binnenlandes gebracht werden. Unsere
Nordseefischerei hat durch diesen vortrefflich geord-
neten Großbetrieb einen ungeahnten Aufschwung ge-
nommen. Frische Schellfische, Seehechte, Rotzungen,
Steinbutt u. s. w. aus der Nordsee, von deren Existenz
der deutsche Binnenländer noch vor zehn Jahren kaum
eine Ahnung hatte, kommen jetzt nicht nur in den See-
städten und in Berlin, sondern auch in Leipzig, München,
Stuttgart, ja sogar in Wien allwöchentlich in großen
Mengen aus den Markt, und dabei zu so billigem Preise,
daß diese ebenso wohlschmeckende als . gesunde Nahrung
für jedermann erschwinglich ist. Zum Zweck der Ver-
ladung des Fanges auf den Fischdampfer senden die
Fischerfahrzeuge — kleine, seetüchtige Segelschiffe — die
schon in Kisten verpackten Fische in ihren Beibooten zum
Fischdampfer, der die Meeresbeute aufnimmt. Da die
Nordsee stetig bewegt und ost sehr stürmisch ist, so er-
fordert diese Arbeit viel Erfahrung und Geschick, damit
die kleinen Boote während derselben nicht kentern oder
an die Bordwand des Dampfers geworfen und beschädigt
werden. Von dem Umfang der deutschen Hochseefischerei
zeugen folgende Zahlen. Im Jahre 1901 betrug der
Gesamtwert der gefangenen Fische in runden Zahlen: in
Geestemünde 4,627,000 Mark; in Bremerhaven 763,000
Mark; in Nordenham 1,376,000 Mark; in Cuxhaven-
Hamburg 3,158,000 Mark; in Altona 2,259,000 Mark;
insgesamt also 12,183,000 Mark. Trotzdem wird der Be-
darf Deutschlands an Seefischen durch die heimische
Fischerei noch bei weitem nicht gedeckt, wir beziehen noch
Fische in großen Mengen vom Auslande, und so ist die
deutsche Hochseefischerei noch bedeutender Entwickelung
fähig.
Zugendlicker Uebermut.
(Zi'etie äcis kild ciul Zeile 537.)
enn die Korsofahrt durch die Champs Elysses ihr
Ende erreicht hat, und die vornehme Welt von Paris
bei Tisch sitzt, dann wird es still in den Promenaden
und Vergnügungsgärten der Weltstadt. Herumtreiber aber
giebt's überall, und das Geschlecht der Pariser Tauge-
nichtse hat keinen Respekt vor der Siestastimmung in den
Quartieren der Reichen. Längst ist Pierre, der Bäcker-
lehrling, unterwegs, seit er die frischen Tafelbrötchen
an Ort und Stelle abgegeben hat, und Paul, der Zeitungs-
junge, erfreut sich schon eine Weile der völlig entlasteten
Ledertasche. Aber das Herumtreiben können die Schlingel
nicht lassen! Pierre hat eine nur halbangerauchte Zigarette
auf einem der leeren Tischchen gefunden, die unter den
Bäumen vor dem Restaurant für Gäste besserer Art
stehen, hat sich den Stummel angezündet und pafft den
Ranch nun vergnügt in die Luft. Da sieht er Paul, der
mit dem grünen Papagei vor dem Schaufenster seinen
Schabernack treibt. Gleich wandelt ihn die Lust an, auch
seinerseits die Langmut des „Papchens" auf die Probe
zu stellen. Schnell fraternisiert er mit Paul — ja, gleich
und gleich gesellt sich gern! Beizenden Tabaksrauch sich
so frech ins Gesicht blasen lassen-, das kann aber auch
der geduldigste Papagei nicht vertragen. Wartet nur,
ihr Bösewichte! Wenn auch Paul den heftig fauchenden
Grünrock fest beim Schwanz gepackt hält, vielleicht wird
sich der Gequälte doch noch losreißen, und die heraus-
fordernd spitze Nase Pierres dürfte dann einen Denk-
zettel davontragen, der noch lange sichtbar bleibt.
Qis Vulkcinciusbriictie ciuk den Kleinen
Antillen.
Cislis dis 5 Lildsr au! Lsits 540 und 541.)
Hlulkanische Katastrophen sind in der westindischen Jnsel-
weit leider keine Seltenheit; eine so furchtbare Kata-
strophe, wie sie in der zweiten Maiwoche dieses Jahres
gleichzeitig die Kleinen Antilleninseln Martinique und
St. Vincent heimgesucht hat, kennt aber die ganze Ge-
schichte dieser vulkanischen Zone nicht. Die Vernichtung
der Hafenstadt St. Pierre aus Martinique durch den Aus-
bruch des Vulkans Mont Pelse ist überhaupt eine der
folgenschwersten vulkanischen Katastrophen, welche die
Weltgeschichte verzeichnet. St. Pierre war der größte
Ort der Insel, die seit 1814 dauernd zu Frankreich ge-
hört. Obgleich die Regierung den Sitz der Behörden
vor einiger Zeit nach dem 22 Kilometer entfernten Fort
de France verlegt hatte, war die bereits 1665 gegründete
Stadt der wichtigste Handelsplatz der Insel geblieben.
Der nahe Vulkan, dessen Krater ein kleiner See aus-
füllte, galt für ungefährlich und gerade dis reicheren
französischen Familien hatten sich an seinen Abhängen
ihre Landsitze erbaut. Die Stadt mit ihren Vororten
zählte über 36,000 Einwohner, darunter über 6000 Weiße.
Von diesen allen ist bei weitem die Mehrzahl umgekommen.
Wie viele sich auf die Schiffs flüchten konnten, wird man
kaum erfahren, denn bis auf den französischen Dampfer
„Suchet" und ein amerikanisches Fahrzeug gingen auch
sie zu Grunde. Gerade die Ausbrüche solcher Vulkane,
die nach längerer Ruhepause sich wieder öffnen, sind die
heftigsten. Durch die hochgradig gespannten, glühend
heißen Gase und Dampfmassen im Innern wird die hart
gewordene Gesteinskruste gesprengt; bei der Explosion
des Mont Pelse am 8. Mai, dem kleinere seitliche Aus-
brüche vorausgingen, entfaltete sich ein Luftdruck, der die
feurigen Gesteins- und Aschenmassen und den glühenden
Schlamm des Kratersees nicht nur mit furchtbarer Ge-
walt hinab in die Stadt, sondern auch weit hinaus in
das heiß aufstrudelnde Meer trieb. Eine größere Zahl
der Einwohner von St. Pierre konnte sich noch vor dem
Hauptausbruch nach Fort de France retten, wo auch die
Mehrzahl der flüchtigen Landbewohner eineZuflucht fand;
was jedoch um 8 Uhr morgens des schrecklichen Tages
noch in der Stadt weilte, siel dem Verderben anheim.
Der Feuer-, Aschen- und Steinauswurf des rasenden
Vulkans verbreitete sich über die ganze, durch ihre
Zuckerproduktion so wertvolle Insel mit verheerender
Wirkung; daher folgte der Schreckensnachricht von
der Zerstörung St. Pierres bald die weitere von der
drohenden Hungersnot in Fort de France. Das Weiter-
toben des Vulkans, aus dessen neuentstandenen Kratern
sich glühende Lavaströme nach allen Richtungen hin er-
gossen, hielt die am Leben gebliebenen Bewohner in be-
ständiger Panik. Erst am 10. Mai war der Hauptaus-
bruch beendet. -- Die Katastrophe auf St. Vincent hatte
einen ganz ähnlichen Charakter. Auch den alten Krater
der Soufriere füllte ein See aus. Am 6. Mai begann
der Berg vulkanische Regungen zu zeigen. Die eigent-
liche Explosion öffnete unter furchtbarem Dröhnen drei
Krater, aus denen sich sechs Lavaströme ergossen. Die
mit Schwefel angefüllte Luft war mit feinem Staub
geladen. Den Donner hörte man im ganzen Karaibischen
Meer. Auch hier vernichtete nicht nur die strömende
Lava, sondern mehr noch der Regen von glühender Asche
und schmelzendem Gestein weite Gebiete. Viele Pflan-
zungen und eine Anzahl von Dörfern wurden vollständig
zerstört. Auch auf St. Vincent, das alter britischer Besitz
ist, sind viele Menschenleben zu beklagen, die schon
wenige Tage nach der Hauptkatastrophe auf mehr als
2000 geschätzt wurden. Glücklicherweise blieb die Haupt-
stadt Kingstown von ihr verschont, der Luftdruck fegte
die Aschenwolken über die Stadt hin. Die Bevölkerung
befand sich aber während der furchtbaren Tage in be-
ständiger Angst, daß auch sie das Schicksal von St. Pierre
ereilen werde.
S-s 3m Zeverntumiel.
Crrcitilung von v. 8. Darren.
1.
Z uf der Waterloostation in London stand der
Zng znr Abfahrt nach Southampton fertig. Die
Zeitungsjungen liefen laut schreiend am Zug
entlang, nm die neuesten Nachmittagsblätter anzn-
bieten. Ans einem Wagenabteil erster Klasse lehnte
sich ein sonnengebrännter, ungefähr dreißigjähriger
Mann heraus, der sich zwei Zeitungen kaufte. Er
wollte sich auch sofort in die Lektüre derselben ver-
tiefen, als die Wagenthür noch einmal aufgerissen
wurde und unmittelbar vor der Abfahrt des Zuges
noch ein Reisender hineinsprang.
Er betrachtete den bisherigen Insassen einen Mo-
ment lang prüfend und rief dann freudig: „Hallo,
Lambert! Wo kommst denn du her? Ich denke,
dn bist in Australien!"
Der mit Lambert Angeredete sah auf. „Sieh da,
Jones!" versetzte er. „Welch unerwartetes Zu-
sammentreffen! Ja, lieber Freund, ich war in
Australien, habe Eisenbahnen gebaut und bin erst
seit vierzehn Tagen wieder in der Heimat."
„Und du gedenkst hoffentlich jetzt hier zu bleiben."
„Im Gegenteil, ich will nach Southampton und
von dort mit einem der anlanfenden Dampfer nach
Amerika. Was soll ich hier? Meine Angehörigen
sind sämtlich tot, meine Freunde sind für mich ver-
zollen, und hätte ich dich nicht zufällig hier ge-
troffen, so wäre ich in England gewefen, ohne eigent-
lich einen Bekannten zu sprechen."
„Ja, die Freunde, mit denen wir zusammen
studierten, lieber Lambert, sind in alle Welt zer-
streut"
„Das ist es ja! Man wird ganz und gar von
der Bekanntschaft losgelöst, wenn man lange im
Auslande lebt, und neue Bekanntschaften anzuknüpfen
paßt mir nicht. Also ich gehe nach Amerika und
hoffe, irgend eine Sache zu finden, die mich interessiert.
Dn weißt, meine Verhältnisse gestatten es mir, nach
! Wunsch zu leben, und ich habe ganz überflüssiger-
weise noch in Australien bedeutende Summen ver-
dient. Aber was thue ich damit? Das Leben hier-
ist mir höchst langweilig, und ich fürchte mich vor-
dem Ausbruch der Krisis. Du erinnerst dich vielleicht,
in unserer Familie sind schon verschiedene Personen
an der Langeweile zu Grunde gegangen."
(Uvckdruck verboten.)
Jones nickte verständnisvoll. Er wußte, daß die
Familie Lamberts an der englischen Nationalkrankheit,
dem Spleen, sehr stark litt; zwei nahe Verwandte
des Ingenieurs Lambert hatten sich erschossen, ledig-
lich aus Langeiveile, weil das Leben für sie keinen
Reiz mehr hatte. Er wußte, daß sein Frennd George
Lambert schon auf der Schule sich vor der Lange-
weile wie vor einem Gespenst fürchtete. Er war
ohne Zweifel erblich mit dem Spleen belastet.
Sollte das Erbübel bei dem so kräftigen Manne
schon zmn Ausbruch gekommen sein?
Es schien fast so. Jones gab daher dem Ge-
spräch eine möglichst heitere Wendung und trennte
sich nach halbstündiger Fahrt von dem Freunde, da
er in einem der Vororte von London wohnte.
Als Lambert allein war, nahm er die Zeitung
wieder vor und las, ohne der Landschaft, durch die
er fuhr, auch nur einen Blick zu schenken.
Sein Gesicht sah gelangweilt, gleichgültig und
verdrossen aus. Plötzlich aber belebten sich seine
Züge. Er hatte offenbar einen Artikel gefunden,
der ihn interessierte. Dieser Artikel trug die fett-
gedruckte Ueberschrift: „Die Tunnelarbeiten am Se-
vernflusse vernichtet!" und lautete: „New Passage,
7. Juni 1882. Was die einsichtsvollen Fachmänner-
schön erklärten, als das Riefenwerk des Tunnels
unter dem Severn unternommen wurde, hat sich
leider in traurigster Weise bestätigt. Seit gestern
ist in der nördlichen Tunnelseite, an welcher ebenso
ivie an der Südseite des Tunnels gleichzeitig ge-
arbeitet wird, ein Wasserdnrchbruch erfolgt, dem
sämtliche acht Arbeiter, die mit dem Bohren im
Tunnel beschäftigt waren, zum Opfer gefallen sind.
Mit ihnen starb einer der Ingenieure, und so kostet
der Tunnel bis jetzt siebzehn Menschenleben und
dreiviertel Millionen Pfund Sterling. Zwei große
Bankerotte hat er verursacht, und dreimal bereits ist
er voll Wasfer gelaufen. Der jetzige Einbruch hat
den Tunnel innerhalb weniger Stunden vollkommen
mit Wasser gefüllt, und man ist nicht einmal imstande
gewesen, die Leichen zu bergen. Der Hauptingenieur
des Tunnels, Thomas Walker, soll sich gestern abend
in seiner Wohnung erschossen haben. — Soweit unser
Korrespondent. Zur besseren Orientierung unserer
Leser, die sich unserer früheren Berichte vielleicht
Das Buch für Alle.
Hch ZS.
für diese beiden Blondköpfe, die wohl einer zweifel-
haften Znknnft entgegengingen. lind doch konnte sie
nicht ernstlich daran denken, etwas für sie zu thun.
Schon deshalb nicht, weil die Kinder einen Vater
hatten, über dessen augenblickliche Lage sie doch nur
ganz unklare Angaben machen konnten. Dann aber
auch, weil Miß Benson heute noch nicht wußte, was
nütihr selbst werden würde, wenn sie uun nach wochen-
langer See- und Landfahrt in Cleveland, in dem
fernen Ohiostaat, angelangt fein würde. Dort war sie
zu Hause, aber von den Ihren lebte nur noch ein
Bruder ihres Vaters, der mit diesem gemeinsam eine
große Farm besessen hatte und sie nun allein bewirt-
schaftete. Solange der Vater lebte, hatte sie sich
wohl daheim gefühlt. Er stellte ihren wissenschaft-
lichen Neigungen nichts entgegen, wenn er auch
keinerlei Verständnis dafür besaß. Aber sie war zur
Farmersfrau doch nicht zu gebrauchen, meinte er,
zart und schwächlich, wie sic war. Er ließ sie also
gewähren, willigte sogar darein, daß sie nach Deutsch-
land ging, nm dort ihre Studien fortzusetzen.
Sie war noch nicht ganz ein Jahr fort gewesen,
da teilte der Onkel ihr brieflich mit, ihr Vater habe
einen schönen, sanften, seligen Tod gefunden — er
sei in seinem Weinberge, mit dem Anfbinden der
Reben beschäftigt, von einem Herzschlage betroffen
worden. Er, der Onkel, habe ihr nicht telegraphiert,
weil sie ja auch dann viel zu spät gekommen wäre,
um an der Beerdigung teilzunehmen.
(Fortsetzung folgt !
——-
Qis kockleMckersi in 6er Nordsee.
Atolle das 8ild ouk 5sits 5Z('.)
s^ie Hochseefischerei in der Nordsee, die außer dem
" Heringsfang auch den Frischsischsang umfaßt, wird
von allen daran beteiligten Völkerschaften — Deutschen,
Belgiern, Franzosen, Holländern, Engländern, Dänen —
in ganz derselben Weise betrieben. Der kleine Küsten-
fischer kann selbständig sein, der Hochseefischfang muß
kaufmännisch von einem kapitalkräftigen Unternehmer
oder einer Gesellschaft betrieben werden, soll er Gewinn
abwerfen. Im Wesergebiet sind es hauptsächlich Geeste-
münde, Bremerhaven und Nordenham, im Elbgebiet
Cuxhaven, Hamburg und Altona, wo die deutsche Hoch-
seefischerei ihre Stätte hat. Von dort aus geht eine große
Anzahl wohlbemannter Fischerboote hinaus, die beständig
dem Fange obliegen. Kleine Dampfer versorgen die
Fischer während der ganzen Fangzeit regelmäßig mit
allen erforderlichen Lebensbedürfnissen und nehmen ihnen
auch den gemachten Fang ab, den sie dann schleunigst
nach den oben genannten Hafenplätzen bringen, wo die
frischen Fische sofort in mit Eiskästen versehene Eisen-
bahnwagen verpackt und mit den Schnellzügen auf
die Märkte des Binnenlandes gebracht werden. Unsere
Nordseefischerei hat durch diesen vortrefflich geord-
neten Großbetrieb einen ungeahnten Aufschwung ge-
nommen. Frische Schellfische, Seehechte, Rotzungen,
Steinbutt u. s. w. aus der Nordsee, von deren Existenz
der deutsche Binnenländer noch vor zehn Jahren kaum
eine Ahnung hatte, kommen jetzt nicht nur in den See-
städten und in Berlin, sondern auch in Leipzig, München,
Stuttgart, ja sogar in Wien allwöchentlich in großen
Mengen aus den Markt, und dabei zu so billigem Preise,
daß diese ebenso wohlschmeckende als . gesunde Nahrung
für jedermann erschwinglich ist. Zum Zweck der Ver-
ladung des Fanges auf den Fischdampfer senden die
Fischerfahrzeuge — kleine, seetüchtige Segelschiffe — die
schon in Kisten verpackten Fische in ihren Beibooten zum
Fischdampfer, der die Meeresbeute aufnimmt. Da die
Nordsee stetig bewegt und ost sehr stürmisch ist, so er-
fordert diese Arbeit viel Erfahrung und Geschick, damit
die kleinen Boote während derselben nicht kentern oder
an die Bordwand des Dampfers geworfen und beschädigt
werden. Von dem Umfang der deutschen Hochseefischerei
zeugen folgende Zahlen. Im Jahre 1901 betrug der
Gesamtwert der gefangenen Fische in runden Zahlen: in
Geestemünde 4,627,000 Mark; in Bremerhaven 763,000
Mark; in Nordenham 1,376,000 Mark; in Cuxhaven-
Hamburg 3,158,000 Mark; in Altona 2,259,000 Mark;
insgesamt also 12,183,000 Mark. Trotzdem wird der Be-
darf Deutschlands an Seefischen durch die heimische
Fischerei noch bei weitem nicht gedeckt, wir beziehen noch
Fische in großen Mengen vom Auslande, und so ist die
deutsche Hochseefischerei noch bedeutender Entwickelung
fähig.
Zugendlicker Uebermut.
(Zi'etie äcis kild ciul Zeile 537.)
enn die Korsofahrt durch die Champs Elysses ihr
Ende erreicht hat, und die vornehme Welt von Paris
bei Tisch sitzt, dann wird es still in den Promenaden
und Vergnügungsgärten der Weltstadt. Herumtreiber aber
giebt's überall, und das Geschlecht der Pariser Tauge-
nichtse hat keinen Respekt vor der Siestastimmung in den
Quartieren der Reichen. Längst ist Pierre, der Bäcker-
lehrling, unterwegs, seit er die frischen Tafelbrötchen
an Ort und Stelle abgegeben hat, und Paul, der Zeitungs-
junge, erfreut sich schon eine Weile der völlig entlasteten
Ledertasche. Aber das Herumtreiben können die Schlingel
nicht lassen! Pierre hat eine nur halbangerauchte Zigarette
auf einem der leeren Tischchen gefunden, die unter den
Bäumen vor dem Restaurant für Gäste besserer Art
stehen, hat sich den Stummel angezündet und pafft den
Ranch nun vergnügt in die Luft. Da sieht er Paul, der
mit dem grünen Papagei vor dem Schaufenster seinen
Schabernack treibt. Gleich wandelt ihn die Lust an, auch
seinerseits die Langmut des „Papchens" auf die Probe
zu stellen. Schnell fraternisiert er mit Paul — ja, gleich
und gleich gesellt sich gern! Beizenden Tabaksrauch sich
so frech ins Gesicht blasen lassen-, das kann aber auch
der geduldigste Papagei nicht vertragen. Wartet nur,
ihr Bösewichte! Wenn auch Paul den heftig fauchenden
Grünrock fest beim Schwanz gepackt hält, vielleicht wird
sich der Gequälte doch noch losreißen, und die heraus-
fordernd spitze Nase Pierres dürfte dann einen Denk-
zettel davontragen, der noch lange sichtbar bleibt.
Qis Vulkcinciusbriictie ciuk den Kleinen
Antillen.
Cislis dis 5 Lildsr au! Lsits 540 und 541.)
Hlulkanische Katastrophen sind in der westindischen Jnsel-
weit leider keine Seltenheit; eine so furchtbare Kata-
strophe, wie sie in der zweiten Maiwoche dieses Jahres
gleichzeitig die Kleinen Antilleninseln Martinique und
St. Vincent heimgesucht hat, kennt aber die ganze Ge-
schichte dieser vulkanischen Zone nicht. Die Vernichtung
der Hafenstadt St. Pierre aus Martinique durch den Aus-
bruch des Vulkans Mont Pelse ist überhaupt eine der
folgenschwersten vulkanischen Katastrophen, welche die
Weltgeschichte verzeichnet. St. Pierre war der größte
Ort der Insel, die seit 1814 dauernd zu Frankreich ge-
hört. Obgleich die Regierung den Sitz der Behörden
vor einiger Zeit nach dem 22 Kilometer entfernten Fort
de France verlegt hatte, war die bereits 1665 gegründete
Stadt der wichtigste Handelsplatz der Insel geblieben.
Der nahe Vulkan, dessen Krater ein kleiner See aus-
füllte, galt für ungefährlich und gerade dis reicheren
französischen Familien hatten sich an seinen Abhängen
ihre Landsitze erbaut. Die Stadt mit ihren Vororten
zählte über 36,000 Einwohner, darunter über 6000 Weiße.
Von diesen allen ist bei weitem die Mehrzahl umgekommen.
Wie viele sich auf die Schiffs flüchten konnten, wird man
kaum erfahren, denn bis auf den französischen Dampfer
„Suchet" und ein amerikanisches Fahrzeug gingen auch
sie zu Grunde. Gerade die Ausbrüche solcher Vulkane,
die nach längerer Ruhepause sich wieder öffnen, sind die
heftigsten. Durch die hochgradig gespannten, glühend
heißen Gase und Dampfmassen im Innern wird die hart
gewordene Gesteinskruste gesprengt; bei der Explosion
des Mont Pelse am 8. Mai, dem kleinere seitliche Aus-
brüche vorausgingen, entfaltete sich ein Luftdruck, der die
feurigen Gesteins- und Aschenmassen und den glühenden
Schlamm des Kratersees nicht nur mit furchtbarer Ge-
walt hinab in die Stadt, sondern auch weit hinaus in
das heiß aufstrudelnde Meer trieb. Eine größere Zahl
der Einwohner von St. Pierre konnte sich noch vor dem
Hauptausbruch nach Fort de France retten, wo auch die
Mehrzahl der flüchtigen Landbewohner eineZuflucht fand;
was jedoch um 8 Uhr morgens des schrecklichen Tages
noch in der Stadt weilte, siel dem Verderben anheim.
Der Feuer-, Aschen- und Steinauswurf des rasenden
Vulkans verbreitete sich über die ganze, durch ihre
Zuckerproduktion so wertvolle Insel mit verheerender
Wirkung; daher folgte der Schreckensnachricht von
der Zerstörung St. Pierres bald die weitere von der
drohenden Hungersnot in Fort de France. Das Weiter-
toben des Vulkans, aus dessen neuentstandenen Kratern
sich glühende Lavaströme nach allen Richtungen hin er-
gossen, hielt die am Leben gebliebenen Bewohner in be-
ständiger Panik. Erst am 10. Mai war der Hauptaus-
bruch beendet. -- Die Katastrophe auf St. Vincent hatte
einen ganz ähnlichen Charakter. Auch den alten Krater
der Soufriere füllte ein See aus. Am 6. Mai begann
der Berg vulkanische Regungen zu zeigen. Die eigent-
liche Explosion öffnete unter furchtbarem Dröhnen drei
Krater, aus denen sich sechs Lavaströme ergossen. Die
mit Schwefel angefüllte Luft war mit feinem Staub
geladen. Den Donner hörte man im ganzen Karaibischen
Meer. Auch hier vernichtete nicht nur die strömende
Lava, sondern mehr noch der Regen von glühender Asche
und schmelzendem Gestein weite Gebiete. Viele Pflan-
zungen und eine Anzahl von Dörfern wurden vollständig
zerstört. Auch auf St. Vincent, das alter britischer Besitz
ist, sind viele Menschenleben zu beklagen, die schon
wenige Tage nach der Hauptkatastrophe auf mehr als
2000 geschätzt wurden. Glücklicherweise blieb die Haupt-
stadt Kingstown von ihr verschont, der Luftdruck fegte
die Aschenwolken über die Stadt hin. Die Bevölkerung
befand sich aber während der furchtbaren Tage in be-
ständiger Angst, daß auch sie das Schicksal von St. Pierre
ereilen werde.
S-s 3m Zeverntumiel.
Crrcitilung von v. 8. Darren.
1.
Z uf der Waterloostation in London stand der
Zng znr Abfahrt nach Southampton fertig. Die
Zeitungsjungen liefen laut schreiend am Zug
entlang, nm die neuesten Nachmittagsblätter anzn-
bieten. Ans einem Wagenabteil erster Klasse lehnte
sich ein sonnengebrännter, ungefähr dreißigjähriger
Mann heraus, der sich zwei Zeitungen kaufte. Er
wollte sich auch sofort in die Lektüre derselben ver-
tiefen, als die Wagenthür noch einmal aufgerissen
wurde und unmittelbar vor der Abfahrt des Zuges
noch ein Reisender hineinsprang.
Er betrachtete den bisherigen Insassen einen Mo-
ment lang prüfend und rief dann freudig: „Hallo,
Lambert! Wo kommst denn du her? Ich denke,
dn bist in Australien!"
Der mit Lambert Angeredete sah auf. „Sieh da,
Jones!" versetzte er. „Welch unerwartetes Zu-
sammentreffen! Ja, lieber Freund, ich war in
Australien, habe Eisenbahnen gebaut und bin erst
seit vierzehn Tagen wieder in der Heimat."
„Und du gedenkst hoffentlich jetzt hier zu bleiben."
„Im Gegenteil, ich will nach Southampton und
von dort mit einem der anlanfenden Dampfer nach
Amerika. Was soll ich hier? Meine Angehörigen
sind sämtlich tot, meine Freunde sind für mich ver-
zollen, und hätte ich dich nicht zufällig hier ge-
troffen, so wäre ich in England gewefen, ohne eigent-
lich einen Bekannten zu sprechen."
„Ja, die Freunde, mit denen wir zusammen
studierten, lieber Lambert, sind in alle Welt zer-
streut"
„Das ist es ja! Man wird ganz und gar von
der Bekanntschaft losgelöst, wenn man lange im
Auslande lebt, und neue Bekanntschaften anzuknüpfen
paßt mir nicht. Also ich gehe nach Amerika und
hoffe, irgend eine Sache zu finden, die mich interessiert.
Dn weißt, meine Verhältnisse gestatten es mir, nach
! Wunsch zu leben, und ich habe ganz überflüssiger-
weise noch in Australien bedeutende Summen ver-
dient. Aber was thue ich damit? Das Leben hier-
ist mir höchst langweilig, und ich fürchte mich vor-
dem Ausbruch der Krisis. Du erinnerst dich vielleicht,
in unserer Familie sind schon verschiedene Personen
an der Langeweile zu Grunde gegangen."
(Uvckdruck verboten.)
Jones nickte verständnisvoll. Er wußte, daß die
Familie Lamberts an der englischen Nationalkrankheit,
dem Spleen, sehr stark litt; zwei nahe Verwandte
des Ingenieurs Lambert hatten sich erschossen, ledig-
lich aus Langeiveile, weil das Leben für sie keinen
Reiz mehr hatte. Er wußte, daß sein Frennd George
Lambert schon auf der Schule sich vor der Lange-
weile wie vor einem Gespenst fürchtete. Er war
ohne Zweifel erblich mit dem Spleen belastet.
Sollte das Erbübel bei dem so kräftigen Manne
schon zmn Ausbruch gekommen sein?
Es schien fast so. Jones gab daher dem Ge-
spräch eine möglichst heitere Wendung und trennte
sich nach halbstündiger Fahrt von dem Freunde, da
er in einem der Vororte von London wohnte.
Als Lambert allein war, nahm er die Zeitung
wieder vor und las, ohne der Landschaft, durch die
er fuhr, auch nur einen Blick zu schenken.
Sein Gesicht sah gelangweilt, gleichgültig und
verdrossen aus. Plötzlich aber belebten sich seine
Züge. Er hatte offenbar einen Artikel gefunden,
der ihn interessierte. Dieser Artikel trug die fett-
gedruckte Ueberschrift: „Die Tunnelarbeiten am Se-
vernflusse vernichtet!" und lautete: „New Passage,
7. Juni 1882. Was die einsichtsvollen Fachmänner-
schön erklärten, als das Riefenwerk des Tunnels
unter dem Severn unternommen wurde, hat sich
leider in traurigster Weise bestätigt. Seit gestern
ist in der nördlichen Tunnelseite, an welcher ebenso
ivie an der Südseite des Tunnels gleichzeitig ge-
arbeitet wird, ein Wasserdnrchbruch erfolgt, dem
sämtliche acht Arbeiter, die mit dem Bohren im
Tunnel beschäftigt waren, zum Opfer gefallen sind.
Mit ihnen starb einer der Ingenieure, und so kostet
der Tunnel bis jetzt siebzehn Menschenleben und
dreiviertel Millionen Pfund Sterling. Zwei große
Bankerotte hat er verursacht, und dreimal bereits ist
er voll Wasfer gelaufen. Der jetzige Einbruch hat
den Tunnel innerhalb weniger Stunden vollkommen
mit Wasser gefüllt, und man ist nicht einmal imstande
gewesen, die Leichen zu bergen. Der Hauptingenieur
des Tunnels, Thomas Walker, soll sich gestern abend
in seiner Wohnung erschossen haben. — Soweit unser
Korrespondent. Zur besseren Orientierung unserer
Leser, die sich unserer früheren Berichte vielleicht