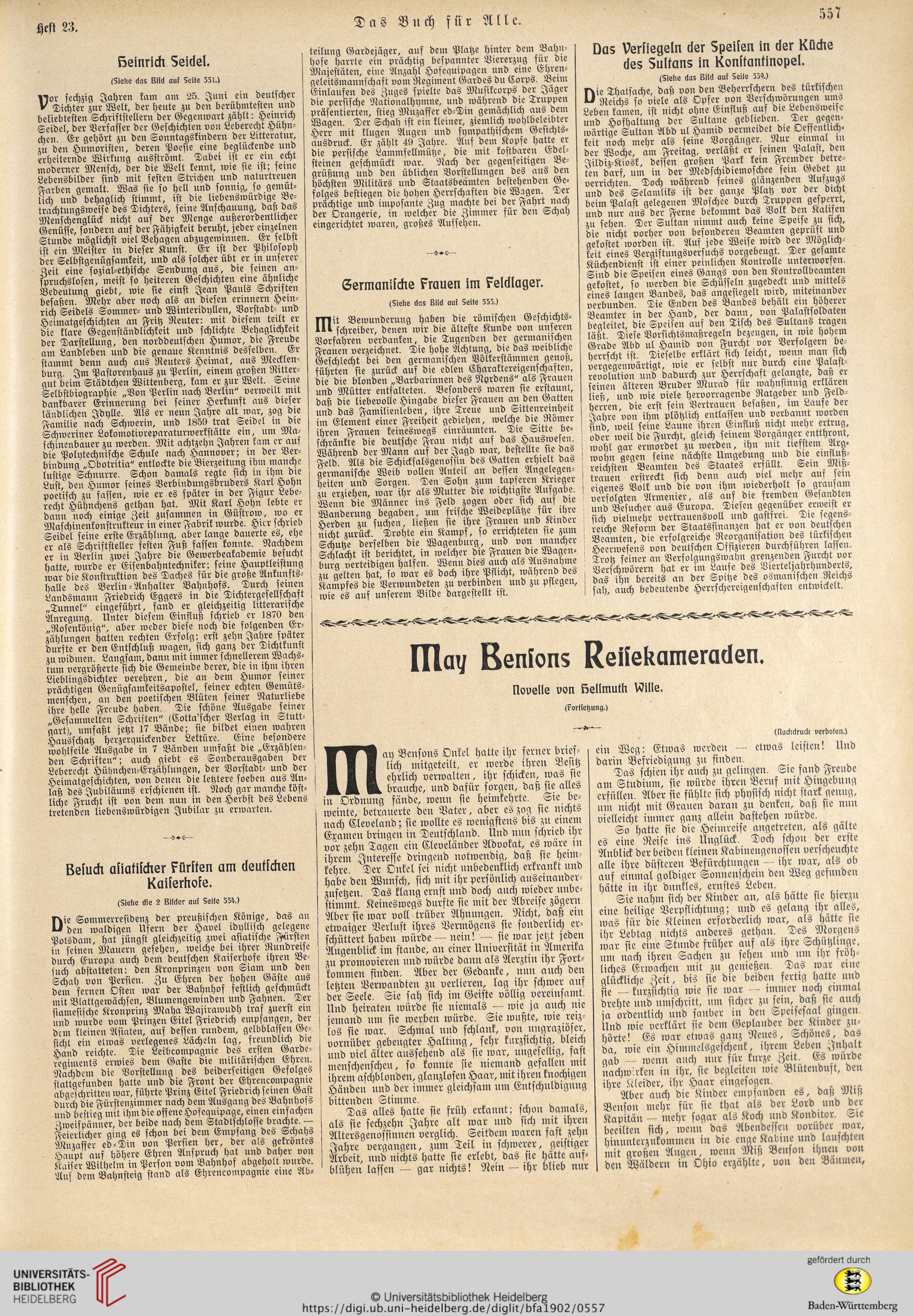Heft 23.
Das Buch für Alle.
ksinrick Zsi6sl.
Cicks üas KU6 auk 5e!ts 5Zly
Hlor sechzig Jahren kam am 25. Juni ein deutscher
V Dichter zur Welt, der heute zu den berühmtesten und
beliebtesten Schriftstellern der Gegenwart zählt: Heinrich
Seidel, der Verfasser der Geschichten von Leberecht Hühn-
chen. Er gehört zu den Sonntagskindern der Litteratur,
zu den Humoristen, deren Poesie eine beglückende und
erheiternde Wirkung ausströmt. Dabei ist er ein echt
moderner Mensch, der die Welt kennt, wie sie ist; seine
Lebensbilder sind mit festen Strichen und naturtreuen
Farben gemalt. Was sie so hell und sonnig, so gemüt-
lich und behaglich stimmt, ist die liebenswürdige Be-
trachtungsweise des Dichters, seine Anschauung, daß das
Menschenglück nicht auf der Menge außerordentlicher
Genüsse, sondern auf der Fähigkeit beruht, jeder einzelnen
Stunde möglichst viel Behagen abzugewinnen. Er selbst
ist ein Meister in dieser Kunst. Er ist der Philosoph
der Selbstgenügsamkeit, und als solcher übt er in unserer
Zeit eine sozial-ethische Sendung aus, die seinen an-
spruchslosen, meist so heiteren Geschichten eine ähnliche
Bedeutung giebt, wie sie einst Jean Pauls Schriften
besaßen. Mehr aber noch als an diesen erinnern Hein-
rich Seidels Sommer- und Winteridyllen, Vorstadt- und
Heimatgeschichten an Fritz Reuter: mit diesem teilt er
die klare Gegenständlichkeit und schlichte Behaglichkeit
der Darstellung, den norddeutschen Humor, die Freude
am Landleben und die genaue Kenntnis desselben. Er
stammt denn auch aus Reuters Heimat, aus Mecklen-
burg. Im Pastorenhaus zu Perlin, einem großen Ritter-
gut beim Städtchen Wittenberg, kam er zur Welt. Seine
Selbstbiographie „Von Perlin nach Berlin" verweilt mit
dankbarer Erinnerung bei seiner Herkunft aus dieser
ländlichen Idylle. Als er neun Jahre alt war, zog die
Familie nach Schwerin, und 1859 trat Seidel in die
Schweriner Lokomotivreparaturwerkstütte ein, um Ma-
schinenbauer zu werden. Mit achtzehn Jahren kam er auf
die Polytechnische Schule nach Hannover; in der Ver-
bindung „Obotritia" entlockte die Bierzeitung ihm manche
lustige Schnurre. Schon damals regte sich in ihm die
Lust, den Humor seines Verbindungsbruders Karl Hohn
poetisch zu fassen, wie er es später in der Figur Lebe-
recht Hühnchens gethan hat. Mit Karl Hohn lebte er
dann noch einige Zeit zusammen in Güstrow, wo er
Maschinenkonstrukleur in einer Fabrik wurde. Hier schrieb
Seidel seine erste Erzählung, aber lange dauerte es, ehe
er als Schriftsteller festen Fuß fassen konnte. Nachdem
er in Berlin zwei Jahre die Gewerbeakademie besucht
hatte, wurde er Eisenbahntechniker; seine Hauptleistung
war die Konstruktion des Daches für die große Ankunfts-
halle des Berlin-Anhalter Bahnhofs/ Durch seinen
Landsmann Friedrich Eggers in die Dichtergesellschaft
„Tunnel" eingeführt, fand er gleichzeitig lstterarische
Anregung. Unter diesem Einfluß schrieb er 1870 den
„Rosenkönig", aber weder diese noch die folgenden Er-
zählungen hatten rechten Erfolg; erst zehn Jahre später
durfte er den Entschluß wagen, sich ganz der Dichtkunst
zu widmen. Langsam, dann mit immer schnellerem Wachs-
lum vergrößerte sich die Gemeinde derer, die in ihm ihren
Lieblingsdichter verehren, die an dem Humor seiner
prächtigen Genügsamkeitsapostel, seiner echten Gemüts-
menschen, an den poetischen Blüten seiner Naturliebe
ihre Helle Freude haben. Die schöne Ausgabe seiner
„Gesammelten Schriften" (Cotta'scher Verlag in Stutt-
gart), umfaßt jetzt 17 Bände; sie bildet einen wahren
Hausschatz herzerquickender Lektüre. Eine besondere
wohlfeile Ausgabe in 7 Bänden umfaßt die „Erzählen-
den Schriften"; auch giebt es Sonderausgaben der
Leberecht Hühnchen-Erzählungen, der Vorstadt- und der
Heimatgeschichten, von denen die letztere soeben aus An-
laß des Jubiläums erschienen ist. Noch gar manche köst-
liche Frucht ist von dem nun in den Herbst des Lebens
tretenden liebenswürdigen Jubilar zu erwarten.
keluck ciljcitilcksr bürsten am 6euticksii
kciilsckoks.
(Zielie 6ie 2 kiläer auf Zeile 554.)
sXie Sommerresidenz der preußischen Könige, das an
den waldigen Ufern der Havel idyllisch gelegene
Potsdam, hat jüngst gleichzeitig zwei asiatische Fürsten
in seinen Mauern gesehen, welche bei ihrer Rundreise
durch Europa auch dem deutschen Kaiserhofe ihren Be-
such abstatteten: den Kronprinzen von Siam und den
Schah von Persien. Zu Ehren der hohen Gäste aus
dem fernen Osten war der Bahnhof festlich geschmückt
mit Blattgewächsen, Blumengewinden und Fahnen. Der
siamesische Kronprinz Maha Wajirawudh traf zuerst ein
und wurde vom Prinzen Eitel Friedrich empfangen, der
dem kleinen Asiaten, auf dessen rundem, gelbblassen Ge-
sicht ein etwas verlegenes Lächeln lag, freundlich die
Hand reichte. Die Leibcompagnie des ersten Garde-
regiments erwies dem Gaste die militärischen Ehren.
Nachdem die Vorstellung des beiderseitigen Gefolges
stattgefunden hatte und die Front der Ehrencompagnie
abgeschritten war, führte Prinz Eitel Friedrich seinen Gast
durch die Fürstenzimmer nach dem Ausgang des Bahnhofs
und bestieg mit ihm die offene Hofequipage, einen einfachen
Zweispänner, der beide nach dem Stadtschlosse brachte. —
Feierlicher ging es schon bei dem Empfang des Schahs
Muzaffer ed-Din von Persien her, der als gekröntes
Haupt auf höhere Ehren Anspruch hat und daher von
Kaiser Wilhelm in Person vom Bahnhof abgeholt wurde.
Auf dem Bahnsteig stand als Ehrencompagnie eine Ab-
557
teilung Gardejäger, auf dem Platze hinter dem Bahn-
hofe harrte ein prächtig bespannter Viererzug für die
Majestäten, eine Anzahl Hofequipagen und eine Ehren-
geleitsmannschaft vom Regiment Gardes du Corps. Beim
Einlaufen des Zuges spielte das Musikcorps der Jäger
die persische Nationalhymne, und während die Truppen
präsentierten, stieg Muzaffer ed-Din gemächlich aus dem
Wagen. Der Schah ist ein kleiner, ziemlich wohlbeleibter
Herr mit klugen Augen und sympathischem Gesichts-
ausdruck. Er zählt 49 Jahre. Auf dem Kopfe hatte er
die persische Lammfellmühe, die mit kostbaren Edel-
steinen geschmückt war. Nach der gegenseitigen Be-
grüßung und den üblichen Vorstellungen des aus den
höchsten Militärs und Staatsbeamten bestehenden Ge-
folges bestiegen die hohen Herrschaften die Wagen. Der
prächtige und imposante Zug machte bei der Fahrt nach
der Orangerie, in welcher die Zimmer für den Schah
eingerichtet waren, großes Aufsehen.
Sermamlclis trauen im ?sl6lcigsr.
tZiebe 6as kilä ciuk Zsits 555.)
sllit Bewunderung haben die römischen Geschichts-
H^schreiber, denen wir die älteste Kunde von unseren
Vorfahren verdanken, die Tugenden der germanischen
Frauen verzeichnet. Die hohe Achtung, die das weibliche
Geschlecht bei den germanischen Bölkerstämmen genoß,
führten sie zurück auf die edlen Charaktereigenschaften,
die die blonden „Barbarinnen des Nordens" als Frauen
und Mütter entfalteten. Besonders waren sie erstaunt,
daß die liebevolle Hingabe dieser Frauen an den Gatten
und das Familienleben, ihre Treue und Sittenreinheit
im Element einer Freiheit gediehen, welche die Römer
ihren Frauen keineswegs cinräumten. Die Sitte be-
schränkte die deutsche Frau nicht auf das Hauswesen.
Während der Mann auf der Jagd war, bestellte sie das
Feld. Als die Schicksalsgenossin des Gatten erhielt das
germanische Weib vollen Anteil an dessen Angelegen-
heiten und Sorgen. Den Sohn zum tapferen Krieger
zu erziehen, war ihr als Mutter die wichtigste Aufgabe.
Wenn die Männer ins Feld zogen oder sich auf die
Wanderung begaben, um frische Weideplätze für ihre
Herden zu suchen, ließen sie ihre Frauen und Kinder
nicht zurück. Drohte ein Kampf, so errichteten sie zum
Schutze derselben die Wagenburg, und von mancher
Schlacht ist berichtet, in welcher die Frauen die Wagen-
burg verteidigen halfen. Wenn dies auch als Ausnahme
zu gelten hat, so war es doch ihre Pflicht, während des
Kampfes die Verwundeten zu verbinden und zu pflegen,
wie es auf unserem Bilde dargcstellt ist.
Qcis Versiegeln 6er Zpeilen in 6sr Klicks
6er Zullcins in konllcintinopsl.
(Ziebe äaz Lilä ciuk Zeile 55Y.)
s>ie Thatsache, daß von den Beherrschern des türkischen
Reichs so viele als Opfer von Verschwörungen ums
Leben kamen, ist nicht ohne Einfluß auf die Lebensweise
und Hofhaltung der Sultane geblieben. Der gegen-
wärtige Sultan Abd ul Hamid vermeidet die Oeffentlich-
keit noch mehr als seine Vorgänger. Nur einmal in
der Woche, am Freitag, verläßt er seinen Palast, den
Jildiz-Kiosk, dessen großen Park kein Fremder betre-
ten darf, um in der Medschidiemoschee sein Gebet zu
verrichten. Doch während seines glänzenden Aufzugs
und des Selamliks ist der ganze Platz vor der dicht
beim Palast gelegenen Moschee durch Truppen gesperrt,
und nur aus der Ferne bekommt das Volk den Kalifen
zu sehen. Der Sultan nimmt auch keine Speise zu sich,
die nicht vorher von besonderen Beamten geprüft und
gekostet worden ist. Aus jede Weise wird der Möglich-
keit eines Vergiftungsversuchs vorgebeugt. Der gesamte
Küchendienst ist einer peinlichen Kontrolle unterworfen.
Sind die Speisen eines Gangs von den Kontrollbeamten
gekostet, so werden die Schüsseln zugedeckt und mittels
eines langen Bandes, das angesiegelt wird, miteinander-
verbunden. Die Enden des Bandes behält ein höherer
Beamter in der Hand, der dann, von Palastsoldaten
begleitet, die Speisen auf den Tisch des Sultans tragen
läßt. Diese Vorsichtsmaßregeln bezeugen, in wie hohem
Grade Abd ul Hamid von Furcht vor Verfolgern be-
herrscht ist. Dieselbe erklärt sich leicht, wenn man sich
vergegenwärtigt, wie er selbst nur durch eine Palast-
revolution und dadurch zur Herrschaft gelangte, daß er
seinen älteren Bruder Murad für wahnsinnig erklären
ließ, und wie viele hervorragende Ratgeber und Feld-
herren, die erst sein Vertrauen besaßen, im Laufe der
Jahre von ihm plötzlich entlassen und verbannt worden
sind, weil seine Laune ihren Einfluß nicht mehr ertrug,
oder weil die Furcht, gleich seinem Vorgänger entthront,
! wohl gar ermordet zu werden, ihn mit tiefstem Arg-
wohn gegen seine nächste Umgebung und die einfluß-
! reichsten Beamten des Staates erfüllt. Sein Miß-
trauen erstreckt sich denn auch viel mehr auf sein
: eigenes Volk und die von ihm wiederholt so grausam
verfolgten Armenier, als auf die fremden Gesandten
und Besucher aus Europa. Diesen gegenüber erweist er
sich vielmehr vertrauensvoll und gastfrei. Die segens-
reiche Reform der Staatsfinanzen hat er von deutschen
Beamten, die erfolgreiche Reorganisation des türkischen
Heerwesens von deutschen Offizieren durchführen lassen.
Trotz seiner an Verfolgungswahn grenzenden Furcht vor
Verschwörern hat er im Laufe des Vierteljahrhunderts,
! das ihn bereits an der Spitze des osmanische» Reichs
! sah, auch bedeutende Herrschereigenschaften entwickelt.
Ulal/ 8enion5 8eHekcnnerciclen.
llovslle von kellinutti Mle.
Cortkhung.)
au Bensons Onkel Halle ihr ferner brief-
I lich mitgetcilt, er werde ihren Besitz
I I ehrlich verwalten, ihr schicken, was sie
M M brauche, und dafür sorgen, daß sie alles
in Ordnung fände, wenn sie heimkehrte. Sie be-
weinte, betrauerte den Vater, aber es zog sie nichts
nach Cleveland; sie wollte es wenigstens bis zu einem
Examen bringen in Deutschland. Und nun schrieb ihr
vor zehn Tagen ein Cleveländer Advokat, es wäre in
ihrem Interesse dringend notwendig, daß sic heim-
kehre. Der Onkel sei nicht unbedenklich erkrankt und
habe den Wunsch, sich mit ihr persönlich auseinander-
zusetzen. Das klang ernst und doch auch wieder unbe-
stimmt. Keineswegs durfte sie mit der Abreise zögern
Aber sie war voll trüber Ahnungen. Nicht, daß ein
etwaiger Verlust ihres Vermögens sie sonderlich er-
schüttert haben würde — nein! — sie war jetzt jeden
Augenblick im stände, an einer Universität in Amerika
zu promovieren und würde dann als Aerztin ihr Fort-
kommen finden. Aber der Gedanke, nnn auch den
letzten Verwandten zu verlieren, lag ihr schwer auf
der Seele. Sie sah sich im Geiste völlig vereinsamt.
Und heiraten würde sie niemals — wie ja auch nie
jemand um sie werben würde. Sie wußte, wie reiz-
los sie war. Schmal und schlank, von ungraziöser,
vornüber gebeugter Haltung, sehr kurzsichtig, bleich
und viel älter aussehend als sie war, ungesellig, fast
menschenscheu, so konnte sie niemand gefallen mit
ihrem aschblonden, glanzlosen Haar, mit ihren knochigen
Händen und der immer gleichsam um Entschuldigung
bittenden Stimme.
Das alles hatte sie früh erkannt; schon damals,
als sie sechzehn Jahre alt war und sich mit ihren
Altersgenossinnen verglich. Seitdem waren fast zehn
Jahre vergangen, zum Teil in schwerer, geistiger
Arbeit, und nichts hatte sie erlebt, das sie hätte auf-
blühen lassen — gar nichts! Nein — ihr blieb nur
(Nciciläruck verboten.)
ein Weg: Etwas werden — etwas leisten! Und
darin Befriedigung zu finden.
Das schien ihr auch zu gelingen. Sie fand Freude
am Studium, sie würde ihren Beruf mit Hingebung
erfüllen. Aber sie fühlte sich physisch nicht stark genug,
um nicht mit Grauen daran zu denken, daß sie nun
vielleicht immer ganz allein dastehen würde.
So hatte sie die Heimreise angetreten, als gälte
es eine Reise ins llnglück. Doch schon der erste
Anblick der beiden kleinen Kabinengenossen verscheuchte
alle ihre düsteren Befürchtungen ihr war, als ob
auf einmal goldiger Sonnenschein den Weg gefunden
hätte in ihr dunkles, ernstes Leben.
Sie nahm sich der Kinder an, als hätte sie hierzn
eine heilige Verpflichtung; und es gelang ihr alles,
was für die Kleinen erforderlich war, als hätte sie
ihr Lebtag nichts anderes gethan. Des Morgens
war sie eine Stunde früher auf als ihre Schützlinge,
um uach ihren Sachen zu sehen und um ihr fröh-
liches Erwachen mit zu genieße». Das war eine
glückliche Zeit, bis sie die beiden fertig hatte und
sie —kurzsichtig wie sie war -- immer noch einmal
drehte und umschritt, um sicher zu sein, daß sie auch
ja ordentlich und sauber in den Speisesaal gingen.
Und wie verklärt sie dem Geplauder der Kinder zu-
hörte! Es war etwas ganz Neues, Schönes, das
da, wie ein Himmelsgeschenk, ihrem Leben Inhalt
gab — wenn auch nur für kurze Zeit. Es würde
nachnurken in ihr, sie begleiten wie Blütenduft, den
ihre Kleider, ihr Haar eingesogen.
Aber auch die Kinder empfanden es, daß Miß
Beusou mehr für sie that als der Lord und der
Kapitän — mehr sogar als Koch und Konditor. Sie
beeilten sich, wenn das Abendessen vorüber war,
hinunterzukommen in die enge Kabine und lauschten
mit großen Augen, wenn Miß Benson ihnen von
den Wäldern in Ohio erzählte, von den Bäumen,
Das Buch für Alle.
ksinrick Zsi6sl.
Cicks üas KU6 auk 5e!ts 5Zly
Hlor sechzig Jahren kam am 25. Juni ein deutscher
V Dichter zur Welt, der heute zu den berühmtesten und
beliebtesten Schriftstellern der Gegenwart zählt: Heinrich
Seidel, der Verfasser der Geschichten von Leberecht Hühn-
chen. Er gehört zu den Sonntagskindern der Litteratur,
zu den Humoristen, deren Poesie eine beglückende und
erheiternde Wirkung ausströmt. Dabei ist er ein echt
moderner Mensch, der die Welt kennt, wie sie ist; seine
Lebensbilder sind mit festen Strichen und naturtreuen
Farben gemalt. Was sie so hell und sonnig, so gemüt-
lich und behaglich stimmt, ist die liebenswürdige Be-
trachtungsweise des Dichters, seine Anschauung, daß das
Menschenglück nicht auf der Menge außerordentlicher
Genüsse, sondern auf der Fähigkeit beruht, jeder einzelnen
Stunde möglichst viel Behagen abzugewinnen. Er selbst
ist ein Meister in dieser Kunst. Er ist der Philosoph
der Selbstgenügsamkeit, und als solcher übt er in unserer
Zeit eine sozial-ethische Sendung aus, die seinen an-
spruchslosen, meist so heiteren Geschichten eine ähnliche
Bedeutung giebt, wie sie einst Jean Pauls Schriften
besaßen. Mehr aber noch als an diesen erinnern Hein-
rich Seidels Sommer- und Winteridyllen, Vorstadt- und
Heimatgeschichten an Fritz Reuter: mit diesem teilt er
die klare Gegenständlichkeit und schlichte Behaglichkeit
der Darstellung, den norddeutschen Humor, die Freude
am Landleben und die genaue Kenntnis desselben. Er
stammt denn auch aus Reuters Heimat, aus Mecklen-
burg. Im Pastorenhaus zu Perlin, einem großen Ritter-
gut beim Städtchen Wittenberg, kam er zur Welt. Seine
Selbstbiographie „Von Perlin nach Berlin" verweilt mit
dankbarer Erinnerung bei seiner Herkunft aus dieser
ländlichen Idylle. Als er neun Jahre alt war, zog die
Familie nach Schwerin, und 1859 trat Seidel in die
Schweriner Lokomotivreparaturwerkstütte ein, um Ma-
schinenbauer zu werden. Mit achtzehn Jahren kam er auf
die Polytechnische Schule nach Hannover; in der Ver-
bindung „Obotritia" entlockte die Bierzeitung ihm manche
lustige Schnurre. Schon damals regte sich in ihm die
Lust, den Humor seines Verbindungsbruders Karl Hohn
poetisch zu fassen, wie er es später in der Figur Lebe-
recht Hühnchens gethan hat. Mit Karl Hohn lebte er
dann noch einige Zeit zusammen in Güstrow, wo er
Maschinenkonstrukleur in einer Fabrik wurde. Hier schrieb
Seidel seine erste Erzählung, aber lange dauerte es, ehe
er als Schriftsteller festen Fuß fassen konnte. Nachdem
er in Berlin zwei Jahre die Gewerbeakademie besucht
hatte, wurde er Eisenbahntechniker; seine Hauptleistung
war die Konstruktion des Daches für die große Ankunfts-
halle des Berlin-Anhalter Bahnhofs/ Durch seinen
Landsmann Friedrich Eggers in die Dichtergesellschaft
„Tunnel" eingeführt, fand er gleichzeitig lstterarische
Anregung. Unter diesem Einfluß schrieb er 1870 den
„Rosenkönig", aber weder diese noch die folgenden Er-
zählungen hatten rechten Erfolg; erst zehn Jahre später
durfte er den Entschluß wagen, sich ganz der Dichtkunst
zu widmen. Langsam, dann mit immer schnellerem Wachs-
lum vergrößerte sich die Gemeinde derer, die in ihm ihren
Lieblingsdichter verehren, die an dem Humor seiner
prächtigen Genügsamkeitsapostel, seiner echten Gemüts-
menschen, an den poetischen Blüten seiner Naturliebe
ihre Helle Freude haben. Die schöne Ausgabe seiner
„Gesammelten Schriften" (Cotta'scher Verlag in Stutt-
gart), umfaßt jetzt 17 Bände; sie bildet einen wahren
Hausschatz herzerquickender Lektüre. Eine besondere
wohlfeile Ausgabe in 7 Bänden umfaßt die „Erzählen-
den Schriften"; auch giebt es Sonderausgaben der
Leberecht Hühnchen-Erzählungen, der Vorstadt- und der
Heimatgeschichten, von denen die letztere soeben aus An-
laß des Jubiläums erschienen ist. Noch gar manche köst-
liche Frucht ist von dem nun in den Herbst des Lebens
tretenden liebenswürdigen Jubilar zu erwarten.
keluck ciljcitilcksr bürsten am 6euticksii
kciilsckoks.
(Zielie 6ie 2 kiläer auf Zeile 554.)
sXie Sommerresidenz der preußischen Könige, das an
den waldigen Ufern der Havel idyllisch gelegene
Potsdam, hat jüngst gleichzeitig zwei asiatische Fürsten
in seinen Mauern gesehen, welche bei ihrer Rundreise
durch Europa auch dem deutschen Kaiserhofe ihren Be-
such abstatteten: den Kronprinzen von Siam und den
Schah von Persien. Zu Ehren der hohen Gäste aus
dem fernen Osten war der Bahnhof festlich geschmückt
mit Blattgewächsen, Blumengewinden und Fahnen. Der
siamesische Kronprinz Maha Wajirawudh traf zuerst ein
und wurde vom Prinzen Eitel Friedrich empfangen, der
dem kleinen Asiaten, auf dessen rundem, gelbblassen Ge-
sicht ein etwas verlegenes Lächeln lag, freundlich die
Hand reichte. Die Leibcompagnie des ersten Garde-
regiments erwies dem Gaste die militärischen Ehren.
Nachdem die Vorstellung des beiderseitigen Gefolges
stattgefunden hatte und die Front der Ehrencompagnie
abgeschritten war, führte Prinz Eitel Friedrich seinen Gast
durch die Fürstenzimmer nach dem Ausgang des Bahnhofs
und bestieg mit ihm die offene Hofequipage, einen einfachen
Zweispänner, der beide nach dem Stadtschlosse brachte. —
Feierlicher ging es schon bei dem Empfang des Schahs
Muzaffer ed-Din von Persien her, der als gekröntes
Haupt auf höhere Ehren Anspruch hat und daher von
Kaiser Wilhelm in Person vom Bahnhof abgeholt wurde.
Auf dem Bahnsteig stand als Ehrencompagnie eine Ab-
557
teilung Gardejäger, auf dem Platze hinter dem Bahn-
hofe harrte ein prächtig bespannter Viererzug für die
Majestäten, eine Anzahl Hofequipagen und eine Ehren-
geleitsmannschaft vom Regiment Gardes du Corps. Beim
Einlaufen des Zuges spielte das Musikcorps der Jäger
die persische Nationalhymne, und während die Truppen
präsentierten, stieg Muzaffer ed-Din gemächlich aus dem
Wagen. Der Schah ist ein kleiner, ziemlich wohlbeleibter
Herr mit klugen Augen und sympathischem Gesichts-
ausdruck. Er zählt 49 Jahre. Auf dem Kopfe hatte er
die persische Lammfellmühe, die mit kostbaren Edel-
steinen geschmückt war. Nach der gegenseitigen Be-
grüßung und den üblichen Vorstellungen des aus den
höchsten Militärs und Staatsbeamten bestehenden Ge-
folges bestiegen die hohen Herrschaften die Wagen. Der
prächtige und imposante Zug machte bei der Fahrt nach
der Orangerie, in welcher die Zimmer für den Schah
eingerichtet waren, großes Aufsehen.
Sermamlclis trauen im ?sl6lcigsr.
tZiebe 6as kilä ciuk Zsits 555.)
sllit Bewunderung haben die römischen Geschichts-
H^schreiber, denen wir die älteste Kunde von unseren
Vorfahren verdanken, die Tugenden der germanischen
Frauen verzeichnet. Die hohe Achtung, die das weibliche
Geschlecht bei den germanischen Bölkerstämmen genoß,
führten sie zurück auf die edlen Charaktereigenschaften,
die die blonden „Barbarinnen des Nordens" als Frauen
und Mütter entfalteten. Besonders waren sie erstaunt,
daß die liebevolle Hingabe dieser Frauen an den Gatten
und das Familienleben, ihre Treue und Sittenreinheit
im Element einer Freiheit gediehen, welche die Römer
ihren Frauen keineswegs cinräumten. Die Sitte be-
schränkte die deutsche Frau nicht auf das Hauswesen.
Während der Mann auf der Jagd war, bestellte sie das
Feld. Als die Schicksalsgenossin des Gatten erhielt das
germanische Weib vollen Anteil an dessen Angelegen-
heiten und Sorgen. Den Sohn zum tapferen Krieger
zu erziehen, war ihr als Mutter die wichtigste Aufgabe.
Wenn die Männer ins Feld zogen oder sich auf die
Wanderung begaben, um frische Weideplätze für ihre
Herden zu suchen, ließen sie ihre Frauen und Kinder
nicht zurück. Drohte ein Kampf, so errichteten sie zum
Schutze derselben die Wagenburg, und von mancher
Schlacht ist berichtet, in welcher die Frauen die Wagen-
burg verteidigen halfen. Wenn dies auch als Ausnahme
zu gelten hat, so war es doch ihre Pflicht, während des
Kampfes die Verwundeten zu verbinden und zu pflegen,
wie es auf unserem Bilde dargcstellt ist.
Qcis Versiegeln 6er Zpeilen in 6sr Klicks
6er Zullcins in konllcintinopsl.
(Ziebe äaz Lilä ciuk Zeile 55Y.)
s>ie Thatsache, daß von den Beherrschern des türkischen
Reichs so viele als Opfer von Verschwörungen ums
Leben kamen, ist nicht ohne Einfluß auf die Lebensweise
und Hofhaltung der Sultane geblieben. Der gegen-
wärtige Sultan Abd ul Hamid vermeidet die Oeffentlich-
keit noch mehr als seine Vorgänger. Nur einmal in
der Woche, am Freitag, verläßt er seinen Palast, den
Jildiz-Kiosk, dessen großen Park kein Fremder betre-
ten darf, um in der Medschidiemoschee sein Gebet zu
verrichten. Doch während seines glänzenden Aufzugs
und des Selamliks ist der ganze Platz vor der dicht
beim Palast gelegenen Moschee durch Truppen gesperrt,
und nur aus der Ferne bekommt das Volk den Kalifen
zu sehen. Der Sultan nimmt auch keine Speise zu sich,
die nicht vorher von besonderen Beamten geprüft und
gekostet worden ist. Aus jede Weise wird der Möglich-
keit eines Vergiftungsversuchs vorgebeugt. Der gesamte
Küchendienst ist einer peinlichen Kontrolle unterworfen.
Sind die Speisen eines Gangs von den Kontrollbeamten
gekostet, so werden die Schüsseln zugedeckt und mittels
eines langen Bandes, das angesiegelt wird, miteinander-
verbunden. Die Enden des Bandes behält ein höherer
Beamter in der Hand, der dann, von Palastsoldaten
begleitet, die Speisen auf den Tisch des Sultans tragen
läßt. Diese Vorsichtsmaßregeln bezeugen, in wie hohem
Grade Abd ul Hamid von Furcht vor Verfolgern be-
herrscht ist. Dieselbe erklärt sich leicht, wenn man sich
vergegenwärtigt, wie er selbst nur durch eine Palast-
revolution und dadurch zur Herrschaft gelangte, daß er
seinen älteren Bruder Murad für wahnsinnig erklären
ließ, und wie viele hervorragende Ratgeber und Feld-
herren, die erst sein Vertrauen besaßen, im Laufe der
Jahre von ihm plötzlich entlassen und verbannt worden
sind, weil seine Laune ihren Einfluß nicht mehr ertrug,
oder weil die Furcht, gleich seinem Vorgänger entthront,
! wohl gar ermordet zu werden, ihn mit tiefstem Arg-
wohn gegen seine nächste Umgebung und die einfluß-
! reichsten Beamten des Staates erfüllt. Sein Miß-
trauen erstreckt sich denn auch viel mehr auf sein
: eigenes Volk und die von ihm wiederholt so grausam
verfolgten Armenier, als auf die fremden Gesandten
und Besucher aus Europa. Diesen gegenüber erweist er
sich vielmehr vertrauensvoll und gastfrei. Die segens-
reiche Reform der Staatsfinanzen hat er von deutschen
Beamten, die erfolgreiche Reorganisation des türkischen
Heerwesens von deutschen Offizieren durchführen lassen.
Trotz seiner an Verfolgungswahn grenzenden Furcht vor
Verschwörern hat er im Laufe des Vierteljahrhunderts,
! das ihn bereits an der Spitze des osmanische» Reichs
! sah, auch bedeutende Herrschereigenschaften entwickelt.
Ulal/ 8enion5 8eHekcnnerciclen.
llovslle von kellinutti Mle.
Cortkhung.)
au Bensons Onkel Halle ihr ferner brief-
I lich mitgetcilt, er werde ihren Besitz
I I ehrlich verwalten, ihr schicken, was sie
M M brauche, und dafür sorgen, daß sie alles
in Ordnung fände, wenn sie heimkehrte. Sie be-
weinte, betrauerte den Vater, aber es zog sie nichts
nach Cleveland; sie wollte es wenigstens bis zu einem
Examen bringen in Deutschland. Und nun schrieb ihr
vor zehn Tagen ein Cleveländer Advokat, es wäre in
ihrem Interesse dringend notwendig, daß sic heim-
kehre. Der Onkel sei nicht unbedenklich erkrankt und
habe den Wunsch, sich mit ihr persönlich auseinander-
zusetzen. Das klang ernst und doch auch wieder unbe-
stimmt. Keineswegs durfte sie mit der Abreise zögern
Aber sie war voll trüber Ahnungen. Nicht, daß ein
etwaiger Verlust ihres Vermögens sie sonderlich er-
schüttert haben würde — nein! — sie war jetzt jeden
Augenblick im stände, an einer Universität in Amerika
zu promovieren und würde dann als Aerztin ihr Fort-
kommen finden. Aber der Gedanke, nnn auch den
letzten Verwandten zu verlieren, lag ihr schwer auf
der Seele. Sie sah sich im Geiste völlig vereinsamt.
Und heiraten würde sie niemals — wie ja auch nie
jemand um sie werben würde. Sie wußte, wie reiz-
los sie war. Schmal und schlank, von ungraziöser,
vornüber gebeugter Haltung, sehr kurzsichtig, bleich
und viel älter aussehend als sie war, ungesellig, fast
menschenscheu, so konnte sie niemand gefallen mit
ihrem aschblonden, glanzlosen Haar, mit ihren knochigen
Händen und der immer gleichsam um Entschuldigung
bittenden Stimme.
Das alles hatte sie früh erkannt; schon damals,
als sie sechzehn Jahre alt war und sich mit ihren
Altersgenossinnen verglich. Seitdem waren fast zehn
Jahre vergangen, zum Teil in schwerer, geistiger
Arbeit, und nichts hatte sie erlebt, das sie hätte auf-
blühen lassen — gar nichts! Nein — ihr blieb nur
(Nciciläruck verboten.)
ein Weg: Etwas werden — etwas leisten! Und
darin Befriedigung zu finden.
Das schien ihr auch zu gelingen. Sie fand Freude
am Studium, sie würde ihren Beruf mit Hingebung
erfüllen. Aber sie fühlte sich physisch nicht stark genug,
um nicht mit Grauen daran zu denken, daß sie nun
vielleicht immer ganz allein dastehen würde.
So hatte sie die Heimreise angetreten, als gälte
es eine Reise ins llnglück. Doch schon der erste
Anblick der beiden kleinen Kabinengenossen verscheuchte
alle ihre düsteren Befürchtungen ihr war, als ob
auf einmal goldiger Sonnenschein den Weg gefunden
hätte in ihr dunkles, ernstes Leben.
Sie nahm sich der Kinder an, als hätte sie hierzn
eine heilige Verpflichtung; und es gelang ihr alles,
was für die Kleinen erforderlich war, als hätte sie
ihr Lebtag nichts anderes gethan. Des Morgens
war sie eine Stunde früher auf als ihre Schützlinge,
um uach ihren Sachen zu sehen und um ihr fröh-
liches Erwachen mit zu genieße». Das war eine
glückliche Zeit, bis sie die beiden fertig hatte und
sie —kurzsichtig wie sie war -- immer noch einmal
drehte und umschritt, um sicher zu sein, daß sie auch
ja ordentlich und sauber in den Speisesaal gingen.
Und wie verklärt sie dem Geplauder der Kinder zu-
hörte! Es war etwas ganz Neues, Schönes, das
da, wie ein Himmelsgeschenk, ihrem Leben Inhalt
gab — wenn auch nur für kurze Zeit. Es würde
nachnurken in ihr, sie begleiten wie Blütenduft, den
ihre Kleider, ihr Haar eingesogen.
Aber auch die Kinder empfanden es, daß Miß
Beusou mehr für sie that als der Lord und der
Kapitän — mehr sogar als Koch und Konditor. Sie
beeilten sich, wenn das Abendessen vorüber war,
hinunterzukommen in die enge Kabine und lauschten
mit großen Augen, wenn Miß Benson ihnen von
den Wäldern in Ohio erzählte, von den Bäumen,