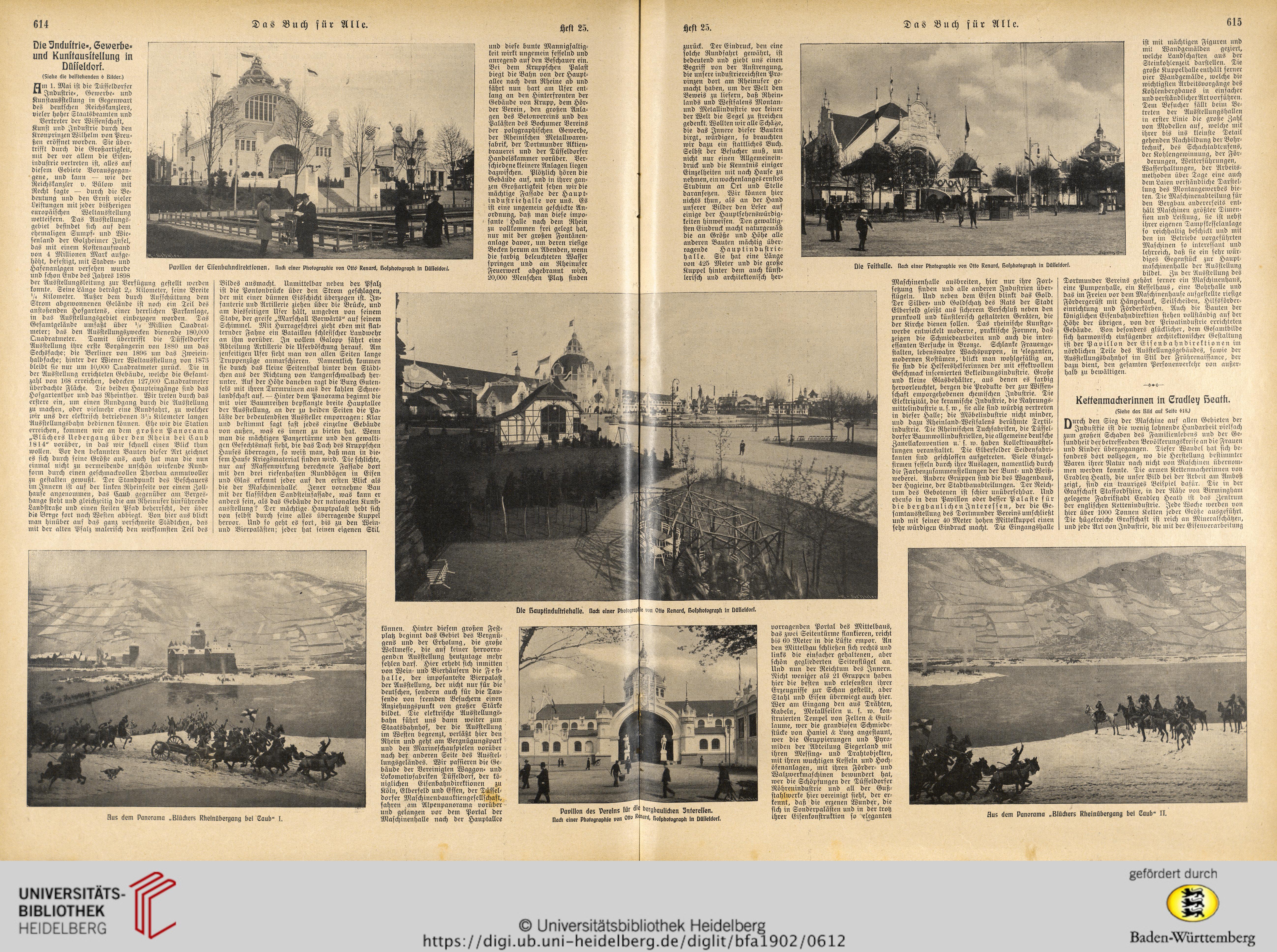614
Das Buch für Alle.
Das Buch für Alle.
615
Heft 85.
Heft 25.
ktu; dem Panorama Klucker; lliieinübergang bei Laub" I.
können. Hinter diesem großen Fest-
platz beginnt das Gebiet des Vergnü-
gens und der Erholung, die große
Weltmesse, die auf keiner hervorra-
genden Ausstellung heutzutage mehr
fehlen darf. Hier erhebt sich inmitten
von Wein- und Bierhäusern die F e st-
halle, der imposanteste Bierpalast
der Ausstellung, der nicht nur für die
deutschen, sondern auch für die Tau-
sende von fremden Besuchern einen
Anziehungspunkt von großer Stärke
bildet. Die elektrische Ausstellungs-
bahn führt uns dann weiter zum
Staatsbahnhof, der die Ausstellung
im Westen begrenzt, verläßt hier den
Rhein und geht am Vergnügungspark
und den Marineschauspielen vorüber
nach der anderen Seite des Ausstel-
lungsgeländes. Wir passieren die Ge-
bäude der Vereinigten Waggon- und
Lokomotivfabriken Düsseldorf, der kö-
niglichen Eisenbahndirektionen zu
Köln, Elberfeld und Essen, der Düssel-
dorfer Maschincnbauaktiengesellschaft,
fahren .am Alpenpanorama vorüber
und gelangen vor dem Portal der
Maschinenhalle nach der Hauptallee
vorragenden Portal des Mittelbaus,
das zwei Seitentürme flankieren, reicht
bis 60 Meter in die Lüfte empor. An
den Mittelbau schließen sich rechts und
links die einfacher gehaltenen, aber
schön gegliederten Seitenflügel an.
Und nun der Reichtum des Innern.
Nicht weniger als 21 Gruppen haben
hier die besten und erlesensten ihrer
Erzeugnisse zur Schau gestellt, aber
Stahl und Eisen überwiegt auch hier.
Wer am Eingang den aus Drähten,
Kabeln, Metallseilen u. s. w. kon-
struierten Tempel von Felten L Guil-
laume, wer die grandiosen Schmiede-
stücke von Hamel L Lueg angestaunt,
wer die Gruppierungen und Pyra-
miden der Abteilung Siegerland mit
ihren Messing- und Drahtobjekten,
mit ihren wuchtigen Kesseln und Hoch-
öfenanlagen, mit ihren Förder- und
Walzmerkmaschinen bewundert hat,
wer die Schöpfungen der Düsseldorfer
Röhrenindustrie und all der Guß-
stahlwerke hier vereinigt sieht, der er-
kennt, daß die erzenen Wunder, die
sich in Sonderpalästen und in der trotz
ihrer Eisenkonstruktion so eleganten
Ku; dem Panorama „Klucker; kiieinübergang bei Laub" 17.
i—
Pavillon der Lilenbalmdirektlonen. Nack einer piuNograpiue von Silo kenard, löokptiotogravtl in Nülleidoir.
Bildes ausmacht. Unmittelbar neben der Pfalz
ist die Pontonbrücke über den Strom geschlagen,
der mit einer dünnen Eisschicht überzogen ist. In-
fanterie und Artillerie ziehen über die Brücke, und
am diesseitigen Ufer hält, umgeben von seinem
Stabe, der greise „Marschall Vorwärts" auf seinem
Schimmel. Mit Hurrageschrei zieht eben mit flat-
ternder Fahne ein Bataillon schlesischer Landwehr
an ihm vorüber. In vollem Galopp fährt eine
Abteilung Artillerie die Uferböschung herauf. Am
jenseitigen Ufer sieht man von allen Seiten lange
Truppenzüge anmarschieren. Namentlich kommen
sie durch das kleine Seitenthal hinter dem Städt-
chen aus der Richtung von Langenschwalbach her-
unter. Auf der Höhe daneben ragt die Burg Guten-
fels mit ihren Turmruinen aus der kahlen Schnee-
landschaft auf. — Hinter dem Panorama beginnt die
mit vier Baumreihen bepflanzte breite Hauptallee
der Ausstellung, an der zu beiden Seiten die Pa-
läste der bedeutendsten Aussteller emporragen: Klar
und bestimmt sagt fast jedes einzelne Gebäude
von außen, was es innen zu bieten hat. Wenn
man die mächtigen Panzertürme und den gewalti-
gen Gefechtsmast sieht, die das Dach des Kruppschen
Hauses überragen, so weiß man, daß man in die-
sem Hause Kriegsmaterial finden wird. Die schlichte,
nur auf Massenwirkung berechnete Fassade dort
mit den drei riesenhaften Rundbögen in Eisen
und Glas erkennt jeder ans den ersten Blick als
die der Maschinenhalle. Jener vornehme Bau
mit der klassischen Sandsteinfassade, was kann er
anders sein, als das Gebäude der nationalen Kunst-
ausstellung? Der mächtige Hauptpalast hebt sich
von selbst durch seine alles überragende Kuppel
hervor. Und so geht es fort, bis zu den Wein-
und Bierpalästen; jeder hat seinen eigenen Stil
Dis Zncluitris., Ssnerbe-
unl! liunllciuzltslluiig in
lllilssläork.
Eielie die beiNeksnden b Nilder.)
12m 1. Mai ist die Düsseldorfer
Industrie-, Gewerbe- und
Kunstausstellung in Gegenwart
des deutschen ' Reichskanzlers,
vieler hoher Staatsbeamten und
Vertreter der Wissenschaft,
Kunst und Industrie durch den
Kronprinzen Wilhelm von Preu¬
ßen eröffnet worden. Sie über¬
trifft durch die Großartigkeit,
mit der vor allem die Eisen¬
industrie vertreten ist, alles auf
diesem Gebiete Vorausgegan¬
gene, und kann — wie der
Reichskanzler v. Bülow mit
Recht sagte — durch die Be¬
deutung und den Ernst vieler
Leistungen mit jeder bisherigen
europäischen Weltausstellung
wetteifern. Das Ausstellungs¬
gebiet befindet sich auf dem
ehemaligen Sumpf- und Wie¬
senland der Golzheimer Insel,
das mit einem Kostenaufwand
von 4 Millionen Mark ausge¬
höht, befestigt, mit Staden- und
Hafenanlagen versehen wurde
und schon Ende des Jahres 1898
der Ausstellungsleitung zur Verfügung gestellt werden
konnte. Seine Länge beträgt 2,r Kilometer, seine Breite
'/c Kilometer. Außer dem durch Aufschüttung dem
Strom abgewonnenen Gelände ist noch ein Teil des
anstoßenden Hofgartens, einer herrlichen Parkanlage,
in das Ausstellungsgebiet einbezogen worden. Das
Gesamtgelände umfaßt über Million Quadrat-
meter; das deu Ausstellungszwecken dienende 180,000
Quadratmeter. Damit übertrifft die Düsseldorfer
Ausstellung ihre erste Vorgängerin von 1880 um das
Sechsfache; die Berliner von 1896 um das Zweiein-
halbfache; hinter der Wiener Weltausstellung von 1873
bleibt sie nur um 10,000 Quadratmeter zurück. Die in
der Ausstellung errichteten Gebäude, welche die Gesamt-
zahl von 168 erreichen, bedecken 127,000 Quadratmeter
überdachte Fläche. Die beiden Haupteingänge sind das
Hofgartenthor und das Rheinthor. Wir treten durch das
erstere ein, um einen Nundgang durch die Ausstellung
zu machen, oder vielniehr eine Rundfahrt, zu welcher
wir uns der elektrisch betriebenen 3' s Kilometer langen
Ausstellungsbahn bedienen können. Ehe wir die Station
erreichen, kommen wir an dem großen Panorama
„Blüchers Uebergang über den Rhein bei Laub
1814" vorüber, in das wir schnell einen Blick thun
wollen. Vor den bekannten Bauten dieser Art zeichnet
es sich durch seine Größe aus, auch hat man die nun
einmal nicht zu vermeidende unschön wirkende Rund-
form durch einen geschmackvollen Thorbau anmutvoller
zu gestalten gewußt. Der Standpunkt des Beschauers
im Innern ist auf der linken Rheinseite vor einem Zoll-
hause angenommen, das Caub gegenüber am Berges-
hange steht und gleichzeitig die am Rheinufer hinführende
Landstraße und einen steilen Pfad beherrscht, der über
die Berge fort nach Westen abbiegt. Von hier aus blickt
man hinüber auf das ganz verschneite Städtchen, das
mit der alten Pfalz malerisch den wirksamsten Teil des
zurück. Der Eindruck, den eine
solche Rundfahrt gewährt, ist
bedeutend und giebt uns einen
Begriff von der Anstrengung,
die unsere industriereichsten Pro-
vinzen dort am Rheinufer ge-
macht haben, um der Welt den
Beweis zu liefern, daß Rhein-
lands und Westfalens Montan-
und Metallindustrie vor keiner
der Welt die Segel zu streichen
gedenkt. Wollten wir alle Schätze,
die das Innere dieser Bauten
birgt, würdigen, so brauchten
wir dazu ein stattliches Buch.
Selbst der Besucher muß, um
nicht nur einen Allgemeinein-
drück und die Kenntnis einiger
Einzelheiten mit nach Hause zu
nehmen, ein wochenlanges ernstes
Studium an Ort und Stelle
daransetzen. Wir können hier
nichts thun, als an der Hand
unserer Bilder den Leser auf
einige der Hauptsehenswürdig-
keiten Hinweisen. Den gewaltig-
sten Eindruck macht naturgemäß
die an Größe und Höhe alle
anderen Bauten mächtig über-
ragende Hauptindustrie-
halle. Sie hat eine Länge
von 425 Meter und die große
Kuppel hinter dem auch künst-
lerisch und architektonisch her-
llle rsittuille. Nack einer Pkowgraplue von Otto Nenard, köokpttotogravk in l>ül!el6ori.
Maschinenhalle ausbreiten, hier nur ihre Fort-
setzung finden und alle anderen Industrien über-
flügeln. Und neben dem Eisen blinkt das Gold.
Der Silber- und Goldschatz des Rats der Stadt
Elberfeld gleißt aus sicherem Verschluß neben den
prunkvoll und künstlerisch gestalteten Geräten, die
der Kirche dienen sollen. Das rheinische Kunstge-
werbe entwickelt moderne, praktische Formen, das
zeigen dis Schmiedearbeiten und auch die inter-
essanten Versuche in Bronze. Schlanke Frauenge-
stalten, lebenswahre Wachspuppen, in 'eleganten,
modernen Kostümen, blickt man wohlgefällig an,
sie sind die Helfershelferinnen der mit effektvollem
Geschmack inscenierten Bekleidungsindustrie. Große
und kleine Glasbehälter, aus denen es farbig
hervorleuchtet, bergen die Produkte der zur Wissen-
schaft emporgehobeneu chemischen Industrie. Die
Elektrizität, die keramische Industrie, die Nahrungs-
mittelindustrie u.s. w , sie alle sind würdig vertreten
in dieser Halle; die Möbelindustrie nicht minder,
und dazu Rheinland-Westfalens berühmte Textil-
industrie. Die Rheinischen Tuchfabriken, die Düssel-
dorfer Baumwollindustriellen, die allgemeine deutsche
Zanellakonvention u. s. w. haben Kollektivausstel-
lungen veranstaltet. Die Elberfelder Seidenfabri-
kanten sind geschlossen aufgetreten. Viele Einzel-
firmen fesseln durch ihre Auslagen, namentlich durch
die Farbenzusammenstellungen der Bunt- und Weiß-
weberei. Andere Gruppen sind die des Wagenbaus,
der Hygieine, der Stadtbauabteilungen. Der Reich-
tum des Gebotenen ist schier unübersehbar. Und
ebenso in dem Pavillon oder besser Palaste für
die bergbaulich en Interessen, der die Ge-
samtausstellung des Dortmunder Vereins umschließt
und mit seiner 40 Meter hohen Mittelkuppel einen
sehr würdigen Eindruck macht. Die Eingangshalle
Dortmunder Vereins gehört ferner ein Maschinenhaus,
eine Pumpenhalle, ein Kesselhaus, eine Bohrhalle und
das im Freien vor dem Maschinenhause ausgestellte riesige
Fördergerüst mit Hängebank, Seilscheiben, Hilfsförder-
einrichtung und Förderkörben. Auch die Bauten der
königlichen Eisenbahndirektion stehen vollständig auf der
Höhe der übrigen, von der Privatindustrie errichteten
Gebäude. Von besonders glücklicher, dem Gesamtbilde
sich harmonisch einfügender architektonischer Gestaltung
ist der Pavillon der Eis en b a hn d irektio n en im
nördlichen Teile des Ausstellungsgebäudes, sowie der
Ausstellungsbahnhof im Stil der Frührenaissance, der
dazu dient, den gesamten Personenverkehr von außer-
halb zu bewältigen.
ist mit mächtigen Figuren und
mit Wandgemälden geziert,
welche Landschaften aus der
Steinkohlenzeit darstellen. Die
große Kuppelhalle enthält ferner
vier Wandgemälde, welche die
wichtigsten Arbeitsvorgänge des
Kohlenbergbaues in einfacher
und verständlicher Art vorsühren.
Dem Besucher fällt beim Be-
treten der Ausstellungshallen
in erster Linie die große Zahl
von Modellen auf, welche mit
ihrer bis ins kleinste Detail
gehenden Nachbildung der Bohr-
technik, des Schachtabteufens,
der Kohlengewinnung, der För-
derungen, Wetterführungen,
Wasserhaltungen, der Arbeits-
methoden über Tage eine auch
dem Laien verständliche Darstel-
lung des Montangewerbes bie-
ten. Die Maschinenabteilung für
den Bergba>l andererseits ent-
hält Maschinen größter Dimen-
sion und Leistung, sie ist nebst
ihrer eigenen Dampfkesselanlage
so reichhaltig beschickt und mit
den im Betriebe vorgeführten
Maschinen so interessant und
lehrreich, daß sie ein sehr wür-
diges Gegenstück zur Haupt-
maschinenhalle der Ausstellung
bildet. Zu der Ausstellung des
gehört ferner ein Maschinenhaus,
Kettsumcicksrinnsn in Craülsi/ keatli.
(Zisks rlcis kilcl ciuk Zelts b18.)
p>urch den Sieg der Maschine auf allen Gebieten der
Industrie ist die wenig lohnende Handarbeit vielfach
zum großen Schaden des Familienlebens und der Ge-
sundheit der betreffenden Bevölkerungskreise an die Frauen
und Kinder übergegangen. Dieser Wandel hat sich be-
sonders dort vollzogen, wo die Herstellung bestimmter
Waren ihrer Natur nach nicht von Maschinen übernom-
men werden konnte. Die armen Kettenmacherinnen von
Cradley Heath, die unser Bild bei der Arbeit am Amboß
zeigt, sind ein trauriges Beispiel dafür. Die in der
Grafschaft Staffordshire, in der Nähe von Birmingham
gelegene Fabrikstadt Cradley Heath ist das Zentrum
der englischen Kettenindustrie. Jede Woche werden von
hier über 1000 Tonnen Ketten jeder Größe ausgeführt.
Die hügelreiche Grafschaft ist reich au Mineralschätzen,
und jede Art von Industrie, die mit der Eisenverarbeitung
Die köauptindultriekalle. Nack einer l>bok<Mi i<
li von Otto Nenard, köolpboiograpk in NlMeldork.
und diese bunte Mannigfaltig-
keit wirkt ungemein fesselnd und
anregend auf den Beschauer ein.
Bei dem Kruppschen Palast
biegt die Bahn von der Haupt-
allee nach dem Rheine ab und
fährt nun hart am Ufer ent-
lang an den Hinterfronten der
Gebäude von Krupp, dem Hör-
der Verein, den großen Anla-
gen des Betonvereins und den
Palästen des Bochumer Vereins
der Polygraphischen Gewerbe,
der Rheinischen Metallwaren-
fabrik, der Dortmunder Aktien-
brauerei und der Düsseldorfer
Handelskammer vorüber. Ver-
schiedene kleinere Anlagen liegen
dazwischen. Plötzlich hören die
Gebäude auf, und in ihrer gan-
zen Großartigkeit sehen wir die
mächtige Fassade der Haupt-
industriehalle vor uns. Es
ist eine ungemein geschickte An-
ordnung, daß man diese impo-
sante Halle nach dem Rhein
zu vollkommen frei gelegt hat,
nur mit der großen Fontänen-
anlage davor, um deren riesige
Becken herum an Abenden, wenn
die farbig beleuchteten Wasser
springen und am Rheinuser
Feuerwerk abgebrannt wird,
20,000 Menschen Platz finden
Pavillon de; Verein;
Nack einer pliotogropliie von Otto k
bergbaulichen Znterelien.
"ord, kolpttolograpli in NLllsldork.
Das Buch für Alle.
Das Buch für Alle.
615
Heft 85.
Heft 25.
ktu; dem Panorama Klucker; lliieinübergang bei Laub" I.
können. Hinter diesem großen Fest-
platz beginnt das Gebiet des Vergnü-
gens und der Erholung, die große
Weltmesse, die auf keiner hervorra-
genden Ausstellung heutzutage mehr
fehlen darf. Hier erhebt sich inmitten
von Wein- und Bierhäusern die F e st-
halle, der imposanteste Bierpalast
der Ausstellung, der nicht nur für die
deutschen, sondern auch für die Tau-
sende von fremden Besuchern einen
Anziehungspunkt von großer Stärke
bildet. Die elektrische Ausstellungs-
bahn führt uns dann weiter zum
Staatsbahnhof, der die Ausstellung
im Westen begrenzt, verläßt hier den
Rhein und geht am Vergnügungspark
und den Marineschauspielen vorüber
nach der anderen Seite des Ausstel-
lungsgeländes. Wir passieren die Ge-
bäude der Vereinigten Waggon- und
Lokomotivfabriken Düsseldorf, der kö-
niglichen Eisenbahndirektionen zu
Köln, Elberfeld und Essen, der Düssel-
dorfer Maschincnbauaktiengesellschaft,
fahren .am Alpenpanorama vorüber
und gelangen vor dem Portal der
Maschinenhalle nach der Hauptallee
vorragenden Portal des Mittelbaus,
das zwei Seitentürme flankieren, reicht
bis 60 Meter in die Lüfte empor. An
den Mittelbau schließen sich rechts und
links die einfacher gehaltenen, aber
schön gegliederten Seitenflügel an.
Und nun der Reichtum des Innern.
Nicht weniger als 21 Gruppen haben
hier die besten und erlesensten ihrer
Erzeugnisse zur Schau gestellt, aber
Stahl und Eisen überwiegt auch hier.
Wer am Eingang den aus Drähten,
Kabeln, Metallseilen u. s. w. kon-
struierten Tempel von Felten L Guil-
laume, wer die grandiosen Schmiede-
stücke von Hamel L Lueg angestaunt,
wer die Gruppierungen und Pyra-
miden der Abteilung Siegerland mit
ihren Messing- und Drahtobjekten,
mit ihren wuchtigen Kesseln und Hoch-
öfenanlagen, mit ihren Förder- und
Walzmerkmaschinen bewundert hat,
wer die Schöpfungen der Düsseldorfer
Röhrenindustrie und all der Guß-
stahlwerke hier vereinigt sieht, der er-
kennt, daß die erzenen Wunder, die
sich in Sonderpalästen und in der trotz
ihrer Eisenkonstruktion so eleganten
Ku; dem Panorama „Klucker; kiieinübergang bei Laub" 17.
i—
Pavillon der Lilenbalmdirektlonen. Nack einer piuNograpiue von Silo kenard, löokptiotogravtl in Nülleidoir.
Bildes ausmacht. Unmittelbar neben der Pfalz
ist die Pontonbrücke über den Strom geschlagen,
der mit einer dünnen Eisschicht überzogen ist. In-
fanterie und Artillerie ziehen über die Brücke, und
am diesseitigen Ufer hält, umgeben von seinem
Stabe, der greise „Marschall Vorwärts" auf seinem
Schimmel. Mit Hurrageschrei zieht eben mit flat-
ternder Fahne ein Bataillon schlesischer Landwehr
an ihm vorüber. In vollem Galopp fährt eine
Abteilung Artillerie die Uferböschung herauf. Am
jenseitigen Ufer sieht man von allen Seiten lange
Truppenzüge anmarschieren. Namentlich kommen
sie durch das kleine Seitenthal hinter dem Städt-
chen aus der Richtung von Langenschwalbach her-
unter. Auf der Höhe daneben ragt die Burg Guten-
fels mit ihren Turmruinen aus der kahlen Schnee-
landschaft auf. — Hinter dem Panorama beginnt die
mit vier Baumreihen bepflanzte breite Hauptallee
der Ausstellung, an der zu beiden Seiten die Pa-
läste der bedeutendsten Aussteller emporragen: Klar
und bestimmt sagt fast jedes einzelne Gebäude
von außen, was es innen zu bieten hat. Wenn
man die mächtigen Panzertürme und den gewalti-
gen Gefechtsmast sieht, die das Dach des Kruppschen
Hauses überragen, so weiß man, daß man in die-
sem Hause Kriegsmaterial finden wird. Die schlichte,
nur auf Massenwirkung berechnete Fassade dort
mit den drei riesenhaften Rundbögen in Eisen
und Glas erkennt jeder ans den ersten Blick als
die der Maschinenhalle. Jener vornehme Bau
mit der klassischen Sandsteinfassade, was kann er
anders sein, als das Gebäude der nationalen Kunst-
ausstellung? Der mächtige Hauptpalast hebt sich
von selbst durch seine alles überragende Kuppel
hervor. Und so geht es fort, bis zu den Wein-
und Bierpalästen; jeder hat seinen eigenen Stil
Dis Zncluitris., Ssnerbe-
unl! liunllciuzltslluiig in
lllilssläork.
Eielie die beiNeksnden b Nilder.)
12m 1. Mai ist die Düsseldorfer
Industrie-, Gewerbe- und
Kunstausstellung in Gegenwart
des deutschen ' Reichskanzlers,
vieler hoher Staatsbeamten und
Vertreter der Wissenschaft,
Kunst und Industrie durch den
Kronprinzen Wilhelm von Preu¬
ßen eröffnet worden. Sie über¬
trifft durch die Großartigkeit,
mit der vor allem die Eisen¬
industrie vertreten ist, alles auf
diesem Gebiete Vorausgegan¬
gene, und kann — wie der
Reichskanzler v. Bülow mit
Recht sagte — durch die Be¬
deutung und den Ernst vieler
Leistungen mit jeder bisherigen
europäischen Weltausstellung
wetteifern. Das Ausstellungs¬
gebiet befindet sich auf dem
ehemaligen Sumpf- und Wie¬
senland der Golzheimer Insel,
das mit einem Kostenaufwand
von 4 Millionen Mark ausge¬
höht, befestigt, mit Staden- und
Hafenanlagen versehen wurde
und schon Ende des Jahres 1898
der Ausstellungsleitung zur Verfügung gestellt werden
konnte. Seine Länge beträgt 2,r Kilometer, seine Breite
'/c Kilometer. Außer dem durch Aufschüttung dem
Strom abgewonnenen Gelände ist noch ein Teil des
anstoßenden Hofgartens, einer herrlichen Parkanlage,
in das Ausstellungsgebiet einbezogen worden. Das
Gesamtgelände umfaßt über Million Quadrat-
meter; das deu Ausstellungszwecken dienende 180,000
Quadratmeter. Damit übertrifft die Düsseldorfer
Ausstellung ihre erste Vorgängerin von 1880 um das
Sechsfache; die Berliner von 1896 um das Zweiein-
halbfache; hinter der Wiener Weltausstellung von 1873
bleibt sie nur um 10,000 Quadratmeter zurück. Die in
der Ausstellung errichteten Gebäude, welche die Gesamt-
zahl von 168 erreichen, bedecken 127,000 Quadratmeter
überdachte Fläche. Die beiden Haupteingänge sind das
Hofgartenthor und das Rheinthor. Wir treten durch das
erstere ein, um einen Nundgang durch die Ausstellung
zu machen, oder vielniehr eine Rundfahrt, zu welcher
wir uns der elektrisch betriebenen 3' s Kilometer langen
Ausstellungsbahn bedienen können. Ehe wir die Station
erreichen, kommen wir an dem großen Panorama
„Blüchers Uebergang über den Rhein bei Laub
1814" vorüber, in das wir schnell einen Blick thun
wollen. Vor den bekannten Bauten dieser Art zeichnet
es sich durch seine Größe aus, auch hat man die nun
einmal nicht zu vermeidende unschön wirkende Rund-
form durch einen geschmackvollen Thorbau anmutvoller
zu gestalten gewußt. Der Standpunkt des Beschauers
im Innern ist auf der linken Rheinseite vor einem Zoll-
hause angenommen, das Caub gegenüber am Berges-
hange steht und gleichzeitig die am Rheinufer hinführende
Landstraße und einen steilen Pfad beherrscht, der über
die Berge fort nach Westen abbiegt. Von hier aus blickt
man hinüber auf das ganz verschneite Städtchen, das
mit der alten Pfalz malerisch den wirksamsten Teil des
zurück. Der Eindruck, den eine
solche Rundfahrt gewährt, ist
bedeutend und giebt uns einen
Begriff von der Anstrengung,
die unsere industriereichsten Pro-
vinzen dort am Rheinufer ge-
macht haben, um der Welt den
Beweis zu liefern, daß Rhein-
lands und Westfalens Montan-
und Metallindustrie vor keiner
der Welt die Segel zu streichen
gedenkt. Wollten wir alle Schätze,
die das Innere dieser Bauten
birgt, würdigen, so brauchten
wir dazu ein stattliches Buch.
Selbst der Besucher muß, um
nicht nur einen Allgemeinein-
drück und die Kenntnis einiger
Einzelheiten mit nach Hause zu
nehmen, ein wochenlanges ernstes
Studium an Ort und Stelle
daransetzen. Wir können hier
nichts thun, als an der Hand
unserer Bilder den Leser auf
einige der Hauptsehenswürdig-
keiten Hinweisen. Den gewaltig-
sten Eindruck macht naturgemäß
die an Größe und Höhe alle
anderen Bauten mächtig über-
ragende Hauptindustrie-
halle. Sie hat eine Länge
von 425 Meter und die große
Kuppel hinter dem auch künst-
lerisch und architektonisch her-
llle rsittuille. Nack einer Pkowgraplue von Otto Nenard, köokpttotogravk in l>ül!el6ori.
Maschinenhalle ausbreiten, hier nur ihre Fort-
setzung finden und alle anderen Industrien über-
flügeln. Und neben dem Eisen blinkt das Gold.
Der Silber- und Goldschatz des Rats der Stadt
Elberfeld gleißt aus sicherem Verschluß neben den
prunkvoll und künstlerisch gestalteten Geräten, die
der Kirche dienen sollen. Das rheinische Kunstge-
werbe entwickelt moderne, praktische Formen, das
zeigen dis Schmiedearbeiten und auch die inter-
essanten Versuche in Bronze. Schlanke Frauenge-
stalten, lebenswahre Wachspuppen, in 'eleganten,
modernen Kostümen, blickt man wohlgefällig an,
sie sind die Helfershelferinnen der mit effektvollem
Geschmack inscenierten Bekleidungsindustrie. Große
und kleine Glasbehälter, aus denen es farbig
hervorleuchtet, bergen die Produkte der zur Wissen-
schaft emporgehobeneu chemischen Industrie. Die
Elektrizität, die keramische Industrie, die Nahrungs-
mittelindustrie u.s. w , sie alle sind würdig vertreten
in dieser Halle; die Möbelindustrie nicht minder,
und dazu Rheinland-Westfalens berühmte Textil-
industrie. Die Rheinischen Tuchfabriken, die Düssel-
dorfer Baumwollindustriellen, die allgemeine deutsche
Zanellakonvention u. s. w. haben Kollektivausstel-
lungen veranstaltet. Die Elberfelder Seidenfabri-
kanten sind geschlossen aufgetreten. Viele Einzel-
firmen fesseln durch ihre Auslagen, namentlich durch
die Farbenzusammenstellungen der Bunt- und Weiß-
weberei. Andere Gruppen sind die des Wagenbaus,
der Hygieine, der Stadtbauabteilungen. Der Reich-
tum des Gebotenen ist schier unübersehbar. Und
ebenso in dem Pavillon oder besser Palaste für
die bergbaulich en Interessen, der die Ge-
samtausstellung des Dortmunder Vereins umschließt
und mit seiner 40 Meter hohen Mittelkuppel einen
sehr würdigen Eindruck macht. Die Eingangshalle
Dortmunder Vereins gehört ferner ein Maschinenhaus,
eine Pumpenhalle, ein Kesselhaus, eine Bohrhalle und
das im Freien vor dem Maschinenhause ausgestellte riesige
Fördergerüst mit Hängebank, Seilscheiben, Hilfsförder-
einrichtung und Förderkörben. Auch die Bauten der
königlichen Eisenbahndirektion stehen vollständig auf der
Höhe der übrigen, von der Privatindustrie errichteten
Gebäude. Von besonders glücklicher, dem Gesamtbilde
sich harmonisch einfügender architektonischer Gestaltung
ist der Pavillon der Eis en b a hn d irektio n en im
nördlichen Teile des Ausstellungsgebäudes, sowie der
Ausstellungsbahnhof im Stil der Frührenaissance, der
dazu dient, den gesamten Personenverkehr von außer-
halb zu bewältigen.
ist mit mächtigen Figuren und
mit Wandgemälden geziert,
welche Landschaften aus der
Steinkohlenzeit darstellen. Die
große Kuppelhalle enthält ferner
vier Wandgemälde, welche die
wichtigsten Arbeitsvorgänge des
Kohlenbergbaues in einfacher
und verständlicher Art vorsühren.
Dem Besucher fällt beim Be-
treten der Ausstellungshallen
in erster Linie die große Zahl
von Modellen auf, welche mit
ihrer bis ins kleinste Detail
gehenden Nachbildung der Bohr-
technik, des Schachtabteufens,
der Kohlengewinnung, der För-
derungen, Wetterführungen,
Wasserhaltungen, der Arbeits-
methoden über Tage eine auch
dem Laien verständliche Darstel-
lung des Montangewerbes bie-
ten. Die Maschinenabteilung für
den Bergba>l andererseits ent-
hält Maschinen größter Dimen-
sion und Leistung, sie ist nebst
ihrer eigenen Dampfkesselanlage
so reichhaltig beschickt und mit
den im Betriebe vorgeführten
Maschinen so interessant und
lehrreich, daß sie ein sehr wür-
diges Gegenstück zur Haupt-
maschinenhalle der Ausstellung
bildet. Zu der Ausstellung des
gehört ferner ein Maschinenhaus,
Kettsumcicksrinnsn in Craülsi/ keatli.
(Zisks rlcis kilcl ciuk Zelts b18.)
p>urch den Sieg der Maschine auf allen Gebieten der
Industrie ist die wenig lohnende Handarbeit vielfach
zum großen Schaden des Familienlebens und der Ge-
sundheit der betreffenden Bevölkerungskreise an die Frauen
und Kinder übergegangen. Dieser Wandel hat sich be-
sonders dort vollzogen, wo die Herstellung bestimmter
Waren ihrer Natur nach nicht von Maschinen übernom-
men werden konnte. Die armen Kettenmacherinnen von
Cradley Heath, die unser Bild bei der Arbeit am Amboß
zeigt, sind ein trauriges Beispiel dafür. Die in der
Grafschaft Staffordshire, in der Nähe von Birmingham
gelegene Fabrikstadt Cradley Heath ist das Zentrum
der englischen Kettenindustrie. Jede Woche werden von
hier über 1000 Tonnen Ketten jeder Größe ausgeführt.
Die hügelreiche Grafschaft ist reich au Mineralschätzen,
und jede Art von Industrie, die mit der Eisenverarbeitung
Die köauptindultriekalle. Nack einer l>bok<Mi i<
li von Otto Nenard, köolpboiograpk in NlMeldork.
und diese bunte Mannigfaltig-
keit wirkt ungemein fesselnd und
anregend auf den Beschauer ein.
Bei dem Kruppschen Palast
biegt die Bahn von der Haupt-
allee nach dem Rheine ab und
fährt nun hart am Ufer ent-
lang an den Hinterfronten der
Gebäude von Krupp, dem Hör-
der Verein, den großen Anla-
gen des Betonvereins und den
Palästen des Bochumer Vereins
der Polygraphischen Gewerbe,
der Rheinischen Metallwaren-
fabrik, der Dortmunder Aktien-
brauerei und der Düsseldorfer
Handelskammer vorüber. Ver-
schiedene kleinere Anlagen liegen
dazwischen. Plötzlich hören die
Gebäude auf, und in ihrer gan-
zen Großartigkeit sehen wir die
mächtige Fassade der Haupt-
industriehalle vor uns. Es
ist eine ungemein geschickte An-
ordnung, daß man diese impo-
sante Halle nach dem Rhein
zu vollkommen frei gelegt hat,
nur mit der großen Fontänen-
anlage davor, um deren riesige
Becken herum an Abenden, wenn
die farbig beleuchteten Wasser
springen und am Rheinuser
Feuerwerk abgebrannt wird,
20,000 Menschen Platz finden
Pavillon de; Verein;
Nack einer pliotogropliie von Otto k
bergbaulichen Znterelien.
"ord, kolpttolograpli in NLllsldork.