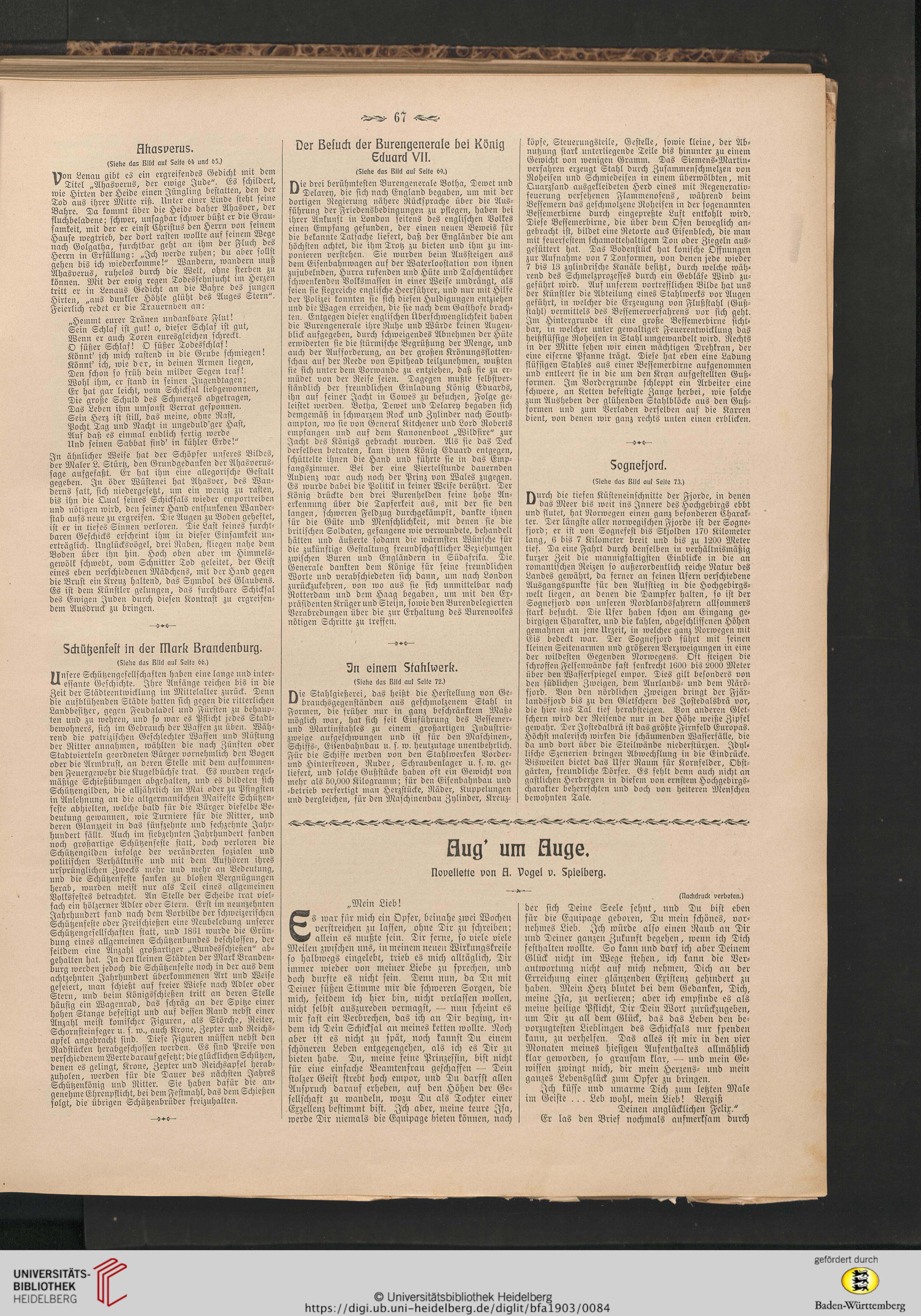ütlLI8VLI-U8.
(5!sks llas Uilil auk ö» uni! b5.)
Hlon Lenau gibt cs ein ergreifendes Gedicht mit dem
V Titel „Ahasverus, der ewige Jude'. Ev schildert,
wie Hirten der Heide einen Jüngling bestatten, den der
Tod aus ihrer Mitte riß. Unter einer Linde steht seine
Bahre. Da kommt über die Heide daher Ahasver der
fluchbeladene: schwer, unsagbar schwer büßt er die Grau-
samkeit, mit der er einst Christus den Herrn von seinem
Hause wegtrieb, der dort rasten wollte auf sein ein Wege
nach Golgatha, furchtbar geht an ihm der Fluch des
Herrn in Erfüllung: „Ich werde ruhen; du aber sollst
gehen bis ich wiederkomme!" Wandern, wandern muß
Ahasverus, ruhelos durch die Welt, ohne sterben zu
können. Mit der ewig regen Todessehnsucht uu Herzen
tritt er in Lenaus Gedicht an die Bahre de» jungen
Hirten, „aus dunkler Höhle glüht des Auges Stern .
Feierlich redet er die Trauernden an:
„Heinnit eurer Tränen undankbare Flut!
Sein Schlaf ist gut! o, dieser Schlaf ist gut,
Wenn er auch Toren euresgleichen schreckt.
O süßer Schlaf! O süßer Todesschlaf !
Könnt' ich mich rastend in die Grube schmiegen!
Könnt' ich, wie der, in deinen Armen liegen,
Den schon so früh dein milder Segen traf!
Wohl ihm, er stand in seinen Jugendtagc»;
Er hat gar leicht, vom Schicksal liebgewonnen,
Die große Schuld des Schmerzes abgetragen,
Das Leben ihm umsonst Verrat gesponnen.
Sein Herz ist still, das meine, ohne Rast,
Pocht Tag und Nacht in ungeduld'gcr Hast,
Auf daß cs einmal endlich fertig werde
Und seinen Sabbat find' in kühler Erde!"
In ähnlicher Weise hat der Schöpfer unseres Bildes,
der Maler L. Stürtz, den Grundgedanken der Ahasverus-
fage aufgefaßt. Er hat ihm eine allegorische Gestalt
gegeben. In öder Wüstenei hat AhaSver, des Wan-
derns satt, sich niedergesetzt, um ein wenig zu rasten,
bis ihn die Qual seines Schicksals wieder emportreiben
und nötigen wird, den seiner Hand entsunkenen Wander-
stab aufs neue zu ergreifen. Die Augen zu Boden geheftet,
ist er in tiefes Sinnen verloren. Die Last seines furcht-
baren Geschicks erscheint ihm in dieser Einsamkeit un-
erträglich. Nnglücksvögel, drei Naben, fliegen nahe dem
Boden über ihn hin. Hoch oben aber im Himmels-
gewölk schwebt, vom Schnitter Tod geleitet, der Geist
eines eben verschiedenen Mädchens, mit der Hand gegen
die Brust ein Kreuz haltend, das Symbol des Glaubens.
Es ist dem Künstler gelungen, das furchtbare Schicksal
des Ewigen Juden durch diesen Kontrast zu ergreifen-
dem Ausdruck zu bringen.
Zclilihsiüeil in cier INcirk Lrcmdsnburg.
(Zieks 6ns Lil6 ciuk Zsits bb.)
Isnsere Schützcngesellschaften haben eine lange und inter-
essante Geschichte. Ihre Anfänge reichen bis in die
Zeit der Städteentwicklung im Mittelalter zurück. Denn
die ausblühenden Städte hatten sich gegen die ritterlichen
Landbesitzer, gegen Feudaladcl und Fürsten zu behaup-
ten und zu wehren, und so war es Pflicht jedes Stadt-
bewohners, sich im Gebrauch der Waffen zu üben. Wäh-
rend die patrizischen Geschlechter Waffen und Rüstung
der Ritter annahmen, wählten die nach Zünften oder
Stadtvierteln geordneten Bürger vornehmlich den Bogen
oder die Armbrust, an deren Stelle mit dem aufkommen-
den Feuergewehr die Kugelbüchse trat. ES wurden regel-
mäßige Schießübungen abgehalten, und es bildeten sich
Schützengilden, die alljährlich im Mai oder zn Pfingsten
in Anlehnung an die altgermanischen Mnifcste Schützen-
feste abhielten, welche bald für die Bürger dieselbe Be-
deutung gewannen, wie Turniere für die Ritter, und
deren Glanzzeit in das fünfzehnte und sechzehnte Jahr-
hundert fällt. Auch im siebzehnten Jahrhundert fanden
noch großartige Schützenfeste statt, doch verloren die
Schützcngilden infolge der veränderten sozialen und
politischen Verhältnisse und mit dem Aufhvren ihres
ursprünglichen Zwecks mehr und mehr an Bedeutung,
und die Schützenfeste sanken zu bloßen Vergnügungen
herab, wurden meist nur als Teil eines allgemeinen
Volksfestes betrachtet. An Stelle der Scheibe trat viel-
fach ein hölzerner Adler oder Stern. Erst im neunzehnten
Jahrhundert fand nach dem Vorbilde der schweizerischen
Schützenfeste oder Freischießen eine Ncubclebnng unserer
Schützengesellschaften statt, und 1861 wurde die Grün-
dung eines allgemeinen Schützcnbundes beschlossen, der
seitdem eine Anzahl großartiger „Bundesschießen" ab-
gehalten hat. In den kleinen Städten der Mark Branden-
burg werden jedoch die Schützenfeste noch in der aus dem
achtzehnten Jahrhundert überkommenen Art und Weise
gefeiert, man schießt auf freier Wiese nach Adler oder
Stcrn, und beim Königsschicßen tritt an deren Stelle
häufig ein Wagenrad, das schräg an der Spitze einer-
hohen Stange befestigt und auf dessen Rand nebst einer
Auzahl meist komischer Figuren, als Storche, Rester,
Schornsteinfeger u. st rv., auch Krone, Zepter und Hveichs-
apfel angebracht sind. Diese Figuren müssen nebst den
Nadstücken herabgeschossen werden. Es sind Preise von
verschiedencmWertedarauf gesetzt; die glücklichen schützen,
denen es gelingt, Krone, Zepter und Reichsapfel herab-
zuholen, werden für die Dauer des nächsten Jahres
Schützenkönig und Ritter. Sie haben dafür die an-
genehme Ehrenpflicht, bei dein Festmahl, das dem Schießen
folgt, die übrigen Schützenbrüder freizuhaltcn.
vsr Leluck 6sr Lui-ellgenercils bei König
Lklucirö VII.
<5ielie llas MI<! aul 5e!ts by.)
rxie drei berühmtesten Burengenerale Botha, Dewet und
Delarey, die sich nach England begaben, um mit der
dortigen Regierung nähere Rücksprache über die Aus-
führung der Friedensbcdingungen zu pflegen, haben bei
ihrer Ankunft in London seitens des englischen Volkes
einen Empfang gefunden, der einen neuen Beweis für
die bekannte Tatsache liefert, daß der Engländer die am
höchsten achtet, die ihm Trotz zu bieten und ihm zu im-
ponieren verstehen. Sie wurden beim Aussteigen aus
dem Eisenbahnwagen auf der Waterloostation von ihnen
zujubelnden, Hurra rufenden und Hüte und Taschentücher
schwenkenden Volksmassen in einer Weise umdrängt, als
seien sie siegreiche englische Heerführer, und nur mit Hilfe
der Polizei konnten sie sich diesen Huldigungen entziehen
und dis Wagen erreichen, die sic nach dein Gasthofe brach-
ten. Entgegen dieser englischen Überschwenglichkeit haben
die Burengenerale ihre Ruhe und Würde keinen Augen-
blick aufgegeben, durch schweigendes Abnehme» der Hüte
erwiderten sie die stürmische Begrüßung der Menge, und
auch der Aufforderung, an der großen Krönungsflotten-
schau auf der Reede von Spithead teilzunchmcn, wußten
sie sich unter dem Vorwande zu entziehen, daß sie zn er-
müdet von der Reise seien. Dagegen mußte selbstver-
ständlich der freundlichen Einladung König Eduards,
ihn auf seiner Jacht in Cowes zn besnchen, Folge ge-
leistet werden. Botha, Dewet und Delarey begaben sich
demgemäß in schwarzem Rock und Zylinder nach South-
ampton, wo sie von General Kitchener und Lord Roberts
empfangen und auf dem Kanonenboot „Wildfire" zur
Jacht des Königs gebracht wurden. Als sie das Deck
derselben betraten, kam ihnen König Eduard entgegen,
schüttelte ihnen die Hand und führte sie in das Emp-
fangszimmer. Bei der eine Viertelstunde dauernden
Audienz war auch noch der Prinz von Wales zugegen.
Es wurde dabei die Politik in keiner Weise berührt. Der
König drückte den drei Burenhelden seine hoho An-
erkennung über die Tapferkeit aus, mit der sic den
langen, schweren Feldzug durchgekümpst, dankte ihnen
für die Güte und Menschlichkeit, mit denen sie die
britischen Soldaten, gefangene wie verwundete, behandelt
hätten und äußerte sodann die wärmsten Wünsche für
die zukünftige Gestaltung freundschaftlicher Beziehungen
zwischen Buren und Engländern in Südafrika. Die
Generale dankten dem Könige für seine freundlichen
Worte und verabschiedeten sich dann, um nach London
zurückzukehren, von wo aus sie sich unmittelbar nach
Rotterdam und dem Haag begaben, um mit den Ex-
präsidenten Krüger und Steijn, sowie den Burendelegiertcn
Verabredungen über die zur Erhaltung des Burenvolkcs
nötigen Schritte zu treffen.
Zu einem Zlcililkoerk.
(Zielte 6ci5 Lilli ciuk Zeile 72.)
r^ie Stahlgießerei, das heißt die Herstellung von Gc-
brauchsgegenständcu aus geschmolzenem L-tahl in
Formen, die früher nur in ganz beschränktem Maße
möglich war, hat sich seit Einführung des Bessemer-
und Martinstahles zu einem großartigen Industrie-
zweige nufgeschwungen und ist für den Maschinen-,
Schiffs-, Eisenbahnbau u. s. w. heutzutage unentbehrlich.
Für die Schiffe werden von den Stahlwerken Vorder-
nnd Hinterstevcn, Ruder, Schraubenlager u. s. w. ge-
liefert, und solche Gußstücke haben oft ein Gewicht von
mehr als 50,000 Kilogramm; für den Eisenbahnbau und
-betrieb verfertigt man Herzstücke, Räder, Kuppelungen
und dergleichen, für den Maschinenbau Zylinder, Kreuz-
köpse, Steuerungsteilc, Gestelle, sowie kleine, der Ab-
nutzung stark unterliegende Teile bis hinunter zu einem
Gewicht von wenigen Gramm. Das Siemens-Martin-
verfahrcn erzeugt Stahl durch Zusammenschmelzen von
Roheisen und Schmiedeisen in einem überwölbten, mit
Quarzsand ausgekleideten Herd eines mit Regenerativ-
feuerung versehenen Flammcuofens, während beim
Bessemern das geschmolzene Roheisen in der sogenannten
Bessemerbirne durch cingepreßte Luft entkohlt wird.
Diese Bessemerbirne, die über dem Ofen beweglich an-
gebracht ist, bildet eine Retorte auS Eisenblech, die man
mit feuerfestem schamottchaltigem Ton oder Ziegeln aus-
gefüttert hat. Das Bodeustück hat konische Öffnungen
zur Aufnahme von 7 Tonformen, von denen jede wieder
7 bis 13 zylindrische Kanäle besitzt, durch welche wäh-
rend des Schmclzprozesses durch ein Gebläse Wind zn-
geführt wird. Auf unserem vortrefflichen Bilde hat uns
der Künstler die Abteilung eines Stahlwerks vor Augen
geführt, in welcher die Erzeugung von Flußstahl (Guß-
stahl) vermittels des Bessemerverfahrens vor sich geht.
Jin Hintergründe ist eine große Bessemerbirne sicht-
bar, in welcher unter gewaltiger Fcuercntwicklung das
heißflüssige Roheisen in Stahl umgewandelt wird. Rechts
in der Mitte sehen wir einen mächtigen Drehkran, der
eine eiserne Pfanne trägt. Diese hat eben eine Ladung
flüssigen Stahles aus einer Bessemerbirne ausgenommen
und entleert sie in die um den Kran ausgestellten Guß-
formen. Im Vordergründe schleppt ein Arbeiter eine
schwere, an Kette» befestigte Zange herbei, wie solche
zum AuSheben der glühenden Stahlblöcke aus den Guß-
formen und zum Verladen derselben auf die Karren
dient, von denen wir ganz rechts unten einen erblicken.
Zogrieljorll.
(Zielte clcis Lil6 ciul Zeile 73.)
s^urch die tiefen Küsteneinschnitte der Fjorde, in denen
" das Meer bis weit ins Innere des Hochgebirgs ebbt
und flutet, hat Norwegen einen ganz besonderen Charak-
ter. Der längste aller norwegischen Fjorde ist der Sogne-
fjord; er ist von Sogncfest bis Skjolden 170 Kilometer-
lang, 6 bis 7 Kilometer breit und bis zu 1200 Meter-
tief. Da eine Fahrt durch denselben in verhältnismäßig
kurzer Zeit die mannigfaltigsten Einblicke in die an
romantischen Reizen so außerordentlich reiche Natur des
Landes gewährt, da ferner an seinen Ufern verschiedene
Ausgangspunkte für den Aufstieg in die Hochgebirgs-
welt liegen, an denen die Dampfer halten, so ist der
Sognefjord von unseren Nordlandsfahrern allsommers
start besucht. Die Ufer haben schon am Eingang ge-
birgigen Charakter, und die kahlen, abgeschliffenen Höhen
gemahnen an jene Urzeit, in welcher ganz Norwegen mit
Eis bedeckt war. Der Sognefjord führt mit seinen
kleinen Seitenarmen und größeren Verzweigungen in eine
der wildesten Gegenden Norwegens. Oft steigen die
schroffen Felsenwändc fast senkrecht 1600 bis 2000 Meter
über den Wasserspiegel empor. Dies gilt besonders von
den südlichen Zweigen, dem Aurlands- und dem Närö-
fjord. Von den nördlichen Zweigen dringt der Fjär-
landsfjord bis zu den Gletschern des Jostedalsbrä vor,
die hier ins Tal tief herabsteigen. Von anderen Glet-
schern wird der Reisende nur in der Höhe weiße Zipfel
gewahr. Der Jvstedalbrä ist das größte Firnfeld Europas.
Höchst malerisch wirken die schäumenden Wasserfälle, die
da und dort über die Steilwände niederstürzen. Idyl-
lische Szenerien bringen Abwechslung in die Eindrücke.
Bisweilen bietet das Ufer Raum für Kornfelder, Obst-
gärten, freundliche Dörfer. Es fehlt denn auch nicht an
gastlichen Herbergen in diesem von ernstem Hochgebirgs-
charakler beherrschten und doch von heiteren Menschen
bewohnten Tale.
klug' um kluge.
llovellette von kl. Vogel v. Zpielberg.
„Mein Lieb!
8 war für mich ein Opfer, beinahe zwei Wochen
verstreichen zn lassen, ohne Dir zu schreiben;
allein cs mußte sein. Dir ferne, so viele viele
Meilen zwischen uns, in meinem neuen Wirkungskreise
so Halbwegs cingelcbt, trieb es mich alltäglich, Dir
immer wieder von meiner Liebe zu sprechen, und
doch durfte es nicht sein. Denn nun, da Dn mit
Deiner süßen Stimme mir die schweren Sorgen, die
mich, seitdem ich hier bin, nichr verlassen wollen,
nicht selbst auszureden vermagst, — nun scheint es
mir säst ein Verbrechen, das ich an Dir beging, in-
dem ich Dein Schicksal an meines ketten wollte. Noch
aber ist es nicht zu spät, noch kannst Dn einem
schöneren Leben cntgegengehcn, als ich es Dir zu
bieten habe. Du, meiue seine Prinzessin, bist nicht
für eine einfache Bcamtcnfrau geschaffen — Dein
stolzer Geist strebt hoch empor, und Du darfst allen
Anspruch darauf erheben, ans den Hohen der Ge-
sellschaft zn wandeln, wozu Du als Tochter ciner
Exzellenz bestimmt bist. Ich aber, meine teure Isa,
werde Dir niemals die Equipage bieten können, nach
tUackücuck vewoten.)
der sich Deine Seele sehnt, und Du bist eben
für die Equipage geboren, Du mein schönes, vor-
nehmes Lieb. Ich würde also einen Raub an Dir
nnd Deiner ganzen Zukunft begehen, wenn ich Dich
festhalten wollte. So kann nnd darf ich aber Deinem
Glück nicht im Wege stehen, ich kann die Ver-
antwortung nicht auf mich nehmen, Dich an der
Erreichung einer glänzenden Existenz gehindert zn
haben. Mein Herz blutet bei dem Gedanken, Dich,
meine Isa, zn verlieren; aber ich empfinde es als
meine heilige Pflicht, Dir Dein Wort znrückzugebcn,
um Dir zn all dem Glück, das das Leben den be-
vorzugtesten Lieblingen des Schicksals nnr spenden
kann, zu verhelfen. Das alles ist mir in den vier
Monaten meines hiesigen Aufenthaltes allmählich
klar geworden, so grausam klar, — und mein Ge-
wissen zwingt mich, dir mein Herzens- und mein
ganzes Lebcnsglück zum Opfer zu bringen.
Ich küsse und umarme Dich zum letzten Male
im Geiste . . . Leb wohl, mein Lieb! Vergiß
Deinen unglücklichen Felix."
Er las den Brief nochmals aufmerksam durch
(5!sks llas Uilil auk ö» uni! b5.)
Hlon Lenau gibt cs ein ergreifendes Gedicht mit dem
V Titel „Ahasverus, der ewige Jude'. Ev schildert,
wie Hirten der Heide einen Jüngling bestatten, den der
Tod aus ihrer Mitte riß. Unter einer Linde steht seine
Bahre. Da kommt über die Heide daher Ahasver der
fluchbeladene: schwer, unsagbar schwer büßt er die Grau-
samkeit, mit der er einst Christus den Herrn von seinem
Hause wegtrieb, der dort rasten wollte auf sein ein Wege
nach Golgatha, furchtbar geht an ihm der Fluch des
Herrn in Erfüllung: „Ich werde ruhen; du aber sollst
gehen bis ich wiederkomme!" Wandern, wandern muß
Ahasverus, ruhelos durch die Welt, ohne sterben zu
können. Mit der ewig regen Todessehnsucht uu Herzen
tritt er in Lenaus Gedicht an die Bahre de» jungen
Hirten, „aus dunkler Höhle glüht des Auges Stern .
Feierlich redet er die Trauernden an:
„Heinnit eurer Tränen undankbare Flut!
Sein Schlaf ist gut! o, dieser Schlaf ist gut,
Wenn er auch Toren euresgleichen schreckt.
O süßer Schlaf! O süßer Todesschlaf !
Könnt' ich mich rastend in die Grube schmiegen!
Könnt' ich, wie der, in deinen Armen liegen,
Den schon so früh dein milder Segen traf!
Wohl ihm, er stand in seinen Jugendtagc»;
Er hat gar leicht, vom Schicksal liebgewonnen,
Die große Schuld des Schmerzes abgetragen,
Das Leben ihm umsonst Verrat gesponnen.
Sein Herz ist still, das meine, ohne Rast,
Pocht Tag und Nacht in ungeduld'gcr Hast,
Auf daß cs einmal endlich fertig werde
Und seinen Sabbat find' in kühler Erde!"
In ähnlicher Weise hat der Schöpfer unseres Bildes,
der Maler L. Stürtz, den Grundgedanken der Ahasverus-
fage aufgefaßt. Er hat ihm eine allegorische Gestalt
gegeben. In öder Wüstenei hat AhaSver, des Wan-
derns satt, sich niedergesetzt, um ein wenig zu rasten,
bis ihn die Qual seines Schicksals wieder emportreiben
und nötigen wird, den seiner Hand entsunkenen Wander-
stab aufs neue zu ergreifen. Die Augen zu Boden geheftet,
ist er in tiefes Sinnen verloren. Die Last seines furcht-
baren Geschicks erscheint ihm in dieser Einsamkeit un-
erträglich. Nnglücksvögel, drei Naben, fliegen nahe dem
Boden über ihn hin. Hoch oben aber im Himmels-
gewölk schwebt, vom Schnitter Tod geleitet, der Geist
eines eben verschiedenen Mädchens, mit der Hand gegen
die Brust ein Kreuz haltend, das Symbol des Glaubens.
Es ist dem Künstler gelungen, das furchtbare Schicksal
des Ewigen Juden durch diesen Kontrast zu ergreifen-
dem Ausdruck zu bringen.
Zclilihsiüeil in cier INcirk Lrcmdsnburg.
(Zieks 6ns Lil6 ciuk Zsits bb.)
Isnsere Schützcngesellschaften haben eine lange und inter-
essante Geschichte. Ihre Anfänge reichen bis in die
Zeit der Städteentwicklung im Mittelalter zurück. Denn
die ausblühenden Städte hatten sich gegen die ritterlichen
Landbesitzer, gegen Feudaladcl und Fürsten zu behaup-
ten und zu wehren, und so war es Pflicht jedes Stadt-
bewohners, sich im Gebrauch der Waffen zu üben. Wäh-
rend die patrizischen Geschlechter Waffen und Rüstung
der Ritter annahmen, wählten die nach Zünften oder
Stadtvierteln geordneten Bürger vornehmlich den Bogen
oder die Armbrust, an deren Stelle mit dem aufkommen-
den Feuergewehr die Kugelbüchse trat. ES wurden regel-
mäßige Schießübungen abgehalten, und es bildeten sich
Schützengilden, die alljährlich im Mai oder zn Pfingsten
in Anlehnung an die altgermanischen Mnifcste Schützen-
feste abhielten, welche bald für die Bürger dieselbe Be-
deutung gewannen, wie Turniere für die Ritter, und
deren Glanzzeit in das fünfzehnte und sechzehnte Jahr-
hundert fällt. Auch im siebzehnten Jahrhundert fanden
noch großartige Schützenfeste statt, doch verloren die
Schützcngilden infolge der veränderten sozialen und
politischen Verhältnisse und mit dem Aufhvren ihres
ursprünglichen Zwecks mehr und mehr an Bedeutung,
und die Schützenfeste sanken zu bloßen Vergnügungen
herab, wurden meist nur als Teil eines allgemeinen
Volksfestes betrachtet. An Stelle der Scheibe trat viel-
fach ein hölzerner Adler oder Stern. Erst im neunzehnten
Jahrhundert fand nach dem Vorbilde der schweizerischen
Schützenfeste oder Freischießen eine Ncubclebnng unserer
Schützengesellschaften statt, und 1861 wurde die Grün-
dung eines allgemeinen Schützcnbundes beschlossen, der
seitdem eine Anzahl großartiger „Bundesschießen" ab-
gehalten hat. In den kleinen Städten der Mark Branden-
burg werden jedoch die Schützenfeste noch in der aus dem
achtzehnten Jahrhundert überkommenen Art und Weise
gefeiert, man schießt auf freier Wiese nach Adler oder
Stcrn, und beim Königsschicßen tritt an deren Stelle
häufig ein Wagenrad, das schräg an der Spitze einer-
hohen Stange befestigt und auf dessen Rand nebst einer
Auzahl meist komischer Figuren, als Storche, Rester,
Schornsteinfeger u. st rv., auch Krone, Zepter und Hveichs-
apfel angebracht sind. Diese Figuren müssen nebst den
Nadstücken herabgeschossen werden. Es sind Preise von
verschiedencmWertedarauf gesetzt; die glücklichen schützen,
denen es gelingt, Krone, Zepter und Reichsapfel herab-
zuholen, werden für die Dauer des nächsten Jahres
Schützenkönig und Ritter. Sie haben dafür die an-
genehme Ehrenpflicht, bei dein Festmahl, das dem Schießen
folgt, die übrigen Schützenbrüder freizuhaltcn.
vsr Leluck 6sr Lui-ellgenercils bei König
Lklucirö VII.
<5ielie llas MI<! aul 5e!ts by.)
rxie drei berühmtesten Burengenerale Botha, Dewet und
Delarey, die sich nach England begaben, um mit der
dortigen Regierung nähere Rücksprache über die Aus-
führung der Friedensbcdingungen zu pflegen, haben bei
ihrer Ankunft in London seitens des englischen Volkes
einen Empfang gefunden, der einen neuen Beweis für
die bekannte Tatsache liefert, daß der Engländer die am
höchsten achtet, die ihm Trotz zu bieten und ihm zu im-
ponieren verstehen. Sie wurden beim Aussteigen aus
dem Eisenbahnwagen auf der Waterloostation von ihnen
zujubelnden, Hurra rufenden und Hüte und Taschentücher
schwenkenden Volksmassen in einer Weise umdrängt, als
seien sie siegreiche englische Heerführer, und nur mit Hilfe
der Polizei konnten sie sich diesen Huldigungen entziehen
und dis Wagen erreichen, die sic nach dein Gasthofe brach-
ten. Entgegen dieser englischen Überschwenglichkeit haben
die Burengenerale ihre Ruhe und Würde keinen Augen-
blick aufgegeben, durch schweigendes Abnehme» der Hüte
erwiderten sie die stürmische Begrüßung der Menge, und
auch der Aufforderung, an der großen Krönungsflotten-
schau auf der Reede von Spithead teilzunchmcn, wußten
sie sich unter dem Vorwande zu entziehen, daß sie zn er-
müdet von der Reise seien. Dagegen mußte selbstver-
ständlich der freundlichen Einladung König Eduards,
ihn auf seiner Jacht in Cowes zn besnchen, Folge ge-
leistet werden. Botha, Dewet und Delarey begaben sich
demgemäß in schwarzem Rock und Zylinder nach South-
ampton, wo sie von General Kitchener und Lord Roberts
empfangen und auf dem Kanonenboot „Wildfire" zur
Jacht des Königs gebracht wurden. Als sie das Deck
derselben betraten, kam ihnen König Eduard entgegen,
schüttelte ihnen die Hand und führte sie in das Emp-
fangszimmer. Bei der eine Viertelstunde dauernden
Audienz war auch noch der Prinz von Wales zugegen.
Es wurde dabei die Politik in keiner Weise berührt. Der
König drückte den drei Burenhelden seine hoho An-
erkennung über die Tapferkeit aus, mit der sic den
langen, schweren Feldzug durchgekümpst, dankte ihnen
für die Güte und Menschlichkeit, mit denen sie die
britischen Soldaten, gefangene wie verwundete, behandelt
hätten und äußerte sodann die wärmsten Wünsche für
die zukünftige Gestaltung freundschaftlicher Beziehungen
zwischen Buren und Engländern in Südafrika. Die
Generale dankten dem Könige für seine freundlichen
Worte und verabschiedeten sich dann, um nach London
zurückzukehren, von wo aus sie sich unmittelbar nach
Rotterdam und dem Haag begaben, um mit den Ex-
präsidenten Krüger und Steijn, sowie den Burendelegiertcn
Verabredungen über die zur Erhaltung des Burenvolkcs
nötigen Schritte zu treffen.
Zu einem Zlcililkoerk.
(Zielte 6ci5 Lilli ciuk Zeile 72.)
r^ie Stahlgießerei, das heißt die Herstellung von Gc-
brauchsgegenständcu aus geschmolzenem L-tahl in
Formen, die früher nur in ganz beschränktem Maße
möglich war, hat sich seit Einführung des Bessemer-
und Martinstahles zu einem großartigen Industrie-
zweige nufgeschwungen und ist für den Maschinen-,
Schiffs-, Eisenbahnbau u. s. w. heutzutage unentbehrlich.
Für die Schiffe werden von den Stahlwerken Vorder-
nnd Hinterstevcn, Ruder, Schraubenlager u. s. w. ge-
liefert, und solche Gußstücke haben oft ein Gewicht von
mehr als 50,000 Kilogramm; für den Eisenbahnbau und
-betrieb verfertigt man Herzstücke, Räder, Kuppelungen
und dergleichen, für den Maschinenbau Zylinder, Kreuz-
köpse, Steuerungsteilc, Gestelle, sowie kleine, der Ab-
nutzung stark unterliegende Teile bis hinunter zu einem
Gewicht von wenigen Gramm. Das Siemens-Martin-
verfahrcn erzeugt Stahl durch Zusammenschmelzen von
Roheisen und Schmiedeisen in einem überwölbten, mit
Quarzsand ausgekleideten Herd eines mit Regenerativ-
feuerung versehenen Flammcuofens, während beim
Bessemern das geschmolzene Roheisen in der sogenannten
Bessemerbirne durch cingepreßte Luft entkohlt wird.
Diese Bessemerbirne, die über dem Ofen beweglich an-
gebracht ist, bildet eine Retorte auS Eisenblech, die man
mit feuerfestem schamottchaltigem Ton oder Ziegeln aus-
gefüttert hat. Das Bodeustück hat konische Öffnungen
zur Aufnahme von 7 Tonformen, von denen jede wieder
7 bis 13 zylindrische Kanäle besitzt, durch welche wäh-
rend des Schmclzprozesses durch ein Gebläse Wind zn-
geführt wird. Auf unserem vortrefflichen Bilde hat uns
der Künstler die Abteilung eines Stahlwerks vor Augen
geführt, in welcher die Erzeugung von Flußstahl (Guß-
stahl) vermittels des Bessemerverfahrens vor sich geht.
Jin Hintergründe ist eine große Bessemerbirne sicht-
bar, in welcher unter gewaltiger Fcuercntwicklung das
heißflüssige Roheisen in Stahl umgewandelt wird. Rechts
in der Mitte sehen wir einen mächtigen Drehkran, der
eine eiserne Pfanne trägt. Diese hat eben eine Ladung
flüssigen Stahles aus einer Bessemerbirne ausgenommen
und entleert sie in die um den Kran ausgestellten Guß-
formen. Im Vordergründe schleppt ein Arbeiter eine
schwere, an Kette» befestigte Zange herbei, wie solche
zum AuSheben der glühenden Stahlblöcke aus den Guß-
formen und zum Verladen derselben auf die Karren
dient, von denen wir ganz rechts unten einen erblicken.
Zogrieljorll.
(Zielte clcis Lil6 ciul Zeile 73.)
s^urch die tiefen Küsteneinschnitte der Fjorde, in denen
" das Meer bis weit ins Innere des Hochgebirgs ebbt
und flutet, hat Norwegen einen ganz besonderen Charak-
ter. Der längste aller norwegischen Fjorde ist der Sogne-
fjord; er ist von Sogncfest bis Skjolden 170 Kilometer-
lang, 6 bis 7 Kilometer breit und bis zu 1200 Meter-
tief. Da eine Fahrt durch denselben in verhältnismäßig
kurzer Zeit die mannigfaltigsten Einblicke in die an
romantischen Reizen so außerordentlich reiche Natur des
Landes gewährt, da ferner an seinen Ufern verschiedene
Ausgangspunkte für den Aufstieg in die Hochgebirgs-
welt liegen, an denen die Dampfer halten, so ist der
Sognefjord von unseren Nordlandsfahrern allsommers
start besucht. Die Ufer haben schon am Eingang ge-
birgigen Charakter, und die kahlen, abgeschliffenen Höhen
gemahnen an jene Urzeit, in welcher ganz Norwegen mit
Eis bedeckt war. Der Sognefjord führt mit seinen
kleinen Seitenarmen und größeren Verzweigungen in eine
der wildesten Gegenden Norwegens. Oft steigen die
schroffen Felsenwändc fast senkrecht 1600 bis 2000 Meter
über den Wasserspiegel empor. Dies gilt besonders von
den südlichen Zweigen, dem Aurlands- und dem Närö-
fjord. Von den nördlichen Zweigen dringt der Fjär-
landsfjord bis zu den Gletschern des Jostedalsbrä vor,
die hier ins Tal tief herabsteigen. Von anderen Glet-
schern wird der Reisende nur in der Höhe weiße Zipfel
gewahr. Der Jvstedalbrä ist das größte Firnfeld Europas.
Höchst malerisch wirken die schäumenden Wasserfälle, die
da und dort über die Steilwände niederstürzen. Idyl-
lische Szenerien bringen Abwechslung in die Eindrücke.
Bisweilen bietet das Ufer Raum für Kornfelder, Obst-
gärten, freundliche Dörfer. Es fehlt denn auch nicht an
gastlichen Herbergen in diesem von ernstem Hochgebirgs-
charakler beherrschten und doch von heiteren Menschen
bewohnten Tale.
klug' um kluge.
llovellette von kl. Vogel v. Zpielberg.
„Mein Lieb!
8 war für mich ein Opfer, beinahe zwei Wochen
verstreichen zn lassen, ohne Dir zu schreiben;
allein cs mußte sein. Dir ferne, so viele viele
Meilen zwischen uns, in meinem neuen Wirkungskreise
so Halbwegs cingelcbt, trieb es mich alltäglich, Dir
immer wieder von meiner Liebe zu sprechen, und
doch durfte es nicht sein. Denn nun, da Dn mit
Deiner süßen Stimme mir die schweren Sorgen, die
mich, seitdem ich hier bin, nichr verlassen wollen,
nicht selbst auszureden vermagst, — nun scheint es
mir säst ein Verbrechen, das ich an Dir beging, in-
dem ich Dein Schicksal an meines ketten wollte. Noch
aber ist es nicht zu spät, noch kannst Dn einem
schöneren Leben cntgegengehcn, als ich es Dir zu
bieten habe. Du, meiue seine Prinzessin, bist nicht
für eine einfache Bcamtcnfrau geschaffen — Dein
stolzer Geist strebt hoch empor, und Du darfst allen
Anspruch darauf erheben, ans den Hohen der Ge-
sellschaft zn wandeln, wozu Du als Tochter ciner
Exzellenz bestimmt bist. Ich aber, meine teure Isa,
werde Dir niemals die Equipage bieten können, nach
tUackücuck vewoten.)
der sich Deine Seele sehnt, und Du bist eben
für die Equipage geboren, Du mein schönes, vor-
nehmes Lieb. Ich würde also einen Raub an Dir
nnd Deiner ganzen Zukunft begehen, wenn ich Dich
festhalten wollte. So kann nnd darf ich aber Deinem
Glück nicht im Wege stehen, ich kann die Ver-
antwortung nicht auf mich nehmen, Dich an der
Erreichung einer glänzenden Existenz gehindert zn
haben. Mein Herz blutet bei dem Gedanken, Dich,
meine Isa, zn verlieren; aber ich empfinde es als
meine heilige Pflicht, Dir Dein Wort znrückzugebcn,
um Dir zn all dem Glück, das das Leben den be-
vorzugtesten Lieblingen des Schicksals nnr spenden
kann, zu verhelfen. Das alles ist mir in den vier
Monaten meines hiesigen Aufenthaltes allmählich
klar geworden, so grausam klar, — und mein Ge-
wissen zwingt mich, dir mein Herzens- und mein
ganzes Lebcnsglück zum Opfer zu bringen.
Ich küsse und umarme Dich zum letzten Male
im Geiste . . . Leb wohl, mein Lieb! Vergiß
Deinen unglücklichen Felix."
Er las den Brief nochmals aufmerksam durch