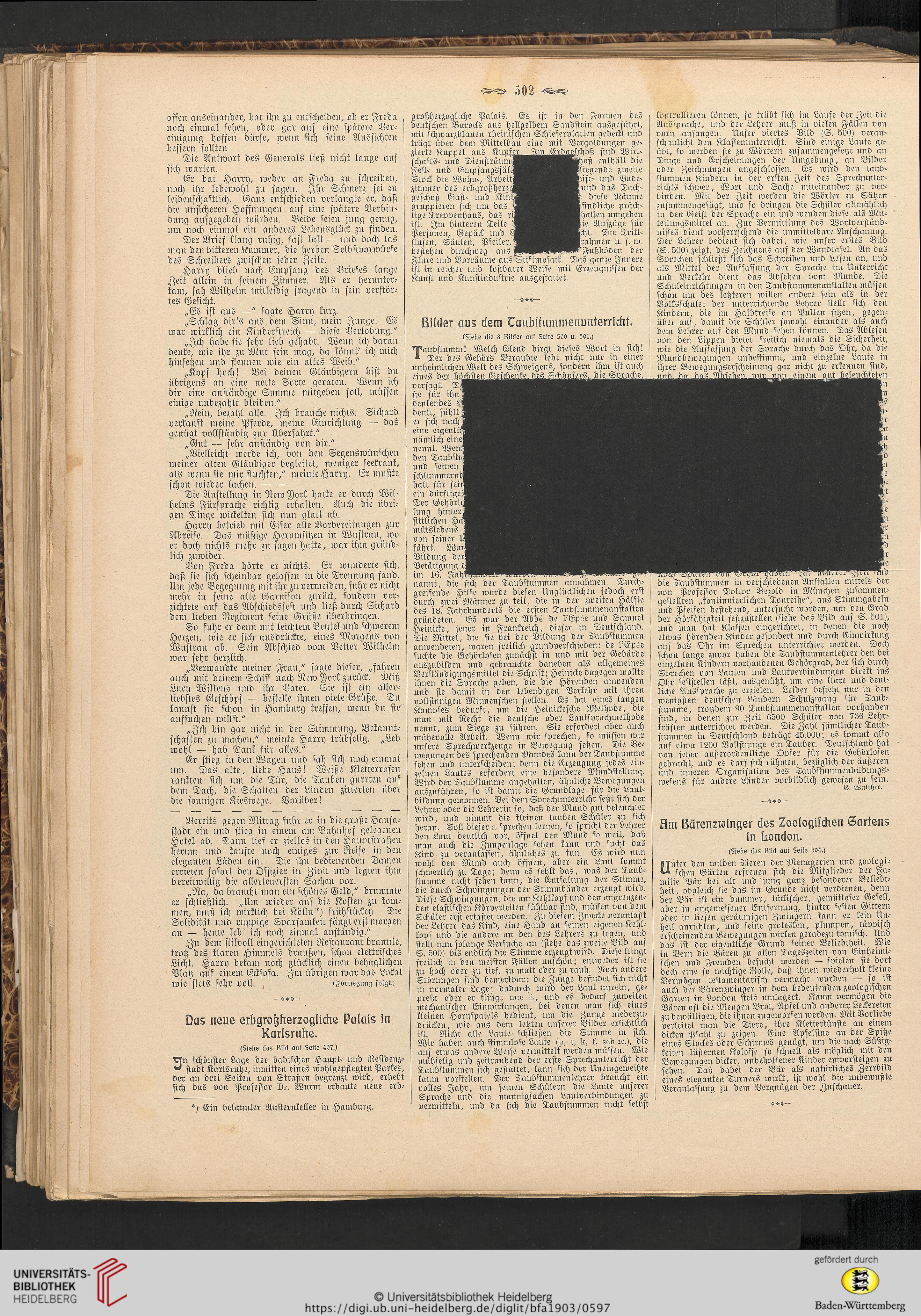502
offen auseinander, bat ihn zn entscheiden, ob er Freda
noch einmal sehen, oder gar aus eine spätere Ver-
einigung hoffen dürfe, wenn sich seine Aussichten
bessern sollten.
Die Antwort des Generals ließ nicht lange aus
sich warten.
Er bat Harry, weder an Freda zu schreiben,
noch ihr lebewohl zu sagen. Ihr Schmerz sei zu
leidenschaftlich. Ganz entschieden verlangte er, daß
die unsicheren Hoffnungen auf eine spätere Verbin-
dung aufgegeben würden. Beide seien jung genug,
um noch einmal ein anderes Lebensglück zn finden.
Der Brief klang ruhig, säst kalt — und doch las
man den bitteren Kummer, die herben Selbstvorwürfe
des Schreibers zwischen jeder Zeile.
Harry blieb nach Empfang des Briefes lange
Zeit" allein in seinem Zimmer. Als er herunter-
kam, sah Wilhelm mitleidig fragend in sein verstör-
tes Gesicht.
„Es ist aus —" sagte Harry kurz.
„Schlag dir's aus dem Sinn, mein Junge. Es
war wirklich ein Kinderstreich — diese Verlobung."
„Ich habe sie sehr lieb gehabt. Wenn ich daran
denke, wie ihr zu Mut sein mag, da könnt' ich mich
hinsetzen und flennen wie ein altes Weib."
„Kopf hoch! Bei deinen Gläubigern bist du
übrigens an eine nette Sorte geraten. Wenn ich
dir eine anständige Summe mitgeben soll, müssen
einige unbezahlt bleiben."
„Nein, bezahl alle. Ich brauche nichts. Sichard
verkauft meine Pferde, meine Einrichtung — das
genügt vollständig zur überfahrt."
„Gut -- sehr anständig von dir."
„Vielleicht werde ich, von den Segenswünschen
meiner alten Gläubiger begleitet, weniger seekrank,
als wenn sie mir fluchten," meinte Harry. Er mußte
schon wieder lachen. — —
Die Anstellung in New Jork hatte er durch Wil-
helms Fürsprache richtig erhalten. Auch die übri-
gen Dinge wickelten sich nun glatt ab.
Harry betrieb mit Eifer alle Vorbereitungen zur
Abreise. Das müßige Herumsitzen in Wnstrau, wo
er doch nichts mehr zn sagen hatte, war ihm gründ-
lich zuwider.
Von Freda hörte er nichts. Er wunderte sich,
daß sie sich scheinbar gelassen in die Trennung fand.
Uni jede Begegnung mit ihr zu vermeiden, fuhr er nicht
mehr in seine alte Garnison zurück, sondern ver-
zichtete auf das Abschiedsfest und ließ durch Sichard
dem liebeu Regiment seine Grüße überbringen.
So fuhr er denn mit leichtem Beutel und schwerem
Herzen, wie er sich ausdrückte, eines Morgens von
Wustrau ab. Sein Abschied vom Vetter Wilhelm
war sehr herzlich.
„Verwandte meiner Frau," sagte dieser, „fahren
auch mit deinem Schiff nach New Jork zurück. Miß
Lucy Wilkens und ihr Vater. Sie ist ein aller-
liebstes Geschöpf — bestelle ihnen viele Grüße. Du
kannst sie schon in Hamburg treffen, wenn du sie
aufsuchen willst."
„Ich bin gar nicht in der Stimmung, Bekannt-
schaften zu machen," meinte Harry trübselig. „Leb
wohl — hab Tank für alles."
Er stieg in den Wagen und sah sich noch einmal
um. Das alte, liebe Haus! Weiße Kletterrosen
rankten sich um die Tür, die Tauben gurrten ans
dem Dach, die Schatten der Linden zitterten über
die sonnigen Kieswege. Vorüber!
Bereits gegen Mittag fuhr er in die große Hansa-
stadt ein und stieg in einem am Bahnhof gelegenen
Hotel ab. Dann lief er ziellos in den Hauptstraßen
herum und kaufte noch einiges zur Reise in den
eleganten Läden ein. Die ihn bedienenden Damen
errieten sofort den Offizier in Zivil und legten ihm
bereitwillig die allerteuersten Sachen vor.
„Na, da braucht man ein schönes Geld," brummte
er schließlich. „Um wieder auf die Kosten zn kom-
men, muß ich wirklich bei Kölln*) frühstücken. Die
Solidität und ruppige Sparsamkeit sängt erst'morgen
an — heute leb' ich noch einmal anständig."
In dem stilvoll eingerichteten Restaurant brannte,
trotz des klaren Himmels draußen, schon elektrisches
Licht. Harry bekam noch glücklich einen behaglichen
Platz ans einem Ecksofa. Im übrigen war das Lokal
wie stets sehr voll. (Fortsetzung folgt.)
Vas NSUC CrbgrohlisrioglickL pcilciis in
kcirlsruks.
(Zieke das Lilcl ciuk Zsi'ts 4Y7.)
schönster Lage der badischen Haupt- und Residenz-
stadt Karlsruhe, inmitten eines wohlgepflegten Parkes,
der an drei Seiten von Straßen begrenzt wird, erhebt
sich das von Professor vr. Wurm erbaute neue erb-
*) Ein bekannter Austernkeller in Hamburg.
großherzogliche Palais. Es ist in den Formen des
deutschen Barocks aus hellgelbem Sandstein ausgeführt,
mit schwarzblauen rheinischen Schieferplatten gedeckt und
trägt über dem Mittelbau eine mit Vergoldungen ge-
zierte Kuppel aus sind Wirt-
schasls- und T enslräum>WWWWWMMyoß enthüll die
und
-lock
zimmer des erbgroßhcrzc^^^^^^^Wund das
und diese
gruppieren um das kindliche präch-
umgeben
Zeile Auszüge
Personen, Gepäck und Tie Triti-
stuscn, Säulen,
bestehen durchweg aus Fußböden der
Flure und Borrciume aus stiftmosaik. Das ganze Innere
ist in reicher und kostbarer Weise mit Erzeugnissen der
Kunst und Kunstindustrie ausgestattet.
kontrollieren können, so trübt sich im Laufe der Zeit die
Aussprache, und der Lehrer muß in vielen Fällen von
vorn anfangen. Unser viertes Bild (S. 600) veran-
schaulicht den Klassenunterricht. Sind einige Laute ge-
übt, so werden sie zu Wörtern zusammengesetzt und an
Dinge und Erscheinungen der Umgebung, an Bilder
oder Zeichnungen angeschlossen. Es wird den taub-
stummen Kindern in der ersten Zeit des Sprechunter-
richts schwer, Wort und Sache miteinander zu ver-
binden. Mit der Zeit werden die Wörter zu Sätzen
zusammengefügt, und so dringen dis Schüler allmählich
in den Geist der Sprache ein und wenden diese als Mit-
teilungsmittel an. Zur Vermittlung des Wortverständ-
nisses dient vorherrschend die unmittelbare Anschauung.
Der Lehrer bedient sich dabei, wie unser erstes Bild
(S. 500) zeigt, des Zeichnens auf der Wandtafel. An das
Sprechen schließt sich das Schreiben und Lesen an, und
als Mittel der Auffassung der Sprache im Unterricht
und Verkehr dient das Absehen vom Munde. Die
ünem gut beleuchteten
wvirrs,. die Sprache,
Schuleinrichtungen in den Taubstummenanstalten müssen
schon um des letzteren willen andere sein als in der
Volksschule: der unterrichtende Lehrer stellt sich den
Kindern, die im Halbkreise an Pulten sitzen, gegen-
über auf, damit die Schüler sowohl einander als auch
dem Lehrer auf den Mund sehen können. Das Ablesen
von den Lippen bietet freilich niemals die Sicherheit,
wie die Auffassung der Sprache durch das Ohr, da die
Mundbewegungen unbestimmt, und einzelne Laute in
gestellten „kontinuierlichen Tonreihe", aus Stimmgabeln
und Pfeifen bestehend, untersucht worden, um den Grad
der Hörfähigkeit festzustellen (siehe das Bild aus S. 601),
und man hat Klassen eingerichtet, in denen die noch
etwas hörenden Kinder gesondert und durch Einwirkung
auf das Ohr im Sprechen unterrichtet werden. Doch
schon lange zuvor haben die Taubstummenleyrer den bei
einzelnen Kindern vorhandenen Gehörgrad, der sich durch
Sprechen von Lauten und Lautverbindungen direkt ins
Ohr feststellen läßt, ausgenützt, um eine klare und deut-
liche Aussprache zu erzielen. Leider besteht nur in den
wenigsten deutschen Ländern Schulzwang für Taub-
stumme, trotzdem SO Taubstummenanstalten vorhanden
sind, in denen zur Zeit 6500 Schüler von 736 Lehr-
kräften unterrichtet werden. Die Zahl sämtlicher Taub-
stummen in Deutschland beträgt 46,000; es kommt also
auf etwa 1200 Vollsinnige ein Tauber. Deutschland hat -
von jeher außerordentliche Opfer für die Gehörlosen
gebracht, und es darf sich rühmen, bezüglich der äußeren
und inneren Organisation des Taubstummenbildungs-
wesens für andere Länder vorbildlich gewesen zu sein.
E. Walther.
tim kcirsnrlomgsr dss loologilcksn Scirtsns
in Kondom
(Zi'skis dcis Lild ciuk Zelts 504.)
Hinter den wilden Tieren der Menagerien und zoologi-
schen Gärten erfreuen sich die Mitglieder der Fa-
milie Bär bei alt und jung ganz besonderer Beliebt-
heit, obgleich sie das im Grunde nicht verdienen, denn
der Bär' ist ein dummer, tückischer, gemütloser Gesell,
aber in angemessener Entfernung, hinter festen Gittern
oder in tiefen geräumigen Zwingern kann er kein Un-
heil anrichten, und seine grotesken, plumpen, täppisch
erscheinenden Bewegungen wirken geradezu komisch. Und
das ist der eigentliche Grund seiner Beliebtheit. Wie
in Bern die Bären zu allen Tageszeiten von Einheimi-
schen und Fremden besucht werden — spielen sie dort
doch eine so wichtige Rolle, daß ihnen wiederholt kleine
Vermögen testamentarisch vermacht wurden — so ist
auch der Bärenzwinger in dem bedeutenden zoologischen
Garten in London stets umlagert. Kaum vermögen die
Bären oft die Mengen Brot, Äpfel und anderer Leckereien
zu bewältigen, die ihnen zugeworfen werden. Mit Vorliebe
verleitet man die Tiere, ihre Kletterkünste an einem
dicken Pfahl zu zeigen. Eine Apfelsine an der SM?
eines Stockes oder Schirmes genügt, um die nach Süßig-
keiten lüsternen Kolosse so schnell als möglich mit den
Bewegungen dicker, unbeholfener Kinder emporsteigen zu
sehen. Daß dabei der Bär als natürliches Zerrbild
eines eleganten Turners wirkt, ist wohl die unbewußte
Veranlassung za dem Vergnügen der Zuschauer.
kildsr aus dem ^aubltummemmterrickt.
(Zieks hie 8 Lilcker ciuk Seite Z00 u. Z0I.)
1>aubstumm! Welch Elend birgt dieses Wort in sich!
Der des Gehörs Beraubte lebt nicht nur in einer
unheimlicher - - -
eines der hö
versagt. Ty
sie für ihn
denkendes N
denkt, fühlte
er sich nach
eine eigenti?
nämlich eine
nennt. Wen,
den Taubstu
und seinen
schlummernd
halt für sei)
ein dürftige-
Der Gehörst
lung hinter
sittlichen Hä
mütslebens
von seiner 1
fährt. Wm
Bildung de>
Betätigung -
im 16. Iah
nannt, die sich der Taubstummen annahmen. Durch- die Taubstummen in verschiedenen Anstalten mittels der
greifende Hilfe wurde diesen Unglücklichen jedoch erst von Professor Doktor Bezold in München zusammen-
durch zwei'Männer zu teil, die in der zweiten Hälfte " " " - " - — » - ----
des 18. Jahrhunderts die ersten Taubstummenanstalten
gründeten. Es war der Abbo de l'Epse und Samuel
Heinicke, jener in Frankreich, dieser in Deutschland.
Die Mittel, die sie bei der Bildung der Taubstummen
anwendeten, waren freilich grundverschieden: de l'Epse
suchte die Gehörlosen zunächst in und mit der Gebärde
auszubilden und gebrauchte daneben als allgemeines
Verständigungsmittel die Schrift; Heinicke dagegen wollte
ihnen die Sprache geben, die die Hörenden anwenden
und sie damit in den lebendigen Verkehr mit ihren
vollsinnigen Mitmenschen stellen. Es hat eines langen
Kampfes bedurft, um die Heinickesche Methode, die
man mit Recht die deutsche oder Lautsprachmethode
nennt, zum Siege zu führen. Sie erfordert aber auch
mühevolle Arbeit. Wenn wir sprechen, so müssen wir
unsere Sprechwerkzeuge in Bewegung setzen. Die Be-
wegungen des sprechenden Mundes kann der Taubstumme
sehen und unterscheiden; denn die Erzeugung jedes ein-
zelnen Lautes erfordert eine besondere Mundstellung.
Wird der Taubstumme angehalten, ähnliche Bewegungen
auszuführen, so ist damit die Grundlage für die Laut-
bildung gewonnen. Bei dem Sprechunterricht setzt sich der
Lehrer oder die Lehrerin so, daß der Mund gut beleuchtet
wird, und nimmt die kleinen tauben Schüler zu sich
heran. Soll dieser a sprechen lernen, so spricht der Lehrer
den Laut deutlich vor, öffnet den Mund so weit, daß
man auch die Zungenlage sehen kann und sucht das
Kind zu veranlassen, ähnliches zu tun. Es wird nun
wohl den Mund auch öffnen, aber ein Laut kommt
schwerlich zu Tage; denn es fehlt das, was der Taub-
stumme nicht sehen kann, die Entfaltung der Stimme,
die durch Schwingungen der Stimmbänder erzeugt wird.
Diese Schwingungen, die am Kehlkopf und den angrenzen-
den elastischen Körperteilen fühlbar sind, müssen von dem
Schüler erst ertastet werden. Zu diesem Zwecke veranlaßt
der Lehrer das Kind, eine Hand an seinen eigenen Kehl-
kopf und die andere an den des Lehrers zu legen, und
stellt nun solange Versuche an (siehe das zweite Bild auf
S. 500) bis endlich die Stimme erzeugt wird. Diese klingt
freilich in den meisten Fällen unschön; entweder ist sie
zu hoch oder zu tief, zu matt oder zu rauh. Noch andere
Störungen sind bemerkbar: die Zunge befindet sich nicht
in normaler Lage; dadurch wird der Laut unrein, ge-
preßt oder er klingt wie L, und es bedarf zuweilen
mechanischer Einwirkungen, bei denen man sich eines
kleinen Hornspatels bedient, um die Zunge niederzu-
drücken, wie aus dem letzten unserer Bilder ersichtlich
ist. Nicht alle Laute schließen die Stimme in sich.
Wir haben auch stimmlose Laute (p, t, k, 1, soll re.), die
auf etwas andere Weise vermittelt werden müssen. Wie
mühselig und zeitraubend der erste Sprechunterricht der
Taubstummen sich gestaltet, kann sich der Uneingeweihte
kaum vorstellen. Der Taübstuinmenlehrer braucht ein
volles Jahr, um seinen Schülern die Laute unserer
Sprache und die mannigfachen Lautverbindungen zu
vermitteln, und da sich die Taubstummen nicht selbst
offen auseinander, bat ihn zn entscheiden, ob er Freda
noch einmal sehen, oder gar aus eine spätere Ver-
einigung hoffen dürfe, wenn sich seine Aussichten
bessern sollten.
Die Antwort des Generals ließ nicht lange aus
sich warten.
Er bat Harry, weder an Freda zu schreiben,
noch ihr lebewohl zu sagen. Ihr Schmerz sei zu
leidenschaftlich. Ganz entschieden verlangte er, daß
die unsicheren Hoffnungen auf eine spätere Verbin-
dung aufgegeben würden. Beide seien jung genug,
um noch einmal ein anderes Lebensglück zn finden.
Der Brief klang ruhig, säst kalt — und doch las
man den bitteren Kummer, die herben Selbstvorwürfe
des Schreibers zwischen jeder Zeile.
Harry blieb nach Empfang des Briefes lange
Zeit" allein in seinem Zimmer. Als er herunter-
kam, sah Wilhelm mitleidig fragend in sein verstör-
tes Gesicht.
„Es ist aus —" sagte Harry kurz.
„Schlag dir's aus dem Sinn, mein Junge. Es
war wirklich ein Kinderstreich — diese Verlobung."
„Ich habe sie sehr lieb gehabt. Wenn ich daran
denke, wie ihr zu Mut sein mag, da könnt' ich mich
hinsetzen und flennen wie ein altes Weib."
„Kopf hoch! Bei deinen Gläubigern bist du
übrigens an eine nette Sorte geraten. Wenn ich
dir eine anständige Summe mitgeben soll, müssen
einige unbezahlt bleiben."
„Nein, bezahl alle. Ich brauche nichts. Sichard
verkauft meine Pferde, meine Einrichtung — das
genügt vollständig zur überfahrt."
„Gut -- sehr anständig von dir."
„Vielleicht werde ich, von den Segenswünschen
meiner alten Gläubiger begleitet, weniger seekrank,
als wenn sie mir fluchten," meinte Harry. Er mußte
schon wieder lachen. — —
Die Anstellung in New Jork hatte er durch Wil-
helms Fürsprache richtig erhalten. Auch die übri-
gen Dinge wickelten sich nun glatt ab.
Harry betrieb mit Eifer alle Vorbereitungen zur
Abreise. Das müßige Herumsitzen in Wnstrau, wo
er doch nichts mehr zn sagen hatte, war ihm gründ-
lich zuwider.
Von Freda hörte er nichts. Er wunderte sich,
daß sie sich scheinbar gelassen in die Trennung fand.
Uni jede Begegnung mit ihr zu vermeiden, fuhr er nicht
mehr in seine alte Garnison zurück, sondern ver-
zichtete auf das Abschiedsfest und ließ durch Sichard
dem liebeu Regiment seine Grüße überbringen.
So fuhr er denn mit leichtem Beutel und schwerem
Herzen, wie er sich ausdrückte, eines Morgens von
Wustrau ab. Sein Abschied vom Vetter Wilhelm
war sehr herzlich.
„Verwandte meiner Frau," sagte dieser, „fahren
auch mit deinem Schiff nach New Jork zurück. Miß
Lucy Wilkens und ihr Vater. Sie ist ein aller-
liebstes Geschöpf — bestelle ihnen viele Grüße. Du
kannst sie schon in Hamburg treffen, wenn du sie
aufsuchen willst."
„Ich bin gar nicht in der Stimmung, Bekannt-
schaften zu machen," meinte Harry trübselig. „Leb
wohl — hab Tank für alles."
Er stieg in den Wagen und sah sich noch einmal
um. Das alte, liebe Haus! Weiße Kletterrosen
rankten sich um die Tür, die Tauben gurrten ans
dem Dach, die Schatten der Linden zitterten über
die sonnigen Kieswege. Vorüber!
Bereits gegen Mittag fuhr er in die große Hansa-
stadt ein und stieg in einem am Bahnhof gelegenen
Hotel ab. Dann lief er ziellos in den Hauptstraßen
herum und kaufte noch einiges zur Reise in den
eleganten Läden ein. Die ihn bedienenden Damen
errieten sofort den Offizier in Zivil und legten ihm
bereitwillig die allerteuersten Sachen vor.
„Na, da braucht man ein schönes Geld," brummte
er schließlich. „Um wieder auf die Kosten zn kom-
men, muß ich wirklich bei Kölln*) frühstücken. Die
Solidität und ruppige Sparsamkeit sängt erst'morgen
an — heute leb' ich noch einmal anständig."
In dem stilvoll eingerichteten Restaurant brannte,
trotz des klaren Himmels draußen, schon elektrisches
Licht. Harry bekam noch glücklich einen behaglichen
Platz ans einem Ecksofa. Im übrigen war das Lokal
wie stets sehr voll. (Fortsetzung folgt.)
Vas NSUC CrbgrohlisrioglickL pcilciis in
kcirlsruks.
(Zieke das Lilcl ciuk Zsi'ts 4Y7.)
schönster Lage der badischen Haupt- und Residenz-
stadt Karlsruhe, inmitten eines wohlgepflegten Parkes,
der an drei Seiten von Straßen begrenzt wird, erhebt
sich das von Professor vr. Wurm erbaute neue erb-
*) Ein bekannter Austernkeller in Hamburg.
großherzogliche Palais. Es ist in den Formen des
deutschen Barocks aus hellgelbem Sandstein ausgeführt,
mit schwarzblauen rheinischen Schieferplatten gedeckt und
trägt über dem Mittelbau eine mit Vergoldungen ge-
zierte Kuppel aus sind Wirt-
schasls- und T enslräum>WWWWWMMyoß enthüll die
und
-lock
zimmer des erbgroßhcrzc^^^^^^^Wund das
und diese
gruppieren um das kindliche präch-
umgeben
Zeile Auszüge
Personen, Gepäck und Tie Triti-
stuscn, Säulen,
bestehen durchweg aus Fußböden der
Flure und Borrciume aus stiftmosaik. Das ganze Innere
ist in reicher und kostbarer Weise mit Erzeugnissen der
Kunst und Kunstindustrie ausgestattet.
kontrollieren können, so trübt sich im Laufe der Zeit die
Aussprache, und der Lehrer muß in vielen Fällen von
vorn anfangen. Unser viertes Bild (S. 600) veran-
schaulicht den Klassenunterricht. Sind einige Laute ge-
übt, so werden sie zu Wörtern zusammengesetzt und an
Dinge und Erscheinungen der Umgebung, an Bilder
oder Zeichnungen angeschlossen. Es wird den taub-
stummen Kindern in der ersten Zeit des Sprechunter-
richts schwer, Wort und Sache miteinander zu ver-
binden. Mit der Zeit werden die Wörter zu Sätzen
zusammengefügt, und so dringen dis Schüler allmählich
in den Geist der Sprache ein und wenden diese als Mit-
teilungsmittel an. Zur Vermittlung des Wortverständ-
nisses dient vorherrschend die unmittelbare Anschauung.
Der Lehrer bedient sich dabei, wie unser erstes Bild
(S. 500) zeigt, des Zeichnens auf der Wandtafel. An das
Sprechen schließt sich das Schreiben und Lesen an, und
als Mittel der Auffassung der Sprache im Unterricht
und Verkehr dient das Absehen vom Munde. Die
ünem gut beleuchteten
wvirrs,. die Sprache,
Schuleinrichtungen in den Taubstummenanstalten müssen
schon um des letzteren willen andere sein als in der
Volksschule: der unterrichtende Lehrer stellt sich den
Kindern, die im Halbkreise an Pulten sitzen, gegen-
über auf, damit die Schüler sowohl einander als auch
dem Lehrer auf den Mund sehen können. Das Ablesen
von den Lippen bietet freilich niemals die Sicherheit,
wie die Auffassung der Sprache durch das Ohr, da die
Mundbewegungen unbestimmt, und einzelne Laute in
gestellten „kontinuierlichen Tonreihe", aus Stimmgabeln
und Pfeifen bestehend, untersucht worden, um den Grad
der Hörfähigkeit festzustellen (siehe das Bild aus S. 601),
und man hat Klassen eingerichtet, in denen die noch
etwas hörenden Kinder gesondert und durch Einwirkung
auf das Ohr im Sprechen unterrichtet werden. Doch
schon lange zuvor haben die Taubstummenleyrer den bei
einzelnen Kindern vorhandenen Gehörgrad, der sich durch
Sprechen von Lauten und Lautverbindungen direkt ins
Ohr feststellen läßt, ausgenützt, um eine klare und deut-
liche Aussprache zu erzielen. Leider besteht nur in den
wenigsten deutschen Ländern Schulzwang für Taub-
stumme, trotzdem SO Taubstummenanstalten vorhanden
sind, in denen zur Zeit 6500 Schüler von 736 Lehr-
kräften unterrichtet werden. Die Zahl sämtlicher Taub-
stummen in Deutschland beträgt 46,000; es kommt also
auf etwa 1200 Vollsinnige ein Tauber. Deutschland hat -
von jeher außerordentliche Opfer für die Gehörlosen
gebracht, und es darf sich rühmen, bezüglich der äußeren
und inneren Organisation des Taubstummenbildungs-
wesens für andere Länder vorbildlich gewesen zu sein.
E. Walther.
tim kcirsnrlomgsr dss loologilcksn Scirtsns
in Kondom
(Zi'skis dcis Lild ciuk Zelts 504.)
Hinter den wilden Tieren der Menagerien und zoologi-
schen Gärten erfreuen sich die Mitglieder der Fa-
milie Bär bei alt und jung ganz besonderer Beliebt-
heit, obgleich sie das im Grunde nicht verdienen, denn
der Bär' ist ein dummer, tückischer, gemütloser Gesell,
aber in angemessener Entfernung, hinter festen Gittern
oder in tiefen geräumigen Zwingern kann er kein Un-
heil anrichten, und seine grotesken, plumpen, täppisch
erscheinenden Bewegungen wirken geradezu komisch. Und
das ist der eigentliche Grund seiner Beliebtheit. Wie
in Bern die Bären zu allen Tageszeiten von Einheimi-
schen und Fremden besucht werden — spielen sie dort
doch eine so wichtige Rolle, daß ihnen wiederholt kleine
Vermögen testamentarisch vermacht wurden — so ist
auch der Bärenzwinger in dem bedeutenden zoologischen
Garten in London stets umlagert. Kaum vermögen die
Bären oft die Mengen Brot, Äpfel und anderer Leckereien
zu bewältigen, die ihnen zugeworfen werden. Mit Vorliebe
verleitet man die Tiere, ihre Kletterkünste an einem
dicken Pfahl zu zeigen. Eine Apfelsine an der SM?
eines Stockes oder Schirmes genügt, um die nach Süßig-
keiten lüsternen Kolosse so schnell als möglich mit den
Bewegungen dicker, unbeholfener Kinder emporsteigen zu
sehen. Daß dabei der Bär als natürliches Zerrbild
eines eleganten Turners wirkt, ist wohl die unbewußte
Veranlassung za dem Vergnügen der Zuschauer.
kildsr aus dem ^aubltummemmterrickt.
(Zieks hie 8 Lilcker ciuk Seite Z00 u. Z0I.)
1>aubstumm! Welch Elend birgt dieses Wort in sich!
Der des Gehörs Beraubte lebt nicht nur in einer
unheimlicher - - -
eines der hö
versagt. Ty
sie für ihn
denkendes N
denkt, fühlte
er sich nach
eine eigenti?
nämlich eine
nennt. Wen,
den Taubstu
und seinen
schlummernd
halt für sei)
ein dürftige-
Der Gehörst
lung hinter
sittlichen Hä
mütslebens
von seiner 1
fährt. Wm
Bildung de>
Betätigung -
im 16. Iah
nannt, die sich der Taubstummen annahmen. Durch- die Taubstummen in verschiedenen Anstalten mittels der
greifende Hilfe wurde diesen Unglücklichen jedoch erst von Professor Doktor Bezold in München zusammen-
durch zwei'Männer zu teil, die in der zweiten Hälfte " " " - " - — » - ----
des 18. Jahrhunderts die ersten Taubstummenanstalten
gründeten. Es war der Abbo de l'Epse und Samuel
Heinicke, jener in Frankreich, dieser in Deutschland.
Die Mittel, die sie bei der Bildung der Taubstummen
anwendeten, waren freilich grundverschieden: de l'Epse
suchte die Gehörlosen zunächst in und mit der Gebärde
auszubilden und gebrauchte daneben als allgemeines
Verständigungsmittel die Schrift; Heinicke dagegen wollte
ihnen die Sprache geben, die die Hörenden anwenden
und sie damit in den lebendigen Verkehr mit ihren
vollsinnigen Mitmenschen stellen. Es hat eines langen
Kampfes bedurft, um die Heinickesche Methode, die
man mit Recht die deutsche oder Lautsprachmethode
nennt, zum Siege zu führen. Sie erfordert aber auch
mühevolle Arbeit. Wenn wir sprechen, so müssen wir
unsere Sprechwerkzeuge in Bewegung setzen. Die Be-
wegungen des sprechenden Mundes kann der Taubstumme
sehen und unterscheiden; denn die Erzeugung jedes ein-
zelnen Lautes erfordert eine besondere Mundstellung.
Wird der Taubstumme angehalten, ähnliche Bewegungen
auszuführen, so ist damit die Grundlage für die Laut-
bildung gewonnen. Bei dem Sprechunterricht setzt sich der
Lehrer oder die Lehrerin so, daß der Mund gut beleuchtet
wird, und nimmt die kleinen tauben Schüler zu sich
heran. Soll dieser a sprechen lernen, so spricht der Lehrer
den Laut deutlich vor, öffnet den Mund so weit, daß
man auch die Zungenlage sehen kann und sucht das
Kind zu veranlassen, ähnliches zu tun. Es wird nun
wohl den Mund auch öffnen, aber ein Laut kommt
schwerlich zu Tage; denn es fehlt das, was der Taub-
stumme nicht sehen kann, die Entfaltung der Stimme,
die durch Schwingungen der Stimmbänder erzeugt wird.
Diese Schwingungen, die am Kehlkopf und den angrenzen-
den elastischen Körperteilen fühlbar sind, müssen von dem
Schüler erst ertastet werden. Zu diesem Zwecke veranlaßt
der Lehrer das Kind, eine Hand an seinen eigenen Kehl-
kopf und die andere an den des Lehrers zu legen, und
stellt nun solange Versuche an (siehe das zweite Bild auf
S. 500) bis endlich die Stimme erzeugt wird. Diese klingt
freilich in den meisten Fällen unschön; entweder ist sie
zu hoch oder zu tief, zu matt oder zu rauh. Noch andere
Störungen sind bemerkbar: die Zunge befindet sich nicht
in normaler Lage; dadurch wird der Laut unrein, ge-
preßt oder er klingt wie L, und es bedarf zuweilen
mechanischer Einwirkungen, bei denen man sich eines
kleinen Hornspatels bedient, um die Zunge niederzu-
drücken, wie aus dem letzten unserer Bilder ersichtlich
ist. Nicht alle Laute schließen die Stimme in sich.
Wir haben auch stimmlose Laute (p, t, k, 1, soll re.), die
auf etwas andere Weise vermittelt werden müssen. Wie
mühselig und zeitraubend der erste Sprechunterricht der
Taubstummen sich gestaltet, kann sich der Uneingeweihte
kaum vorstellen. Der Taübstuinmenlehrer braucht ein
volles Jahr, um seinen Schülern die Laute unserer
Sprache und die mannigfachen Lautverbindungen zu
vermitteln, und da sich die Taubstummen nicht selbst