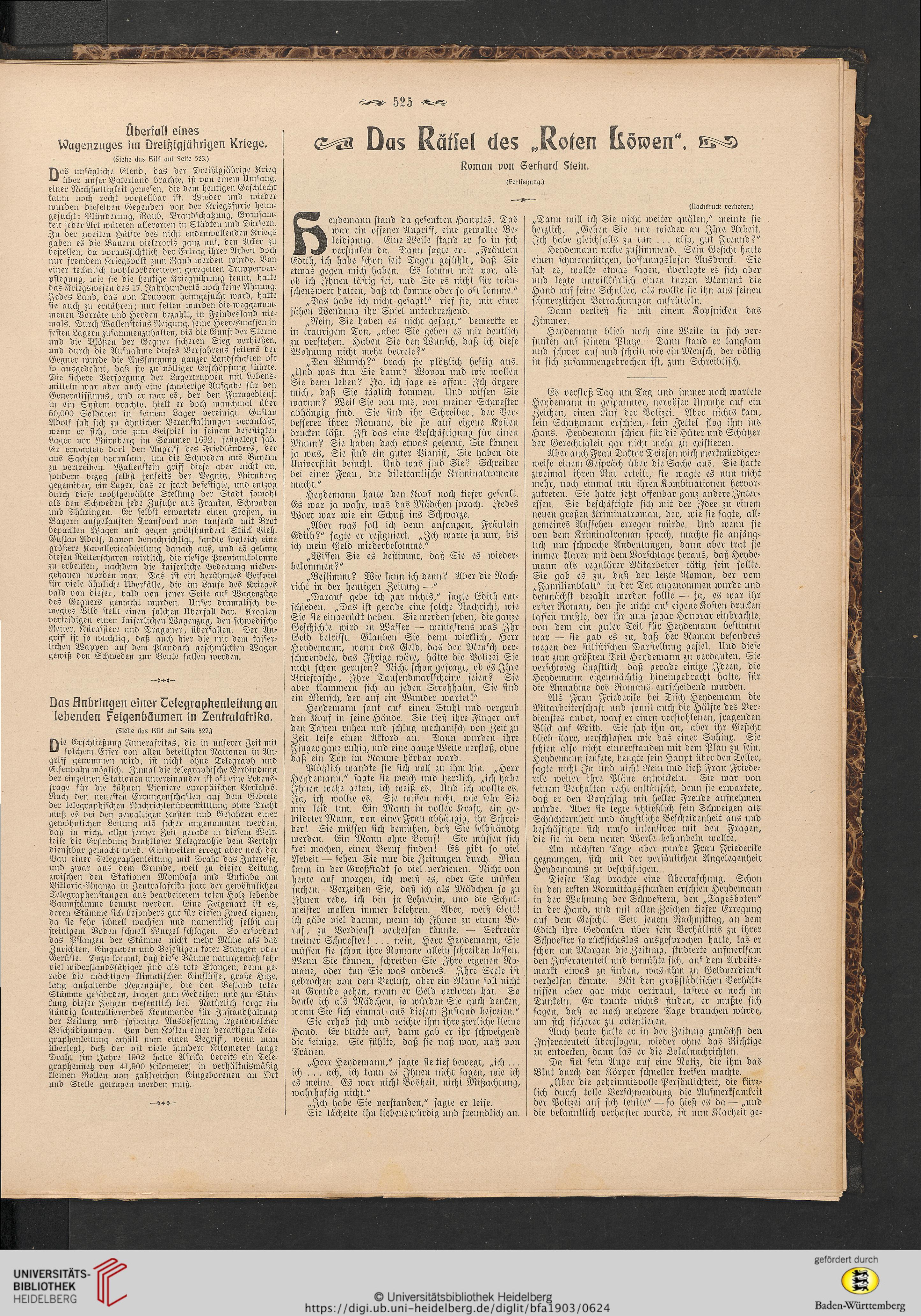525 ^ ^s-
Überkall eines
Mgsnruges im vreißigjäkrigsn Kriegs.
<5ielie das Nild auk Seite 523.)
I^as unsägliche Elend, das der Dreißigjährige Krieg
" über unser Vaterland brachte, ist von einem Umsang,
einer Nachhaltigkeit gewesen, die dem heutigen Geschlecht
kaum noch recht vorstellbar ist. Wieder und wieder
wurden dieselben Gegenden von der Kriegsfurie heim-
gesucht; Plünderung, Raub, Brandschatzung, Grausam-
keit jeder Art wüteten allerorten in Städten und Dörfern.
In der zweiten Hälfte des nicht endenwollenden Kriegs
gaben es die Bauern vielerorts ganz auf, den Acker zu
bestellen, da voraussichtlich der Ertrag ihrer Arbeit doch
nur sremdem Kriegsvolk zum Raub werden würde. Von
einer technisch wohlvorbereiteten geregelten Truppenver-
pflegung, wie sie die heutige Kriegführung kennt, hatte
das Kriegswesen des 17. Jahrhunderts noch keine Ahnung.
Jedes Land, das von Truppen heimgesucht ward, hatte
sie auch zu ernähren; nur selten wurden die weggenom-
menen Vorräte und Herden bezahlt, in Feindesland nie-
mals. Durch Wallensteins Neigung, seine Heeresmassen in
festen Lagern zusammenzuhalten, bis die Gunst der Sterne
und die B.lößen der Gegner sicheren Sieg verhießen,
und durch die Aufnahme dieses Verfahrens seitens der
Gegner wurde die Aussaugung ganzer Landschaften oft
so ausgedehnt, daß sie zu völliger Erschöpfung führte.
Die sichere Versorgung der Lagertruppen mit Lebens-
mitteln mar aber auch eine schwierige Ausgabe für den
Generalissimus, und er war es, der den Furagedienst
in ein System brachte, hielt er doch manchmal über
50,000 Soldaten in seinem Lager vereinigt. Gustav
Adolf sah sich zu ähnlichen Veranstaltungen veranlaßt,
wenn er sich, wie zum Beispiel in seinem befestigten
Lager vor Nürnberg im Sommer 1632, festgelegt sah.
Er erwartete dort den Angriff des Friedländers, der
aus Sachsen herankam, um die Schweden aus Bayern
zu vertreiben. Wallenstein griff diese aber nicht an,
sondern bezog selbst jenseits der Pegnitz, Nürnberg
gegenüber, ein Lager, das er stark befestigte, und entzog
durch diese wohlgewählte Stellung der Stadt sowohl
als den Schweden jede Zufuhr aus Franken, Schwaben
und Thüringen. Er selbst erwartete einen großen, in
Bayern aufgekauften Transport von tausend mit Brot
bepackten Wagen und gegen zwölfhundert Stück Vieh.
Gustav Adolf, davon benachrichtigt, sandte sogleich eine
größere Kavallerieabteilung danach aus, und es gelang
diesen Reiterscharen wirklich, die riesige Proviantkolonne
zu erbeuten, nachdem die kaiserliche Bedeckung nieder-
gehauen worden war. Das ist ein berühmtes Beispiel
sür viele ähnliche Überfälle, die im Laufe des Krieges
bald von dieser, bald von jener Seite auf Wagenzüge
des Gegners gemacht wurden. Unser dramatisch be-
wegtes Bild stellt einen solchen Überfall dar. Kroaten
verteidigen einen kaiserlichen Wagenzug, den schwedische
Reiter, Kürassiere und Dragoner, überfallen. Der An-
griff ist so wuchtig, daß auch hier die mit dem kaiser-
lichen Wappen auf dem Plandach geschmückten Wagen
gewiß den Schweden zur Beute fallen werden.
Das ^übriligsü einer ^elegrciptienleitung an
lebenäen Feigenbäumen in lentralakrikn.
(Stelle das Nild auk Saite 527.)
k^ie Erschließung Jnnerafrikas, die in unserer Zeit mit
solchem Eifer von allen beteiligten Nationen in An-
griff genommen wird, ist nicht ohne Telegraph und
Eisenbahn möglich. Zumal die telegraphische Verbindung
der einzelnen Stationen untereinander ist oft eine Lebens-
frage für die kühnen Pioniere europäischen Verkehrs.
Nach den neuesten Errungenschaften auf dem Gebiete
der telegraphischen Nachrichtenübermittlung ohne Draht
muß es bei den gewaltigen Kosten und Gefahren einer
gewöhnlichen Leitung als sicher angenommen werden,
daß in nicht allzu ferner Zeit gerade in diesem Welt-
teile die Erfindung drahtloser Telegraphie dem Verkehr
dienstbar gemacht wird. Einstiveilen erregt aber noch der
Bau einer Telegraphenleitung mit Draht das Interesse,
und zwar aus dem Grunde, weil zu dieser Leitung
zwischen den Stationen Mombasa und Butiaba am
Viktoria-Nyanza in Zentralafrika statt der gewöhnlichen
Telegraphenstangen aus bearbeitetem toten Holz lebende
Baumstämme benutzt werden. Eine Feigenart ist es,
deren Stämme sich besonders gut für diesen Zweck eignen,
da sie sehr schnell wachsen und namentlich selbst aus
steinigem Boden schnell Wurzel schlagen. So erfordert
das Pflanzen der Stämme nicht mehr Mühe als das
Zurichten, Eingraben und Befestigen toter Stangen oder
Gerüste. Dazu kommt, daß diese Bäume naturgemäß sehr-
viel widerstandsfähiger find als tote Stangen, denn ge-
rade die mächtigen klimatischen Einflüsse, große Hitze,
lang anhaltende Regengüsse, die den Bestand toter
Stämme gefährden, tragen zum Gedeihen und zur Stär-
kung dieser Feigen wesentlich bei. Natürlich sorgt ein
ständig kontrollierendes Kommando für Instandhaltung
der Leitung und sofortige Ausbesserung irgendwelche'r
Beschädigungen. Von den Kosten einer derartigen Tele-
graphenleitung erhält man einen Begriff, wenn man
überlegt, daß der oft viele hundert Kilometer lange
Draht (im Jahre 1902 hatte Afrika bereits ein Tele-
graphennetz von 41,900 Kilometer) in verhältnismäßig
kleinen Rollen von zahlreichen Eingeborenen an Ort
und Stelle getragen werden muß.
S-s Da; Büttel 6s; „Roten Röwen",
koincm von Ssrlicirff 8tsin.
(?ort!etzung.)
eydemcmn stand da gesenkten Hauptes. Das
war ein offener Angriff, eine gewollte Ve-
M leidigung. Eine Weile stand er so in sich
M versunken da. Dann sagte er: „Fräulein
Edith, ich habe schon seit Tagen gefühlt, daß Sie
etwas gegen mich haben. Es kommt mir vor, als
ob ich Ihnen lästig sei, und Sie es nicht für wün-
schenswert halten, daß ich komme oder so ost komme."
„Das habe ich nicht gesagt!" rief sie, mit einer
jähen Wendung ihr Spiel unterbrechend.
„Nein, Sie haben es nicht gesagt," bemerkte er
in traurigem Ton, „aber Sie geben es mir deutlich
zu verstehe». Haben Sie den Wunsch, daß ich diese
Wohnung nicht mehr betrete?"
„Den Wunsch?" brach sie plötzlich heftig aus.
„Und was tun Sie dann? Wovon und wie wollen
Sie denn leben? Ja, ich sage es offen: Ich ärgere
mich, daß Sie täglich kommen. Und wissen Sie
warum? Weil Sie von uns, von meiner Schwester
abhängig sind. Sie sind ihr Schreiber, der Ver-
besserer ihrer Romane, die sie auf eigene Kosten
drucken läßt. Ist das eine Beschäftigung für einen
Mann? Sie haben doch etwas gelernt, Sie können
ja was. Sie sind ein guter Pianist, Sie haben die
Universität besucht. Und was sind Sie? Schreiber
bei einer Fran, die dilettantische Kriminalromane
macht."
Heydemann hatte den Kopf noch tiefer gesenkt.
Es war ja wahr, was das Mädchen sprach. Jedes
Wort war wie ein Schuß ins Schwarze.
„Aber was soll ich denn anfangen, Fräulein
Edith?" sagte er resigniert. „Ich warte ja nur, bis
ich mein Geld wiederbekomme."
„Wissen Sie es bestimmt, daß Sie es wieder-
bekommen?"
„Bestimmt? Wie kann ich denn? Aber die Nach-
richt in der heutigen Zeitung —"
„Darauf gebe ich gar nichts," sagte Edith ent-
schieden. „Das ist gerade eine solche Nachricht, wie
Sie sie eingerückt haben. Sie werden sehen, die ganze
Geschichte wird zu Wasser — wenigstens was Ihr
Geld betrifft. Glauben Sie denn wirklich, Herr
Heydemann, wenn das Geld, das der Mensch ver-
schwendete, das Ihrige wäre, hätte die Polizei Sie
nicht schon gerufen? Nichtschon gefragt, ob es Ihre
Brieftasche, Ihre Tausendmarkscheine seien? Sie
aber klammern sich an jeden Strohhalm, Sie sind
ein Mensch, der auf ein Wunder wartet!"
Heydemann sank auf einen Stuhl und vergrub
den Kopf in seine Hände. Sie ließ ihre Finger auf
den Tasten ruhen und schlug mechanisch von Zeit zu
Zeit leise einen Akkord an. Dann wurden ihre
Finger ganz ruhig, und eine ganze Weile verfloß, ohne
daß ein Ton im Raume hörbar ward.
Plötzlich wandte sie sich voll zu ihm hin. „Herr
Heydemann," sagte sie weich und herzlich, „ich habe
Ihnen wehe getan, ich weiß es. Und ich wollte es.
Ja, ich wollte es. Sie wissen nicht, wie sehr Sie
mir leid tun. Ein Mann in voller Kraft, ein ge-
bildeter Mann, von einer Frau abhängig, ihr Schrei-
ber! Sie müssen sich bemühen, daß Sie selbständig
werden. Ein Mann ohne Berns! Sie müssen sich
frei machen, einen Berus finden! Es gibt so viel
Arbeit — sehen Sie nur die Zeitungen durch. Man
kann in der Großstadt so viel verdienen. Nicht von
heute auf morgen, ich weiß es, aber Sie müssen
suchen. Verzeihen Sie, daß ich als Mädchen so zu
Ihnen rede, ich bin ja Lehrerin, und die Schul-
meister wollen immer belehren. Aber, weiß Gott!
ich gäbe viel darum, wenn ich Ihnen zu einem Be-
rns, zu Verdienst verhelfen könnte. — Sekretär
meiner Schwester! . . . nein, Herr Heydemann, Sie
müssen sie schon ihre Romane allein schreiben lassen.
Wenn Sie können, schreiben Sie Ihre eigenen Ro-
mane, oder tun Sie was anderes. Ihre Seele ist
gebrochen von dem Verlust, aber ein Mann soll nicht
zu Grunde gehen, wenn er Geld verloren hat. So
denke ich als Mädchen, so würden Sie auch denken,
wenn Sie sich einmal aus diesem Zustand befreien."
Sie erhob sich und reichte ihm ihre zierliche kleine
Hand. Er blickte auf, dann gab er ihr schweigend
die seinige. Sie suhlte, daß sie naß war, naß von
Tränen.
„Herr Heydemann," sagte sie tief bewegt, „ich ...
ich ... ach, ich kann es Ihnen nicht sagen, wie ich
es meine. Es war nicht Bosheit, nicht Mißachtung,
wahrhaftig nicht."
„Ich habe Sie verstanden," sagte er leise.
Sie lächelte ihn liebenswürdig und freundlich an.
(Ulickdruck verboten.)
„Dann will ich Sie nicht weiter quälen," meinte sie
herzlich. „Gehen Sie nur wieder au Ihre Arbeit.
Ich habe gleichfalls zu tun . .. also, gut Freund?"
Heydemann nickte zustimmend. Sein Gesicht hatte
einen schwermütigen, hoffnungslosen Ausdruck. Sie
sah es, wollte etwas sagen, überlegte es sich aber
und legte unwillkürlich einen kurzen Moment die
Hand auf seine Schulter, als wollte sic ihn ans seinen
schmerzlichen Betrachtungen aufrütteln.
Dann verließ sie mit einem Kopfnicken das
Zimmer.
Heydemann blieb noch eine Weile in sich ver-
sunken auf seinem Platze. Dann stand er langsam
und schwer auf und schritt wie ein Mensch, der völlig
in sich zusammengebrochen ist, zum Schreibtisch.
Es verfloß Tag um Tag und immer noch wartete
Heydemann in gespannter, nervöser Unruhe auf ein
Zeichen, einen Ruf der Polizei. Aber nichts kam,
kein Schutzmann erschien, kein Zettel flog ihm ins
Hans. Heydemann schien sür die Hüter und Schützer
der Gerechtigkeit gar nicht mehr zu existieren.
Aber auch Frau Doktor Driesen wich merkwürdiger-
weise einem Gespräch über die Sache aus. Sie hatte
zweimal ihren Rat erteilt, sic wagte es nun nicht
mehr, noch einmal mit ihren Kombinationen hervor-
zntreten. Sie hatte jetzt offenbar ganz andere Inter-
essen. Sie beschäftigte sich mit der Idee zu einem
neuen großen Kriminalroman, der, wie sie sagte, all-
gemeines Aufsehen erregen würde. Und wenn sie
von dem Kriminalroman sprach, machte sie anfäng-
lich nur schwache Andeutungen, dann aber trat sie
immer klarer mit dem Vorschläge heraus, daß Heyde-
mann als regulärer Mitarbeiter tätig sein sollte.
Sie gab es zu, daß der letzte Roman, der vom
„Familienblatt" in der Tat angenommen wurde und
demnächst bezahlt werden sollte — ja, es war ihr
erster Roman, den sie nicht ans eigene Kosten drucken
lassen mußte, der ihr nun sogar Honorar einbrachte,
von dem ein guter Teil sür Heydemann bestimmt
war — sie gab es zu, daß der Roman besonders
wegen der stilistischen Darstellung gefiel, lind diese
war zum größten Teil Heydemann zu verdanken. Sie
verschwieg ängstlich, daß gerade einige Ideen, die
Heydemann eigenmächtig hineingebracht hatte, sür
die Annahme des Romans entscheidend wurden.
Als Frau Friederike bei Tisch Heydemann die
Mitarbeiterschaft und somit auch die Hälfte des Ver-
dienstes aubot, warf er einen verstohlenen, fragenden
Blick auf Edith. Sie sah ihn an, aber ihr Gesicht
blieb starr, verschlossen wie das einer Sphinx. Sie
schien also nicht einverstanden mit dem Plan zu sein.
Heydemann seufzte, beugte sein Haupt über den Teller,
sagte nicht Ja und nicht Nein und ließ Frau Friede-
rike weiter ihre Pläne entwickeln. Sie war von
seinem Verhalten recht enttäuscht, denn sie erwartete,
daß er den Vorschlag mit Heller Freude aufnehmen
würde. Aber sie legte schließlich sein Schweigen als
Schüchternheit und ängstliche Bescheidenheit aus und
beschäftigte sich umso intensiver mit den Fragen,
die sie in dem neuen Werke behandeln wollte.
Am nächsten Tage aber wurde Fran Friederike
gezwungen, sich mit der persönlichen Angelegenheit
Heydemanns zu beschäftigen.
Dieser Tag brachte eine Überraschung. Schon
in den ersten Vormittagsstunden erschien Heydemann
in der Wohnung der Schwestern, den „Tagesboten"
in der Hand, und mit allen Zeichen tiefer Erregung
aus dem Gesicht. Seit jenem Nachmittag, an dem
Edith ihre Gedanken über sein Verhältnis zu ihrer
Schwester so rücksichtslos ausgesprochen hatte, las er
schon am Morgen die Zeitnng, studierte aufmerksam
den Inseratenteil und bemühte sich, auf dem Arbeits-
markt etwas zu finden, was ihm zu Geldverdienst
verhelfen könnte. Mit den großstädtischen Verhält-
nissen aber gar nicht vertraut, tastete er noch im
Dunkeln. Er konnte nichts finden, er mußte sich
sagen, daß er noch mehrere Tage brauchen würde,
nm sich sicherer zu orientieren.
Auch heute hatte er iu der Zeitung zunächst den
Inseratenteil überflogen, wieder ohne das Richtige
zu entdecken, dann las er die Lokalnachrichten.
Da fiel sein Auge auf eine Notiz, die ihm das
Blut durch den Körper schneller kreisen machte.
„Über die geheimnisvolle Persönlichkeit, die kürz-
lich durch tolle Verschwendung die Aufmerksamkeit
der Polizei auf sich lenkte" —so hieß es da—„und
die bekanntlich verhaftet wurde, ist nun Klarheit ge-
Überkall eines
Mgsnruges im vreißigjäkrigsn Kriegs.
<5ielie das Nild auk Seite 523.)
I^as unsägliche Elend, das der Dreißigjährige Krieg
" über unser Vaterland brachte, ist von einem Umsang,
einer Nachhaltigkeit gewesen, die dem heutigen Geschlecht
kaum noch recht vorstellbar ist. Wieder und wieder
wurden dieselben Gegenden von der Kriegsfurie heim-
gesucht; Plünderung, Raub, Brandschatzung, Grausam-
keit jeder Art wüteten allerorten in Städten und Dörfern.
In der zweiten Hälfte des nicht endenwollenden Kriegs
gaben es die Bauern vielerorts ganz auf, den Acker zu
bestellen, da voraussichtlich der Ertrag ihrer Arbeit doch
nur sremdem Kriegsvolk zum Raub werden würde. Von
einer technisch wohlvorbereiteten geregelten Truppenver-
pflegung, wie sie die heutige Kriegführung kennt, hatte
das Kriegswesen des 17. Jahrhunderts noch keine Ahnung.
Jedes Land, das von Truppen heimgesucht ward, hatte
sie auch zu ernähren; nur selten wurden die weggenom-
menen Vorräte und Herden bezahlt, in Feindesland nie-
mals. Durch Wallensteins Neigung, seine Heeresmassen in
festen Lagern zusammenzuhalten, bis die Gunst der Sterne
und die B.lößen der Gegner sicheren Sieg verhießen,
und durch die Aufnahme dieses Verfahrens seitens der
Gegner wurde die Aussaugung ganzer Landschaften oft
so ausgedehnt, daß sie zu völliger Erschöpfung führte.
Die sichere Versorgung der Lagertruppen mit Lebens-
mitteln mar aber auch eine schwierige Ausgabe für den
Generalissimus, und er war es, der den Furagedienst
in ein System brachte, hielt er doch manchmal über
50,000 Soldaten in seinem Lager vereinigt. Gustav
Adolf sah sich zu ähnlichen Veranstaltungen veranlaßt,
wenn er sich, wie zum Beispiel in seinem befestigten
Lager vor Nürnberg im Sommer 1632, festgelegt sah.
Er erwartete dort den Angriff des Friedländers, der
aus Sachsen herankam, um die Schweden aus Bayern
zu vertreiben. Wallenstein griff diese aber nicht an,
sondern bezog selbst jenseits der Pegnitz, Nürnberg
gegenüber, ein Lager, das er stark befestigte, und entzog
durch diese wohlgewählte Stellung der Stadt sowohl
als den Schweden jede Zufuhr aus Franken, Schwaben
und Thüringen. Er selbst erwartete einen großen, in
Bayern aufgekauften Transport von tausend mit Brot
bepackten Wagen und gegen zwölfhundert Stück Vieh.
Gustav Adolf, davon benachrichtigt, sandte sogleich eine
größere Kavallerieabteilung danach aus, und es gelang
diesen Reiterscharen wirklich, die riesige Proviantkolonne
zu erbeuten, nachdem die kaiserliche Bedeckung nieder-
gehauen worden war. Das ist ein berühmtes Beispiel
sür viele ähnliche Überfälle, die im Laufe des Krieges
bald von dieser, bald von jener Seite auf Wagenzüge
des Gegners gemacht wurden. Unser dramatisch be-
wegtes Bild stellt einen solchen Überfall dar. Kroaten
verteidigen einen kaiserlichen Wagenzug, den schwedische
Reiter, Kürassiere und Dragoner, überfallen. Der An-
griff ist so wuchtig, daß auch hier die mit dem kaiser-
lichen Wappen auf dem Plandach geschmückten Wagen
gewiß den Schweden zur Beute fallen werden.
Das ^übriligsü einer ^elegrciptienleitung an
lebenäen Feigenbäumen in lentralakrikn.
(Stelle das Nild auk Saite 527.)
k^ie Erschließung Jnnerafrikas, die in unserer Zeit mit
solchem Eifer von allen beteiligten Nationen in An-
griff genommen wird, ist nicht ohne Telegraph und
Eisenbahn möglich. Zumal die telegraphische Verbindung
der einzelnen Stationen untereinander ist oft eine Lebens-
frage für die kühnen Pioniere europäischen Verkehrs.
Nach den neuesten Errungenschaften auf dem Gebiete
der telegraphischen Nachrichtenübermittlung ohne Draht
muß es bei den gewaltigen Kosten und Gefahren einer
gewöhnlichen Leitung als sicher angenommen werden,
daß in nicht allzu ferner Zeit gerade in diesem Welt-
teile die Erfindung drahtloser Telegraphie dem Verkehr
dienstbar gemacht wird. Einstiveilen erregt aber noch der
Bau einer Telegraphenleitung mit Draht das Interesse,
und zwar aus dem Grunde, weil zu dieser Leitung
zwischen den Stationen Mombasa und Butiaba am
Viktoria-Nyanza in Zentralafrika statt der gewöhnlichen
Telegraphenstangen aus bearbeitetem toten Holz lebende
Baumstämme benutzt werden. Eine Feigenart ist es,
deren Stämme sich besonders gut für diesen Zweck eignen,
da sie sehr schnell wachsen und namentlich selbst aus
steinigem Boden schnell Wurzel schlagen. So erfordert
das Pflanzen der Stämme nicht mehr Mühe als das
Zurichten, Eingraben und Befestigen toter Stangen oder
Gerüste. Dazu kommt, daß diese Bäume naturgemäß sehr-
viel widerstandsfähiger find als tote Stangen, denn ge-
rade die mächtigen klimatischen Einflüsse, große Hitze,
lang anhaltende Regengüsse, die den Bestand toter
Stämme gefährden, tragen zum Gedeihen und zur Stär-
kung dieser Feigen wesentlich bei. Natürlich sorgt ein
ständig kontrollierendes Kommando für Instandhaltung
der Leitung und sofortige Ausbesserung irgendwelche'r
Beschädigungen. Von den Kosten einer derartigen Tele-
graphenleitung erhält man einen Begriff, wenn man
überlegt, daß der oft viele hundert Kilometer lange
Draht (im Jahre 1902 hatte Afrika bereits ein Tele-
graphennetz von 41,900 Kilometer) in verhältnismäßig
kleinen Rollen von zahlreichen Eingeborenen an Ort
und Stelle getragen werden muß.
S-s Da; Büttel 6s; „Roten Röwen",
koincm von Ssrlicirff 8tsin.
(?ort!etzung.)
eydemcmn stand da gesenkten Hauptes. Das
war ein offener Angriff, eine gewollte Ve-
M leidigung. Eine Weile stand er so in sich
M versunken da. Dann sagte er: „Fräulein
Edith, ich habe schon seit Tagen gefühlt, daß Sie
etwas gegen mich haben. Es kommt mir vor, als
ob ich Ihnen lästig sei, und Sie es nicht für wün-
schenswert halten, daß ich komme oder so ost komme."
„Das habe ich nicht gesagt!" rief sie, mit einer
jähen Wendung ihr Spiel unterbrechend.
„Nein, Sie haben es nicht gesagt," bemerkte er
in traurigem Ton, „aber Sie geben es mir deutlich
zu verstehe». Haben Sie den Wunsch, daß ich diese
Wohnung nicht mehr betrete?"
„Den Wunsch?" brach sie plötzlich heftig aus.
„Und was tun Sie dann? Wovon und wie wollen
Sie denn leben? Ja, ich sage es offen: Ich ärgere
mich, daß Sie täglich kommen. Und wissen Sie
warum? Weil Sie von uns, von meiner Schwester
abhängig sind. Sie sind ihr Schreiber, der Ver-
besserer ihrer Romane, die sie auf eigene Kosten
drucken läßt. Ist das eine Beschäftigung für einen
Mann? Sie haben doch etwas gelernt, Sie können
ja was. Sie sind ein guter Pianist, Sie haben die
Universität besucht. Und was sind Sie? Schreiber
bei einer Fran, die dilettantische Kriminalromane
macht."
Heydemann hatte den Kopf noch tiefer gesenkt.
Es war ja wahr, was das Mädchen sprach. Jedes
Wort war wie ein Schuß ins Schwarze.
„Aber was soll ich denn anfangen, Fräulein
Edith?" sagte er resigniert. „Ich warte ja nur, bis
ich mein Geld wiederbekomme."
„Wissen Sie es bestimmt, daß Sie es wieder-
bekommen?"
„Bestimmt? Wie kann ich denn? Aber die Nach-
richt in der heutigen Zeitung —"
„Darauf gebe ich gar nichts," sagte Edith ent-
schieden. „Das ist gerade eine solche Nachricht, wie
Sie sie eingerückt haben. Sie werden sehen, die ganze
Geschichte wird zu Wasser — wenigstens was Ihr
Geld betrifft. Glauben Sie denn wirklich, Herr
Heydemann, wenn das Geld, das der Mensch ver-
schwendete, das Ihrige wäre, hätte die Polizei Sie
nicht schon gerufen? Nichtschon gefragt, ob es Ihre
Brieftasche, Ihre Tausendmarkscheine seien? Sie
aber klammern sich an jeden Strohhalm, Sie sind
ein Mensch, der auf ein Wunder wartet!"
Heydemann sank auf einen Stuhl und vergrub
den Kopf in seine Hände. Sie ließ ihre Finger auf
den Tasten ruhen und schlug mechanisch von Zeit zu
Zeit leise einen Akkord an. Dann wurden ihre
Finger ganz ruhig, und eine ganze Weile verfloß, ohne
daß ein Ton im Raume hörbar ward.
Plötzlich wandte sie sich voll zu ihm hin. „Herr
Heydemann," sagte sie weich und herzlich, „ich habe
Ihnen wehe getan, ich weiß es. Und ich wollte es.
Ja, ich wollte es. Sie wissen nicht, wie sehr Sie
mir leid tun. Ein Mann in voller Kraft, ein ge-
bildeter Mann, von einer Frau abhängig, ihr Schrei-
ber! Sie müssen sich bemühen, daß Sie selbständig
werden. Ein Mann ohne Berns! Sie müssen sich
frei machen, einen Berus finden! Es gibt so viel
Arbeit — sehen Sie nur die Zeitungen durch. Man
kann in der Großstadt so viel verdienen. Nicht von
heute auf morgen, ich weiß es, aber Sie müssen
suchen. Verzeihen Sie, daß ich als Mädchen so zu
Ihnen rede, ich bin ja Lehrerin, und die Schul-
meister wollen immer belehren. Aber, weiß Gott!
ich gäbe viel darum, wenn ich Ihnen zu einem Be-
rns, zu Verdienst verhelfen könnte. — Sekretär
meiner Schwester! . . . nein, Herr Heydemann, Sie
müssen sie schon ihre Romane allein schreiben lassen.
Wenn Sie können, schreiben Sie Ihre eigenen Ro-
mane, oder tun Sie was anderes. Ihre Seele ist
gebrochen von dem Verlust, aber ein Mann soll nicht
zu Grunde gehen, wenn er Geld verloren hat. So
denke ich als Mädchen, so würden Sie auch denken,
wenn Sie sich einmal aus diesem Zustand befreien."
Sie erhob sich und reichte ihm ihre zierliche kleine
Hand. Er blickte auf, dann gab er ihr schweigend
die seinige. Sie suhlte, daß sie naß war, naß von
Tränen.
„Herr Heydemann," sagte sie tief bewegt, „ich ...
ich ... ach, ich kann es Ihnen nicht sagen, wie ich
es meine. Es war nicht Bosheit, nicht Mißachtung,
wahrhaftig nicht."
„Ich habe Sie verstanden," sagte er leise.
Sie lächelte ihn liebenswürdig und freundlich an.
(Ulickdruck verboten.)
„Dann will ich Sie nicht weiter quälen," meinte sie
herzlich. „Gehen Sie nur wieder au Ihre Arbeit.
Ich habe gleichfalls zu tun . .. also, gut Freund?"
Heydemann nickte zustimmend. Sein Gesicht hatte
einen schwermütigen, hoffnungslosen Ausdruck. Sie
sah es, wollte etwas sagen, überlegte es sich aber
und legte unwillkürlich einen kurzen Moment die
Hand auf seine Schulter, als wollte sic ihn ans seinen
schmerzlichen Betrachtungen aufrütteln.
Dann verließ sie mit einem Kopfnicken das
Zimmer.
Heydemann blieb noch eine Weile in sich ver-
sunken auf seinem Platze. Dann stand er langsam
und schwer auf und schritt wie ein Mensch, der völlig
in sich zusammengebrochen ist, zum Schreibtisch.
Es verfloß Tag um Tag und immer noch wartete
Heydemann in gespannter, nervöser Unruhe auf ein
Zeichen, einen Ruf der Polizei. Aber nichts kam,
kein Schutzmann erschien, kein Zettel flog ihm ins
Hans. Heydemann schien sür die Hüter und Schützer
der Gerechtigkeit gar nicht mehr zu existieren.
Aber auch Frau Doktor Driesen wich merkwürdiger-
weise einem Gespräch über die Sache aus. Sie hatte
zweimal ihren Rat erteilt, sic wagte es nun nicht
mehr, noch einmal mit ihren Kombinationen hervor-
zntreten. Sie hatte jetzt offenbar ganz andere Inter-
essen. Sie beschäftigte sich mit der Idee zu einem
neuen großen Kriminalroman, der, wie sie sagte, all-
gemeines Aufsehen erregen würde. Und wenn sie
von dem Kriminalroman sprach, machte sie anfäng-
lich nur schwache Andeutungen, dann aber trat sie
immer klarer mit dem Vorschläge heraus, daß Heyde-
mann als regulärer Mitarbeiter tätig sein sollte.
Sie gab es zu, daß der letzte Roman, der vom
„Familienblatt" in der Tat angenommen wurde und
demnächst bezahlt werden sollte — ja, es war ihr
erster Roman, den sie nicht ans eigene Kosten drucken
lassen mußte, der ihr nun sogar Honorar einbrachte,
von dem ein guter Teil sür Heydemann bestimmt
war — sie gab es zu, daß der Roman besonders
wegen der stilistischen Darstellung gefiel, lind diese
war zum größten Teil Heydemann zu verdanken. Sie
verschwieg ängstlich, daß gerade einige Ideen, die
Heydemann eigenmächtig hineingebracht hatte, sür
die Annahme des Romans entscheidend wurden.
Als Frau Friederike bei Tisch Heydemann die
Mitarbeiterschaft und somit auch die Hälfte des Ver-
dienstes aubot, warf er einen verstohlenen, fragenden
Blick auf Edith. Sie sah ihn an, aber ihr Gesicht
blieb starr, verschlossen wie das einer Sphinx. Sie
schien also nicht einverstanden mit dem Plan zu sein.
Heydemann seufzte, beugte sein Haupt über den Teller,
sagte nicht Ja und nicht Nein und ließ Frau Friede-
rike weiter ihre Pläne entwickeln. Sie war von
seinem Verhalten recht enttäuscht, denn sie erwartete,
daß er den Vorschlag mit Heller Freude aufnehmen
würde. Aber sie legte schließlich sein Schweigen als
Schüchternheit und ängstliche Bescheidenheit aus und
beschäftigte sich umso intensiver mit den Fragen,
die sie in dem neuen Werke behandeln wollte.
Am nächsten Tage aber wurde Fran Friederike
gezwungen, sich mit der persönlichen Angelegenheit
Heydemanns zu beschäftigen.
Dieser Tag brachte eine Überraschung. Schon
in den ersten Vormittagsstunden erschien Heydemann
in der Wohnung der Schwestern, den „Tagesboten"
in der Hand, und mit allen Zeichen tiefer Erregung
aus dem Gesicht. Seit jenem Nachmittag, an dem
Edith ihre Gedanken über sein Verhältnis zu ihrer
Schwester so rücksichtslos ausgesprochen hatte, las er
schon am Morgen die Zeitnng, studierte aufmerksam
den Inseratenteil und bemühte sich, auf dem Arbeits-
markt etwas zu finden, was ihm zu Geldverdienst
verhelfen könnte. Mit den großstädtischen Verhält-
nissen aber gar nicht vertraut, tastete er noch im
Dunkeln. Er konnte nichts finden, er mußte sich
sagen, daß er noch mehrere Tage brauchen würde,
nm sich sicherer zu orientieren.
Auch heute hatte er iu der Zeitung zunächst den
Inseratenteil überflogen, wieder ohne das Richtige
zu entdecken, dann las er die Lokalnachrichten.
Da fiel sein Auge auf eine Notiz, die ihm das
Blut durch den Körper schneller kreisen machte.
„Über die geheimnisvolle Persönlichkeit, die kürz-
lich durch tolle Verschwendung die Aufmerksamkeit
der Polizei auf sich lenkte" —so hieß es da—„und
die bekanntlich verhaftet wurde, ist nun Klarheit ge-