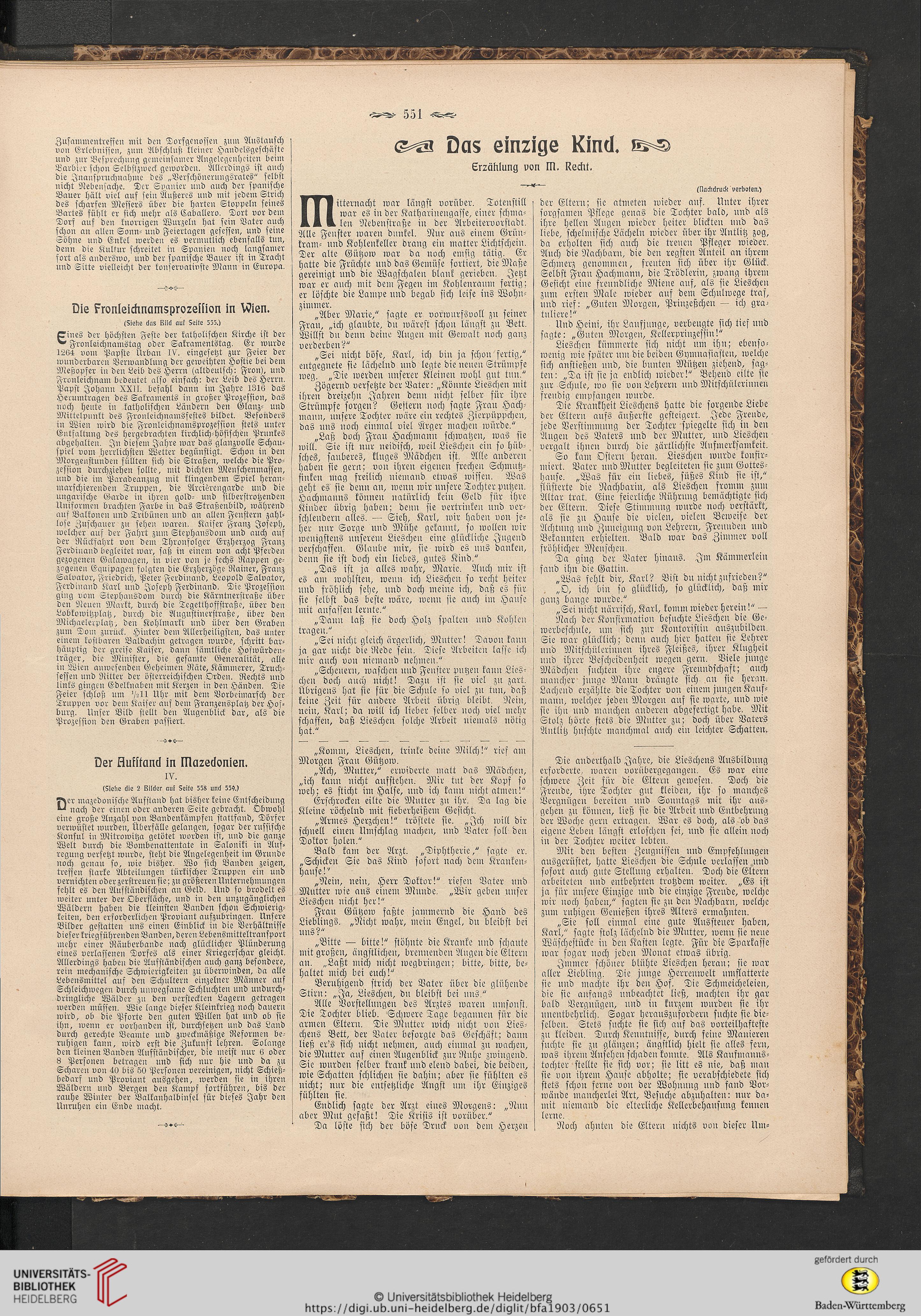551
Zusammentreffen mit den Torfgenossen zum Austausch
von Erlebnissen, zum Abschluß kleiner Handelsgeschäfte
und zur Besprechung gemeinsamer Angelegenheiten beim
Barbier schon Selbstzweck geworden. Allerdings ist auch
die Inanspruchnahme des „Verschönerungsratcs" selbst
nicht Nebensache. Der Spanier und auch der spanische
Bauer hält viel auf sein Äußeres und mit jedem Strich
des scharfen Messers über die harten Stoppeln seines
Bartes fühlt er sich mehr als Caballero. Dort vor dem
Dorf auf den knorrigen Wurzeln hat sein Vater auch
schon an allen Sonn- und Feiertagen gesessen, und seine
Söhne und Enkel werden es vermutlich ebenfalls tun,
denn die Kultur schreitet in Spanien noch langsamer
fort als anderswo, und der spanische Bauer ist in Tracht
und Sitte vielleicht der konservativste Mann in Europa.
Vis ?rolilLjckncnnspro2L!kion in Msn.
(Zietie 6cis 6ilä auf Zeile 555.)
^ines der höchsten Feste der katholischen Kirche ist der
Fronleichnamstag oder Sakramentstag. Er wurde
1264 vom Papste Urban IV. eingesetzt zur Feier der
wunderbaren Verwandlung der geweihten Hostie bei dem
Meßopfer in den Leib des Herrn (altdeutsch': Fron), und
Fronleichnam bedeutet also einfach: der Leib des Herrn.
Papst Johann XXII. befahl dann im Jahre 1316 das
Herumtragen des Sakraments in großer Prozession, das
noch heute in katholischen Ländern den Glanz- und
Mittelpunkt des Fronleichnamsfestes bildet. Besonders
in Wien wird die Fronleichnamsprozession stets unter
Entfaltung des hergebrachten kirchlich-höfischen Prunkes
abgehalten. In diesem Jahre war das glanzvolle Schau-
spiel vom herrlichsten Wetter begünstigt. Schon in den
Morgenstunden füllten sich die Straßen, welche die Pro-
zession durchziehen sollte, mit dichten Menschenmassen,
und die im Paradeanzug mit klingendem Spiel heran-
marschierenden Truppen, die Arcierengarde und die
ungarische Garde in ihren gold- und silberstrotzenden
Uniformen brachten Farbe in das Straßenbild, während
auf Ballonen und Tribünen und an allen Fenstern zahl-
lose Zuschauer zu sehen waren. Kaiser Franz Joseph,
welcher auf der Fahrt zum Stephansdom und auch auf
der Rückfahrt von dem Thronfolger Erzherzog Franz
Ferdinand begleitet war, saß in einem von acht Pferden
gezogenen Galawagen, in vier von je sechs Rappen ge-
zogenen Equipagen solgten die Erzherzoge Rainer, Franz
Salvator, Friedrich, Peter Ferdinand, Leopold Salvator,
Ferdinand Karl und Joseph Ferdinand. Die Prozession
ging vom Stephansdom durch die Kärntnerstratze über
den Neuen Markt, durch die Tegetthosfstraße, über den
Lobkowitzplatz, durch die Angustinerstrnße, über den
Michaelerplatz, den Kohlmarkt und über den Graben
zum Toni zurück. Hinter dem Allerheiligsten, das unter
einem kostbaren Baldachin getragen wurde, schritt bar-
häuptig der greise Kaiser, dann sämtliche Hofwürden-
träger, die Minister, die gesamte Generalität, alle
in Wien anwesenden Geheimen Räte, Kämmerer, Truch-
sessen und Ritter der österreichischen Orden. Rechts und
links gingen Edelknaben mit Kerzen in den Händen. Die
Feier schloß um hbll Uhr mit dem Vorbeimarsch der
Truppen vor dem Kaiser auf dem Franzensplatz der Hof-
burg. Unser Bild stellt den Augenblick dar, als die
Prozession den Graben passiert.
--
Oer ZMciliä in Mcirsäomen.
IV.
(Zielie 6ie 2 Liläer auf Zeile 558 un6 55H.)
4>cr mazedonische Aufstand hat bisher keine Entscheidung
nach der einen oder anderen Seite gebracht. Obwohl
eine große Anzahl von Bandenkümpfen stattfand, Dörfer
verwüstet wurden, Überfälle gelangen, sogar der russische
Konsul in Mitrowitza getötet worden ist, und die ganze
Welt durch die Bombenattentate in Saloniki in Auf-
regung versetzt wurde, steht die Angelegenheit im Grunde
noch genau so, wie bisher. Wo sich Banden zeigen,
treffen starke Abteilungen türkischer Truppen ein und
vernichten oder zerstreuen sie; zu größeren Unternehmungen
fehlt es den Aufständischen an Geld. Und so brodelt es
weiter unter der Oberfläche, und in den unzugänglichen
Wäldern haben die kleinsten Banden schon Schwierig-
keiten, den erforderlichen Proviant aufzubringen. Unsere
Bilder gestatten uns einen Einblick in die Verhältnisse
dieser kriegführenden Banden, deren Lebensmitteltransport
mehr einer Räuberbande nach glücklicher Plünderung
eines verlassenen Dorfes als einer Kriegerschar gleicht.
Allerdings haben die Aufständischen auch ganz besondere,
rein mechanische Schwierigkeiten zu überwinden, da alle
Lebensmittel auf den Schultern einzelner Männer ans
Schleichwegen durch unwegsame Schluchten und undurch-
dringliche Wälder zu den versteckten Lagern getragen
werden müssen. Wie lange dieser Kleinkrieg noch dauern
wird, ob die Pforte den guten Willen hat und ob sie
ihn, wenn er vorhanden ist, durchsetzen und das Land
durch gerechte Beamte und zweckmäßige Reformen be-
ruhigen kann, wird erst die Zukunft lehren. Solange
den kleinen Banden Aufständischer, die meist nur 6 oder
8 Personen betragen und sich nur hie und da zu
Scharen von 40 bis SO Personen vereinigen, nicht Schieß-
bedarf und Proviant ausgehen, werden sie in ihren
Wäldern und Bergen den Kampf fortführon, bis der
rauhe Winter der Balkanhalbinsel für dieses Jahr den
Unruhen ein Ende macht.
S-s? Oci; sinrige Kincl. s-s
LrrMlung von lü. kockt.
U W itternacht war längst vorüber. Totenstill
I I war es in der Katharinengasse, einer schma-
Z^RR.len Nebenstraße in der Arbeitervorstadt.
Alle Fenster waren dunkel. Nur aus einem Grün-
kram- nnd Kohlenkeller drang ein matter Lichtschein.
Der alte Gützow war da noch emsig tätig. Er
hatte die Früchte und das Gemüse sortiert, die Maße
gereinigt nnd die Wagschalen blank gerieben. Jetzt
war er auch mit dem Fegen im Kohlenranm fertig;
er löschte die Lampe und begab sich leise ins Wohn-
zimmer.
„Aber Marie," sagte er vorwurfsvoll zu seiner
Frau, „ich glaubte, du wärest schon längst zu Bett.
Willst du denn deine Angen mit Gewalt noch ganz
verderben?"
„Sei nicht böse, Karl, ich bin ja schon fertig,"
entgegnete sie lächelnd und legte die neuen Strümpfe
weg. „Die werden nnserer Kleinen wohl gut tun."
Zögernd versetzte der Vater: „Könnte Lieschen mit
ihren dreizehn Jahren denn nicht selber für ihre
Strümpfe sorgen? Gestern noch sagte Frau Hach-
mann, unsere Tochter wäre ein rechtes Zierpüppcheu,
das uns noch einmal viel Ärger machen würde."
„Laß doch Frau Hachmann schwatzen, was sie
will. Sie ist nur neidisch, weil Lieschen ein so hüb-
sches, sauberes, kluges Mädchen ist. Alle anderen
haben sie gern; von ihren eigenen frechen Schmutz-
finken mag freilich niemand etwas wissen. Was
geht es sie denn an, wenn wir unsere Tochter putzen.
Hachmauns können natürlich kein Geld für ihre
Kinder übrig haben; denn sie vertrinken und ver-
schleudern alles. — Sieh, Karl, wir haben von je-
her nur Sorge nnd Mühe gekannt, so wollen wir
wenigstens unserem Lieschen eine glückliche Jugend
verschaffen. Glaube mir, sie wird es uns danken,
denn sie ist doch ein liebes, gutes Kind."
„Das ist ja alles wahr, Marie. Auch mir ist
es am wohlsten, wenn ich Lieschen so recht heiter
und fröhlich sehe, und dach meine ich, daß es für
sie selbst das beste wäre, wenn sie auch im Hause
mit ansassen lernte."
„Dann laß sie doch Holz spalten nnd Kohlen
tragen."
„Sei nicht gleich ärgerlich, Mutter! Davou kann
ja gar nicht die Rede sein. Diese Arbeiten lasse ich
mir auch von niemand nehmen."
„Scheuern, waschen und Fenster putzen kann Lies-
chen doch auch nicht! Dazu ist sie viel zu zart.
Übrigens hat sie für die Schule so viel zu tun, daß
keine Zeit für andere Arbeit übrig bleibt. Nein,
nein, Karl; da will ich lieber selber noch viel mehr
schaffen, daß Lieschen solche Arbeit niemals nötig
hat."
„Komm, Lieschen, trinke deine Milch!" rief am
Morgen Frau Gützow.
„Ach, Mutter," erwiderte matt das Mädchen,
„ich kann nicht aufstehen. Mir tut der Kopf so
weh; es sticht im Halse, und ich kann nicht atmen!"
Erschrocken eilte die Mutter zu ihr. Da lag die
Kleine röchelnd mit fieberheißem Gesicht.
„Armes Herzchen!" tröstete sie. „Ich will dir
schnell einen Umschlag machen, nnd Vater soll den
Doktor holen."
Bald kam der Arzt. „Diphtherie," sagte er.
„Schicken Sie das Kind sofort nach dem Kranken-
hanse!"
„Nein, nein, Herr Doktor!" riefen Vater nnd
Mutter wie ans einem Munde. „Wir geben unser
Lieschen nicht her!"
Frau Gützow faßte jammernd die Hand des
Lieblings. „Nicht wahr, mein Engel, du bleibst bei
uns?"
„Bitte — bitte!" stöhnte die Kranke nnd schaute
mit großen, ängstlichen, brennenden Angen die Eltern
an. „Laßt mich nicht wegbringen; bitte, bitte, be-
haltet mich bei euch!"
Beruhigend strich der Vater über die glühende
Stirn: „Ja, Lieschen, du bleibst bei uns."
Alle Vorstellungen des Arztes waren umsonst.
Die Tochter blieb. Schwere Tage begannen für die
armen Eltern. Die Mutter wich nicht von Lies-
chens Bett, der Vater besorgte das Geschäft; dann
ließ er's sich nicht nehmen, auch einmal zu wachen,
die Mutter ans einen Augenblick zur Ruhe zwingend.
Sie wurden selber krank und elend dabei, die beiden,
wie Schatten schlichen sie dahin; aber sie fühlten es
nicht; nur die entsetzliche Angst um ihr Einziges
fühlten sie.
Endlich sagte der Arzt eines Morgens: „Nun
aber Mut gefaßt! Die Krisis ist vorüber."
Da löste sich der böse Druck von dem Herzen
Mackclruck Vörbolsn.)
der Eltern; sic atmeten wieder ans. Unter ihrer
sorgsamen Pflege genas die Tochter Kalo, und als
ihre Hellen Augen wieder heiter blickten und das
liebe, schelmische Lächeln wieder über ihr Antlitz zog,
da erholten sich auch die treuen Pfleger wieder.
Auch die Nachbarn, die den regsten Anteil an ihren,
Schmerz genommen, freuten sich über ihr Glück.
Selbst Fran Hachmann, die Trödlerin, zwang ihrem
Gesicht eine freundliche Miene aus, als sie Lieschen
zum ersten Male wieder auf dem Schulwege traf,
nnd rief: „Guten Morgen, Prinzeßchen — ich gra-
tuliere!"
Und Heini, ihr Laufjunge, verbeugte sich tief nnd
sagte: „Guten Morgen, Kellerprinzessin!"
Lieschen kümmerte sich nicht nm ihn; ebenso-
wenig nüe später nm die beiden Gymnasiasten, welche
sich anstießen nnd, die bunten Mützen ziehend, sag-
ten: „Ta ist sie ja endlich wieder!" Behend eilte sic
zur Schule, wo sie vou Lehreru und Mitschülerinnen
freudig empfangen wurde.
Die Krankheit Lieschens hatte die sorgende Liebe
der Eltern aufs äußerste gesteigert. Jede Freude,
jede Verstimmung der Tochter spiegelte sich in den
Augen des Vaters und der Mutter, und Lieschen
vergalt ihnen durch die zärtlichste Aufmerksamkeit.
So kam Ostern heran. Lieschen wurde konfir-
miert. Vater und Mutter begleiteten sie znm Gottes-
hanse. „Was für ein liebes, süßes Kind sie ist,"
flüsterte die Nachbarin, als Lieschen fromm znm
Altar trat. Eine feierliche Rührung bemächtigte sich
der Eltern. Diese Stimmung wurde noch verstärkt,
als sie zu Hause die vielen, vielen Beweise der
Achtung und Zuneigung von Lehrern, Freunden und
Bekannten erhielten. Bald war das Zimmer voll
fröhlicher Menschen.
Da ging der Vater hinaus. Im Kämmerlein
sand ihn die Gattin.
„Was fehlt dir, Karl? Bist du nicht zufrieden?"
„O, ich bin so glücklich, so glücklich, daß mir-
ganz bange wurde."
„Sei nicht närrisch, Karl, komm wieder herein!" —
Nach der Konfirmation besuchte Lieschen die Ge-
werbeschule, nm sich zur Kontoristin auszubilden.
Sie war glücklich; denn auch hier hatten sie Lehrer
und Mitschülerinnen ihres Fleißes, ihrer Klugheit
und ihrer Bescheidenheit wegen gern. Viele junge
Mädchen suchten ihre engere Freundschaft; auch
mancher junge Mann drängte sich an sie heran.
Lachend erzählte die Tochter von einem jungen Kauf-
mann, welcher jeden Morgen auf sie warte, und wie
sie ihn und manchen anderen abgefertigt habe. Mit
Stolz hörte stets die Mutter zu; doch über Vaters
Antlitz huschte manchmal auch ein leichter Schatten.
Die anderthalb Jahre, die Lieschens Ausbildung
erforderte, waren vorübcrgegangen. Es war eine
schwere Zeit für die Eltern gewesen. Doch die
Freude, ihre Tochter gut kleiden, ihr so manches
Vergnügen bereiten und Sonntags mit ihr aus-
gehen zu können, ließ sie die Arbeit und Entbehrung
der Woche gern ertragen. War es doch, als ob das
eigene Leben längst erloschen sei, und sie allein noch
in der Tochter weiter lebten.
Mit den besten Zeugnissen nnd Empfehlungen
ausgerüstet, hatte Lieschen die Schule verlassen und
sofort auch gute Stellung erhalten. Doch die Eltern
arbeiteten nnd entbehrten trotzdem weiter. „Es ist
ja für unsere Einzige nnd die einzige Freude, welche
wir uoch haben," sagten sie zu den Nachbarn, welche
zum ruhigen Genießen ihres Alters ermahnten.
„Sie soll einmal eine gute Aussteuer haben,
Karl," sagte stolz lächelnd die Mutter, wenn sie neue
Wäschestücke in den Kasten legte. Für die Sparkasse
war sogar noch jeden Monat etwas übrig.
Immer schöner blühte Lieschen heran; sic war
aller Liebling. Die junge Herrenwelt umflatterte
sie und machte ihr den Hof. Die Schmeicheleien,
die sie anfangs unbeachtet ließ, machten ihr gar-
bald Vergnügen, und in kurzem wurden sic ihr
uncntbehrlich. Sogar heranszufordern suchte sie die-
selben. Stets suchte sie sich auf das vorteilhafteste
zu kleiden. Durch Kenntnisse, durch feine Manieren
suchte sie zu glänzen; ängstlich hielt sic alles fern,
was ihrem Ansehen schaden konnte. Als Kaufmanns-
tochter stellte sie sich vor; sie litt cs nie, daß man
sie von ihrem Hause abholtc; sic verabschiedete sich
stets schon ferne von der Wohnung und fand Vor-
wände mancherlei Art, Besuche abzuhaltcn: nur da-
mit niemand die elterliche Kellerbehansung kennen
lerne.
Noch ahnten die Eltern nichts von dieser Um-
Zusammentreffen mit den Torfgenossen zum Austausch
von Erlebnissen, zum Abschluß kleiner Handelsgeschäfte
und zur Besprechung gemeinsamer Angelegenheiten beim
Barbier schon Selbstzweck geworden. Allerdings ist auch
die Inanspruchnahme des „Verschönerungsratcs" selbst
nicht Nebensache. Der Spanier und auch der spanische
Bauer hält viel auf sein Äußeres und mit jedem Strich
des scharfen Messers über die harten Stoppeln seines
Bartes fühlt er sich mehr als Caballero. Dort vor dem
Dorf auf den knorrigen Wurzeln hat sein Vater auch
schon an allen Sonn- und Feiertagen gesessen, und seine
Söhne und Enkel werden es vermutlich ebenfalls tun,
denn die Kultur schreitet in Spanien noch langsamer
fort als anderswo, und der spanische Bauer ist in Tracht
und Sitte vielleicht der konservativste Mann in Europa.
Vis ?rolilLjckncnnspro2L!kion in Msn.
(Zietie 6cis 6ilä auf Zeile 555.)
^ines der höchsten Feste der katholischen Kirche ist der
Fronleichnamstag oder Sakramentstag. Er wurde
1264 vom Papste Urban IV. eingesetzt zur Feier der
wunderbaren Verwandlung der geweihten Hostie bei dem
Meßopfer in den Leib des Herrn (altdeutsch': Fron), und
Fronleichnam bedeutet also einfach: der Leib des Herrn.
Papst Johann XXII. befahl dann im Jahre 1316 das
Herumtragen des Sakraments in großer Prozession, das
noch heute in katholischen Ländern den Glanz- und
Mittelpunkt des Fronleichnamsfestes bildet. Besonders
in Wien wird die Fronleichnamsprozession stets unter
Entfaltung des hergebrachten kirchlich-höfischen Prunkes
abgehalten. In diesem Jahre war das glanzvolle Schau-
spiel vom herrlichsten Wetter begünstigt. Schon in den
Morgenstunden füllten sich die Straßen, welche die Pro-
zession durchziehen sollte, mit dichten Menschenmassen,
und die im Paradeanzug mit klingendem Spiel heran-
marschierenden Truppen, die Arcierengarde und die
ungarische Garde in ihren gold- und silberstrotzenden
Uniformen brachten Farbe in das Straßenbild, während
auf Ballonen und Tribünen und an allen Fenstern zahl-
lose Zuschauer zu sehen waren. Kaiser Franz Joseph,
welcher auf der Fahrt zum Stephansdom und auch auf
der Rückfahrt von dem Thronfolger Erzherzog Franz
Ferdinand begleitet war, saß in einem von acht Pferden
gezogenen Galawagen, in vier von je sechs Rappen ge-
zogenen Equipagen solgten die Erzherzoge Rainer, Franz
Salvator, Friedrich, Peter Ferdinand, Leopold Salvator,
Ferdinand Karl und Joseph Ferdinand. Die Prozession
ging vom Stephansdom durch die Kärntnerstratze über
den Neuen Markt, durch die Tegetthosfstraße, über den
Lobkowitzplatz, durch die Angustinerstrnße, über den
Michaelerplatz, den Kohlmarkt und über den Graben
zum Toni zurück. Hinter dem Allerheiligsten, das unter
einem kostbaren Baldachin getragen wurde, schritt bar-
häuptig der greise Kaiser, dann sämtliche Hofwürden-
träger, die Minister, die gesamte Generalität, alle
in Wien anwesenden Geheimen Räte, Kämmerer, Truch-
sessen und Ritter der österreichischen Orden. Rechts und
links gingen Edelknaben mit Kerzen in den Händen. Die
Feier schloß um hbll Uhr mit dem Vorbeimarsch der
Truppen vor dem Kaiser auf dem Franzensplatz der Hof-
burg. Unser Bild stellt den Augenblick dar, als die
Prozession den Graben passiert.
--
Oer ZMciliä in Mcirsäomen.
IV.
(Zielie 6ie 2 Liläer auf Zeile 558 un6 55H.)
4>cr mazedonische Aufstand hat bisher keine Entscheidung
nach der einen oder anderen Seite gebracht. Obwohl
eine große Anzahl von Bandenkümpfen stattfand, Dörfer
verwüstet wurden, Überfälle gelangen, sogar der russische
Konsul in Mitrowitza getötet worden ist, und die ganze
Welt durch die Bombenattentate in Saloniki in Auf-
regung versetzt wurde, steht die Angelegenheit im Grunde
noch genau so, wie bisher. Wo sich Banden zeigen,
treffen starke Abteilungen türkischer Truppen ein und
vernichten oder zerstreuen sie; zu größeren Unternehmungen
fehlt es den Aufständischen an Geld. Und so brodelt es
weiter unter der Oberfläche, und in den unzugänglichen
Wäldern haben die kleinsten Banden schon Schwierig-
keiten, den erforderlichen Proviant aufzubringen. Unsere
Bilder gestatten uns einen Einblick in die Verhältnisse
dieser kriegführenden Banden, deren Lebensmitteltransport
mehr einer Räuberbande nach glücklicher Plünderung
eines verlassenen Dorfes als einer Kriegerschar gleicht.
Allerdings haben die Aufständischen auch ganz besondere,
rein mechanische Schwierigkeiten zu überwinden, da alle
Lebensmittel auf den Schultern einzelner Männer ans
Schleichwegen durch unwegsame Schluchten und undurch-
dringliche Wälder zu den versteckten Lagern getragen
werden müssen. Wie lange dieser Kleinkrieg noch dauern
wird, ob die Pforte den guten Willen hat und ob sie
ihn, wenn er vorhanden ist, durchsetzen und das Land
durch gerechte Beamte und zweckmäßige Reformen be-
ruhigen kann, wird erst die Zukunft lehren. Solange
den kleinen Banden Aufständischer, die meist nur 6 oder
8 Personen betragen und sich nur hie und da zu
Scharen von 40 bis SO Personen vereinigen, nicht Schieß-
bedarf und Proviant ausgehen, werden sie in ihren
Wäldern und Bergen den Kampf fortführon, bis der
rauhe Winter der Balkanhalbinsel für dieses Jahr den
Unruhen ein Ende macht.
S-s? Oci; sinrige Kincl. s-s
LrrMlung von lü. kockt.
U W itternacht war längst vorüber. Totenstill
I I war es in der Katharinengasse, einer schma-
Z^RR.len Nebenstraße in der Arbeitervorstadt.
Alle Fenster waren dunkel. Nur aus einem Grün-
kram- nnd Kohlenkeller drang ein matter Lichtschein.
Der alte Gützow war da noch emsig tätig. Er
hatte die Früchte und das Gemüse sortiert, die Maße
gereinigt nnd die Wagschalen blank gerieben. Jetzt
war er auch mit dem Fegen im Kohlenranm fertig;
er löschte die Lampe und begab sich leise ins Wohn-
zimmer.
„Aber Marie," sagte er vorwurfsvoll zu seiner
Frau, „ich glaubte, du wärest schon längst zu Bett.
Willst du denn deine Angen mit Gewalt noch ganz
verderben?"
„Sei nicht böse, Karl, ich bin ja schon fertig,"
entgegnete sie lächelnd und legte die neuen Strümpfe
weg. „Die werden nnserer Kleinen wohl gut tun."
Zögernd versetzte der Vater: „Könnte Lieschen mit
ihren dreizehn Jahren denn nicht selber für ihre
Strümpfe sorgen? Gestern noch sagte Frau Hach-
mann, unsere Tochter wäre ein rechtes Zierpüppcheu,
das uns noch einmal viel Ärger machen würde."
„Laß doch Frau Hachmann schwatzen, was sie
will. Sie ist nur neidisch, weil Lieschen ein so hüb-
sches, sauberes, kluges Mädchen ist. Alle anderen
haben sie gern; von ihren eigenen frechen Schmutz-
finken mag freilich niemand etwas wissen. Was
geht es sie denn an, wenn wir unsere Tochter putzen.
Hachmauns können natürlich kein Geld für ihre
Kinder übrig haben; denn sie vertrinken und ver-
schleudern alles. — Sieh, Karl, wir haben von je-
her nur Sorge nnd Mühe gekannt, so wollen wir
wenigstens unserem Lieschen eine glückliche Jugend
verschaffen. Glaube mir, sie wird es uns danken,
denn sie ist doch ein liebes, gutes Kind."
„Das ist ja alles wahr, Marie. Auch mir ist
es am wohlsten, wenn ich Lieschen so recht heiter
und fröhlich sehe, und dach meine ich, daß es für
sie selbst das beste wäre, wenn sie auch im Hause
mit ansassen lernte."
„Dann laß sie doch Holz spalten nnd Kohlen
tragen."
„Sei nicht gleich ärgerlich, Mutter! Davou kann
ja gar nicht die Rede sein. Diese Arbeiten lasse ich
mir auch von niemand nehmen."
„Scheuern, waschen und Fenster putzen kann Lies-
chen doch auch nicht! Dazu ist sie viel zu zart.
Übrigens hat sie für die Schule so viel zu tun, daß
keine Zeit für andere Arbeit übrig bleibt. Nein,
nein, Karl; da will ich lieber selber noch viel mehr
schaffen, daß Lieschen solche Arbeit niemals nötig
hat."
„Komm, Lieschen, trinke deine Milch!" rief am
Morgen Frau Gützow.
„Ach, Mutter," erwiderte matt das Mädchen,
„ich kann nicht aufstehen. Mir tut der Kopf so
weh; es sticht im Halse, und ich kann nicht atmen!"
Erschrocken eilte die Mutter zu ihr. Da lag die
Kleine röchelnd mit fieberheißem Gesicht.
„Armes Herzchen!" tröstete sie. „Ich will dir
schnell einen Umschlag machen, nnd Vater soll den
Doktor holen."
Bald kam der Arzt. „Diphtherie," sagte er.
„Schicken Sie das Kind sofort nach dem Kranken-
hanse!"
„Nein, nein, Herr Doktor!" riefen Vater nnd
Mutter wie ans einem Munde. „Wir geben unser
Lieschen nicht her!"
Frau Gützow faßte jammernd die Hand des
Lieblings. „Nicht wahr, mein Engel, du bleibst bei
uns?"
„Bitte — bitte!" stöhnte die Kranke nnd schaute
mit großen, ängstlichen, brennenden Angen die Eltern
an. „Laßt mich nicht wegbringen; bitte, bitte, be-
haltet mich bei euch!"
Beruhigend strich der Vater über die glühende
Stirn: „Ja, Lieschen, du bleibst bei uns."
Alle Vorstellungen des Arztes waren umsonst.
Die Tochter blieb. Schwere Tage begannen für die
armen Eltern. Die Mutter wich nicht von Lies-
chens Bett, der Vater besorgte das Geschäft; dann
ließ er's sich nicht nehmen, auch einmal zu wachen,
die Mutter ans einen Augenblick zur Ruhe zwingend.
Sie wurden selber krank und elend dabei, die beiden,
wie Schatten schlichen sie dahin; aber sie fühlten es
nicht; nur die entsetzliche Angst um ihr Einziges
fühlten sie.
Endlich sagte der Arzt eines Morgens: „Nun
aber Mut gefaßt! Die Krisis ist vorüber."
Da löste sich der böse Druck von dem Herzen
Mackclruck Vörbolsn.)
der Eltern; sic atmeten wieder ans. Unter ihrer
sorgsamen Pflege genas die Tochter Kalo, und als
ihre Hellen Augen wieder heiter blickten und das
liebe, schelmische Lächeln wieder über ihr Antlitz zog,
da erholten sich auch die treuen Pfleger wieder.
Auch die Nachbarn, die den regsten Anteil an ihren,
Schmerz genommen, freuten sich über ihr Glück.
Selbst Fran Hachmann, die Trödlerin, zwang ihrem
Gesicht eine freundliche Miene aus, als sie Lieschen
zum ersten Male wieder auf dem Schulwege traf,
nnd rief: „Guten Morgen, Prinzeßchen — ich gra-
tuliere!"
Und Heini, ihr Laufjunge, verbeugte sich tief nnd
sagte: „Guten Morgen, Kellerprinzessin!"
Lieschen kümmerte sich nicht nm ihn; ebenso-
wenig nüe später nm die beiden Gymnasiasten, welche
sich anstießen nnd, die bunten Mützen ziehend, sag-
ten: „Ta ist sie ja endlich wieder!" Behend eilte sic
zur Schule, wo sie vou Lehreru und Mitschülerinnen
freudig empfangen wurde.
Die Krankheit Lieschens hatte die sorgende Liebe
der Eltern aufs äußerste gesteigert. Jede Freude,
jede Verstimmung der Tochter spiegelte sich in den
Augen des Vaters und der Mutter, und Lieschen
vergalt ihnen durch die zärtlichste Aufmerksamkeit.
So kam Ostern heran. Lieschen wurde konfir-
miert. Vater und Mutter begleiteten sie znm Gottes-
hanse. „Was für ein liebes, süßes Kind sie ist,"
flüsterte die Nachbarin, als Lieschen fromm znm
Altar trat. Eine feierliche Rührung bemächtigte sich
der Eltern. Diese Stimmung wurde noch verstärkt,
als sie zu Hause die vielen, vielen Beweise der
Achtung und Zuneigung von Lehrern, Freunden und
Bekannten erhielten. Bald war das Zimmer voll
fröhlicher Menschen.
Da ging der Vater hinaus. Im Kämmerlein
sand ihn die Gattin.
„Was fehlt dir, Karl? Bist du nicht zufrieden?"
„O, ich bin so glücklich, so glücklich, daß mir-
ganz bange wurde."
„Sei nicht närrisch, Karl, komm wieder herein!" —
Nach der Konfirmation besuchte Lieschen die Ge-
werbeschule, nm sich zur Kontoristin auszubilden.
Sie war glücklich; denn auch hier hatten sie Lehrer
und Mitschülerinnen ihres Fleißes, ihrer Klugheit
und ihrer Bescheidenheit wegen gern. Viele junge
Mädchen suchten ihre engere Freundschaft; auch
mancher junge Mann drängte sich an sie heran.
Lachend erzählte die Tochter von einem jungen Kauf-
mann, welcher jeden Morgen auf sie warte, und wie
sie ihn und manchen anderen abgefertigt habe. Mit
Stolz hörte stets die Mutter zu; doch über Vaters
Antlitz huschte manchmal auch ein leichter Schatten.
Die anderthalb Jahre, die Lieschens Ausbildung
erforderte, waren vorübcrgegangen. Es war eine
schwere Zeit für die Eltern gewesen. Doch die
Freude, ihre Tochter gut kleiden, ihr so manches
Vergnügen bereiten und Sonntags mit ihr aus-
gehen zu können, ließ sie die Arbeit und Entbehrung
der Woche gern ertragen. War es doch, als ob das
eigene Leben längst erloschen sei, und sie allein noch
in der Tochter weiter lebten.
Mit den besten Zeugnissen nnd Empfehlungen
ausgerüstet, hatte Lieschen die Schule verlassen und
sofort auch gute Stellung erhalten. Doch die Eltern
arbeiteten nnd entbehrten trotzdem weiter. „Es ist
ja für unsere Einzige nnd die einzige Freude, welche
wir uoch haben," sagten sie zu den Nachbarn, welche
zum ruhigen Genießen ihres Alters ermahnten.
„Sie soll einmal eine gute Aussteuer haben,
Karl," sagte stolz lächelnd die Mutter, wenn sie neue
Wäschestücke in den Kasten legte. Für die Sparkasse
war sogar noch jeden Monat etwas übrig.
Immer schöner blühte Lieschen heran; sic war
aller Liebling. Die junge Herrenwelt umflatterte
sie und machte ihr den Hof. Die Schmeicheleien,
die sie anfangs unbeachtet ließ, machten ihr gar-
bald Vergnügen, und in kurzem wurden sic ihr
uncntbehrlich. Sogar heranszufordern suchte sie die-
selben. Stets suchte sie sich auf das vorteilhafteste
zu kleiden. Durch Kenntnisse, durch feine Manieren
suchte sie zu glänzen; ängstlich hielt sic alles fern,
was ihrem Ansehen schaden konnte. Als Kaufmanns-
tochter stellte sie sich vor; sie litt cs nie, daß man
sie von ihrem Hause abholtc; sic verabschiedete sich
stets schon ferne von der Wohnung und fand Vor-
wände mancherlei Art, Besuche abzuhaltcn: nur da-
mit niemand die elterliche Kellerbehansung kennen
lerne.
Noch ahnten die Eltern nichts von dieser Um-