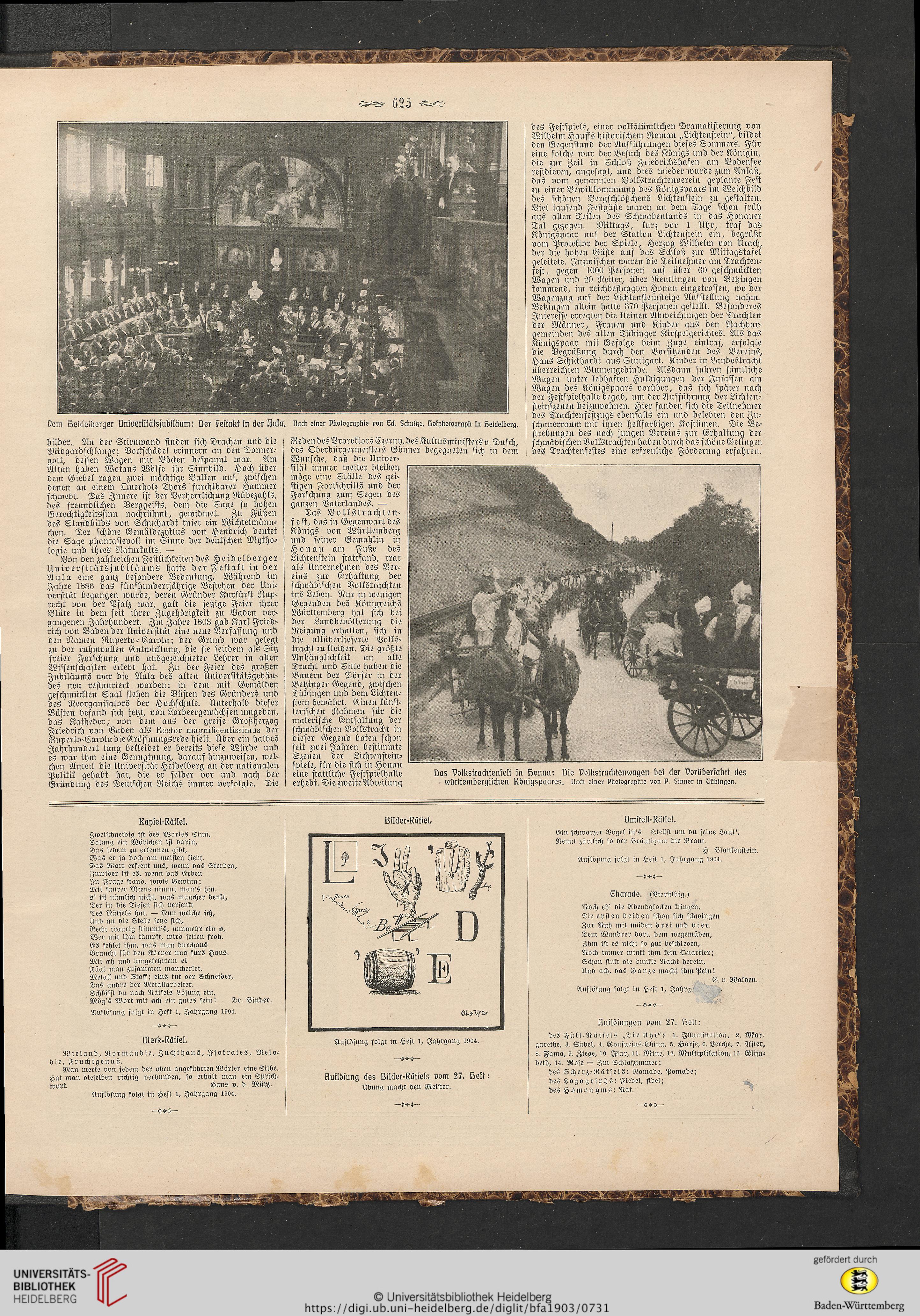625
Nack einer Photographie von Cck. Scknihö, 6okokotograph in iöoiäeiberg.
flom Keiäelberger Uiliverlltäkjubiläum: Ver kellakt in äer Zula,
bilder. An der Stirnwand finden sich Drachen und die
Midgardschlange; Bockschädel erinnern an den Donner-
gott, dessen Wagen mit Böcken bespannt war. Am
Altan haben Wotans Wölfe ihr Sinnbild. Hoch über
dem Giebel ragen zwei mächtige Balken auf, zwischen
denen an einem Querholz Thors furchtbarer Hammer
schwebt. Das Innere ist der Verherrlichung Rübezahls,
des freundlichen Berggeists, dem die Sage so hohen
Gerechtigkeitssinn nachrühmt, gewidmet. Zu Füßen
des Standbilds von Schuchardt kniet ein Wichtelmänn-
chen. Der schöne Gemäldezyklus von Hendrich deutet
die Sage phantasievoll im Sinne der deutschen Mytho-
logie und ihres Naturkults. —
Von den zahlreichen Festlichkeiten des Heidelberger
Universitätsjubiläums hatte der Festakt in der
Aula eine ganz besondere Bedeutung. Während im
Jahre 1886 das fünfhundertjährige Bestehen der Uni-
versität begangen wurde, deren Gründer Kurfürst Rup-
recht von der Pfalz war, galt die jetzige Feier ihrer
Blüte in dem seit ihrer Zugehörigkeit zu Baden ver-
gangenen Jahrhundert. Im Jahre 1803 gab Karl Fried-
rich von Baden der Universität eine neue Verfassung und
den Namen Ruperto-Carola; der Grund war gelegt
zu der ruhmvollen Entwicklung, die sie seitdem als Sitz
freier Forschung und ausgezeichneter Lehrer in allen
Wissenschaften erlebt hat. Zu der Feier des großen
Jubiläums war die Aula des alten Universitätsgebäu-
des neu restauriert worden: in dem mit Gemälden
geschmückten Saal stehen die Büsten des Gründers und
des Reorganisators der Hochschule. Unterhalb dieser
Büsten befand sich jetzt, von Lorbeergewächsen umgeben,
das Katheder, von dem aus der greise Großherzog
Friedrich von Baden als Usotor maZviüosntissimus der
Ruperto-Carola die Eröffnungsrede hielt. Über ein halbes
Jahrhundert lang bekleidet er bereits diese Würde und
es war ihm eine Genugtuung, darauf hinzuweisen, wel-
chen Anteil die Universität Heidelberg an der nationalen
Politik gehabt hat, die er selber vor und nach der
Gründung des Deutschen Reichs immer verfolgte. Die
Reden des Prorektors Czerny, des Kultusministersv. Dusch,
des Oberbürgermeisters Gönner begegneten sich in dem
Wunsche, daß die Univer-
sität immer weiter bleiben
möge eine Stätte des gei-
stigen Fortschritts und der
Forschung zum Segen des
ganzen Vaterlandes. —
Das Volkstrachten-
fest, das in Gegenwart des
Königs von Württemberg
und seiner Gemahlin in
Honau am Fuße des
Lichtenstein stattfand, trat
als Unternehmen des Ver-
eins zur Erhaltung der
schwäbischen Volkstrachten
ins Leben. Nur in wenigen
Gegenden des Königreichs
Württemberg hat sich bei
der Landbevölkerung die
Neigung erhalten, sich in
die altüberlieferte Volks-
tracht zu kleiden. Die größte
Anhänglichkeit an alte
Tracht und Sitte haben die
Bauern der Dörfer in der
Betzinger Gegend, zwischen
Tübingen und dem Lichten-
stein bewährt. Einen künst-
lerischen Rahmen sür die
malerische Entfaltung der
schwäbischen Volkstracht in
dieser Gegend boten schon
seit zwei Jahren bestimmte
Szenen der Lichtenstein-
spiele, für die sich in Honau
eine stattliche Festspielhalle
erhebt. Die zweite Abteilung
des Festspiels, einer volkstümlichen Dramatisierung von
Wilhelm Hauffs historischem Roman „Lichtenstein", bildet
den Gegenstand der Aufführungen dieses Sommers. Für
eine solche war der Besuch des Königs und der Königin,
die zur Zeit in Schloß Friedrichshafen am Bodensee
residieren, angesagt, und dies wieder wurde zum Anlaß,
das vom genannten Volkstrachtenverein geplante Fest
zu einer Bewillkommnung des Königspaars im Weichbild
des schönen Bergschlößchens Lichtenstein zu gestalten.
Viel tausend Festgäste waren au dem Tage schon früh
aus allen Teilen des Schwabenlands in das Honauer
Tal gezogen. Mittags, kurz vor 1 Uhr, traf das
Königspaar auf der Station Lichtenstein ein, begrüßt
vom Protektor der Spiele, Herzog Wilhelm von Urach,
der die hohen Gäste auf das Schloß zur Mittagstafel
geleitete. Inzwischen waren die Teilnehmer am Trachten-
fest, gegen 1000 Personen auf über 60 geschmückten
Wagen und 20 Reiter, über Reutlingen von Betzingen
kommend, im reichbeflaggten Honau eingetroffen, wo der
Wagenzug auf der Lichtensteinsteige Aufstellung nahm.
Betzingen allein hatte 370 Personen gestellt. Besonderes
Interesse erregten die kleinen Abweichungen der Trachten
der Männer, Frauen und Kinder aus den Nachbar-
gemeinden des alten Tübinger Kirspelgerichtes. Als das
Königspaar mit Gefolge beim Zuge eintraf, erfolgte
die Begrüßung durch den Vorsitzenden des Vereins,
Hans Schickhardt aus Stuttgart. Kinder in Landestracht
überreichten Blumengebinde. Alsdann fuhren sämtliche
Wagen unter lebhaften Huldigungen der Insassen am
Wagen des Königspaars vorüber, das sich später nach
der Festspielhalle begab, um der Ausführung der Lichten-
steinszenen beizuwohnen. Hier fanden sich die Teilnehmer
des Trachtenfestzugs ebenfalls ein und belebten den Zu-
schauerraum mit ihren hellfarbigen Kostümen. Die Be-
strebungen des noch jungen Vereins zur Erhaltung der
schwäbischen Volkstrachten haben durch das schöne Gelingen
des Trachtenfestes eine erfreuliche Förderung erfahren.
Vas Volkstmällenkell in konvu: Vie volksllaällsnumgen bei äer Vorüberkalnt äes
Mltteinbergilcben llönigspcuues. Nack einer Photographie von p. Linner in Tübingen.
llciplei-llätlel.
Zweischneidig ist des Wortes Sinn,
Solang ein Wörtchen ist darin.
Das jedem zu erkennen gibt.
Was er ja doch am meisten liebt.
Das Wort erfreut uns, wenn das Sterben,
Zuwider ist es, wenn das Erben
In Frage stand, sowie Gewinn;
Mit saurer Miene nimmt man's hin.
s' ist nämlich nicht, was mancher denkt.
Der in dis Tiefen sich versenkt
Des Rätsels hat. — Nnn weiche ich.
Und an die Stelle setze sich.
Recht traurig stimmt's, nunmehr ein o.
Wer mit ihm kämpft, wird selten froh.
Es fehlet ihm, was man durchaus
Braucht für den Körper und fürs Haus.
Mit ah und umgekehrtem ei
Fügt man zusammen mancherlei,
Metall und Stoff; eins tut der Schneider,
Das andre der Metallarbeiter.
Schläfst du nach Rätsels Lösung ein,
Mög's Wort mit ach ein gutes sein! Dr. Binder.
Auflösung folgt in Heft I, Jahrgang 1904.
Illerk-llällel.
Wteland, Normandie, Zuchthaus, Jsokrates, Melo-
die, Fruchtgenuß.
Man merke von jedem der oben angeführten Wörter eins Silbe.
Hat man dieselben richtig verbunden, so erhält man ein Sprich-
wort. Hans v. d. Mürz.
Auflösung folgt in Heft i, Jahrgang iso4.
Liiäer-llätiel.
Auflösung folgt in Heft 1, Jahrgang 1S04.
Zullölung lle; Liitler-llällelL vom 27. Kell:
Übung macht den Meister.
llmllell-llätlel.
Ein schwarzer Bogel ist's. Stellst um du seine Laut',
Nennt zärtlich so der Bräutigam die Braut.
H. Blankenstein.
Auflösung folgt in Heft 1, Jahrgang 1S04.
Lblirade. (Viersilbig.)
Noch eh' die Abendglocken klingen,
Die ersten beiden schon sich schwingen
Zur Ruh mit müden drei und vier.
Dem Wandrer dort, dem wegemüden.
Ihm ist es nicht so gut beschieden.
Noch immer winkt ihm kein Quartier;
Schon sinkt die dunkle Nacht herein.
Und ach, das Ganze macht ihm Pein!
E. v. Walden.
Auflösung folgt in Heft t, Jahrga
Zullölungen vom 27. kett:
des Füll-Rätsels „Die Uhr": 1. Illumination, 2. Mar-
garethe, s. Säbel, 4. Confucius-China, s. Harfe, s. Lerche, 7. Ilster,
s. Fama, s. Ziege, io Isar, il. Mine, 12. Multiplikation, is Elisa-
beth, 14. Rose — Im Schlafzimmer;
des Scherz-Rätsels: Nomade, Pomade:
des Logogriphs: Fiedel, fidel; ,
des Homonyms: Rat.
Nack einer Photographie von Cck. Scknihö, 6okokotograph in iöoiäeiberg.
flom Keiäelberger Uiliverlltäkjubiläum: Ver kellakt in äer Zula,
bilder. An der Stirnwand finden sich Drachen und die
Midgardschlange; Bockschädel erinnern an den Donner-
gott, dessen Wagen mit Böcken bespannt war. Am
Altan haben Wotans Wölfe ihr Sinnbild. Hoch über
dem Giebel ragen zwei mächtige Balken auf, zwischen
denen an einem Querholz Thors furchtbarer Hammer
schwebt. Das Innere ist der Verherrlichung Rübezahls,
des freundlichen Berggeists, dem die Sage so hohen
Gerechtigkeitssinn nachrühmt, gewidmet. Zu Füßen
des Standbilds von Schuchardt kniet ein Wichtelmänn-
chen. Der schöne Gemäldezyklus von Hendrich deutet
die Sage phantasievoll im Sinne der deutschen Mytho-
logie und ihres Naturkults. —
Von den zahlreichen Festlichkeiten des Heidelberger
Universitätsjubiläums hatte der Festakt in der
Aula eine ganz besondere Bedeutung. Während im
Jahre 1886 das fünfhundertjährige Bestehen der Uni-
versität begangen wurde, deren Gründer Kurfürst Rup-
recht von der Pfalz war, galt die jetzige Feier ihrer
Blüte in dem seit ihrer Zugehörigkeit zu Baden ver-
gangenen Jahrhundert. Im Jahre 1803 gab Karl Fried-
rich von Baden der Universität eine neue Verfassung und
den Namen Ruperto-Carola; der Grund war gelegt
zu der ruhmvollen Entwicklung, die sie seitdem als Sitz
freier Forschung und ausgezeichneter Lehrer in allen
Wissenschaften erlebt hat. Zu der Feier des großen
Jubiläums war die Aula des alten Universitätsgebäu-
des neu restauriert worden: in dem mit Gemälden
geschmückten Saal stehen die Büsten des Gründers und
des Reorganisators der Hochschule. Unterhalb dieser
Büsten befand sich jetzt, von Lorbeergewächsen umgeben,
das Katheder, von dem aus der greise Großherzog
Friedrich von Baden als Usotor maZviüosntissimus der
Ruperto-Carola die Eröffnungsrede hielt. Über ein halbes
Jahrhundert lang bekleidet er bereits diese Würde und
es war ihm eine Genugtuung, darauf hinzuweisen, wel-
chen Anteil die Universität Heidelberg an der nationalen
Politik gehabt hat, die er selber vor und nach der
Gründung des Deutschen Reichs immer verfolgte. Die
Reden des Prorektors Czerny, des Kultusministersv. Dusch,
des Oberbürgermeisters Gönner begegneten sich in dem
Wunsche, daß die Univer-
sität immer weiter bleiben
möge eine Stätte des gei-
stigen Fortschritts und der
Forschung zum Segen des
ganzen Vaterlandes. —
Das Volkstrachten-
fest, das in Gegenwart des
Königs von Württemberg
und seiner Gemahlin in
Honau am Fuße des
Lichtenstein stattfand, trat
als Unternehmen des Ver-
eins zur Erhaltung der
schwäbischen Volkstrachten
ins Leben. Nur in wenigen
Gegenden des Königreichs
Württemberg hat sich bei
der Landbevölkerung die
Neigung erhalten, sich in
die altüberlieferte Volks-
tracht zu kleiden. Die größte
Anhänglichkeit an alte
Tracht und Sitte haben die
Bauern der Dörfer in der
Betzinger Gegend, zwischen
Tübingen und dem Lichten-
stein bewährt. Einen künst-
lerischen Rahmen sür die
malerische Entfaltung der
schwäbischen Volkstracht in
dieser Gegend boten schon
seit zwei Jahren bestimmte
Szenen der Lichtenstein-
spiele, für die sich in Honau
eine stattliche Festspielhalle
erhebt. Die zweite Abteilung
des Festspiels, einer volkstümlichen Dramatisierung von
Wilhelm Hauffs historischem Roman „Lichtenstein", bildet
den Gegenstand der Aufführungen dieses Sommers. Für
eine solche war der Besuch des Königs und der Königin,
die zur Zeit in Schloß Friedrichshafen am Bodensee
residieren, angesagt, und dies wieder wurde zum Anlaß,
das vom genannten Volkstrachtenverein geplante Fest
zu einer Bewillkommnung des Königspaars im Weichbild
des schönen Bergschlößchens Lichtenstein zu gestalten.
Viel tausend Festgäste waren au dem Tage schon früh
aus allen Teilen des Schwabenlands in das Honauer
Tal gezogen. Mittags, kurz vor 1 Uhr, traf das
Königspaar auf der Station Lichtenstein ein, begrüßt
vom Protektor der Spiele, Herzog Wilhelm von Urach,
der die hohen Gäste auf das Schloß zur Mittagstafel
geleitete. Inzwischen waren die Teilnehmer am Trachten-
fest, gegen 1000 Personen auf über 60 geschmückten
Wagen und 20 Reiter, über Reutlingen von Betzingen
kommend, im reichbeflaggten Honau eingetroffen, wo der
Wagenzug auf der Lichtensteinsteige Aufstellung nahm.
Betzingen allein hatte 370 Personen gestellt. Besonderes
Interesse erregten die kleinen Abweichungen der Trachten
der Männer, Frauen und Kinder aus den Nachbar-
gemeinden des alten Tübinger Kirspelgerichtes. Als das
Königspaar mit Gefolge beim Zuge eintraf, erfolgte
die Begrüßung durch den Vorsitzenden des Vereins,
Hans Schickhardt aus Stuttgart. Kinder in Landestracht
überreichten Blumengebinde. Alsdann fuhren sämtliche
Wagen unter lebhaften Huldigungen der Insassen am
Wagen des Königspaars vorüber, das sich später nach
der Festspielhalle begab, um der Ausführung der Lichten-
steinszenen beizuwohnen. Hier fanden sich die Teilnehmer
des Trachtenfestzugs ebenfalls ein und belebten den Zu-
schauerraum mit ihren hellfarbigen Kostümen. Die Be-
strebungen des noch jungen Vereins zur Erhaltung der
schwäbischen Volkstrachten haben durch das schöne Gelingen
des Trachtenfestes eine erfreuliche Förderung erfahren.
Vas Volkstmällenkell in konvu: Vie volksllaällsnumgen bei äer Vorüberkalnt äes
Mltteinbergilcben llönigspcuues. Nack einer Photographie von p. Linner in Tübingen.
llciplei-llätlel.
Zweischneidig ist des Wortes Sinn,
Solang ein Wörtchen ist darin.
Das jedem zu erkennen gibt.
Was er ja doch am meisten liebt.
Das Wort erfreut uns, wenn das Sterben,
Zuwider ist es, wenn das Erben
In Frage stand, sowie Gewinn;
Mit saurer Miene nimmt man's hin.
s' ist nämlich nicht, was mancher denkt.
Der in dis Tiefen sich versenkt
Des Rätsels hat. — Nnn weiche ich.
Und an die Stelle setze sich.
Recht traurig stimmt's, nunmehr ein o.
Wer mit ihm kämpft, wird selten froh.
Es fehlet ihm, was man durchaus
Braucht für den Körper und fürs Haus.
Mit ah und umgekehrtem ei
Fügt man zusammen mancherlei,
Metall und Stoff; eins tut der Schneider,
Das andre der Metallarbeiter.
Schläfst du nach Rätsels Lösung ein,
Mög's Wort mit ach ein gutes sein! Dr. Binder.
Auflösung folgt in Heft I, Jahrgang 1904.
Illerk-llällel.
Wteland, Normandie, Zuchthaus, Jsokrates, Melo-
die, Fruchtgenuß.
Man merke von jedem der oben angeführten Wörter eins Silbe.
Hat man dieselben richtig verbunden, so erhält man ein Sprich-
wort. Hans v. d. Mürz.
Auflösung folgt in Heft i, Jahrgang iso4.
Liiäer-llätiel.
Auflösung folgt in Heft 1, Jahrgang 1S04.
Zullölung lle; Liitler-llällelL vom 27. Kell:
Übung macht den Meister.
llmllell-llätlel.
Ein schwarzer Bogel ist's. Stellst um du seine Laut',
Nennt zärtlich so der Bräutigam die Braut.
H. Blankenstein.
Auflösung folgt in Heft 1, Jahrgang 1S04.
Lblirade. (Viersilbig.)
Noch eh' die Abendglocken klingen,
Die ersten beiden schon sich schwingen
Zur Ruh mit müden drei und vier.
Dem Wandrer dort, dem wegemüden.
Ihm ist es nicht so gut beschieden.
Noch immer winkt ihm kein Quartier;
Schon sinkt die dunkle Nacht herein.
Und ach, das Ganze macht ihm Pein!
E. v. Walden.
Auflösung folgt in Heft t, Jahrga
Zullölungen vom 27. kett:
des Füll-Rätsels „Die Uhr": 1. Illumination, 2. Mar-
garethe, s. Säbel, 4. Confucius-China, s. Harfe, s. Lerche, 7. Ilster,
s. Fama, s. Ziege, io Isar, il. Mine, 12. Multiplikation, is Elisa-
beth, 14. Rose — Im Schlafzimmer;
des Scherz-Rätsels: Nomade, Pomade:
des Logogriphs: Fiedel, fidel; ,
des Homonyms: Rat.