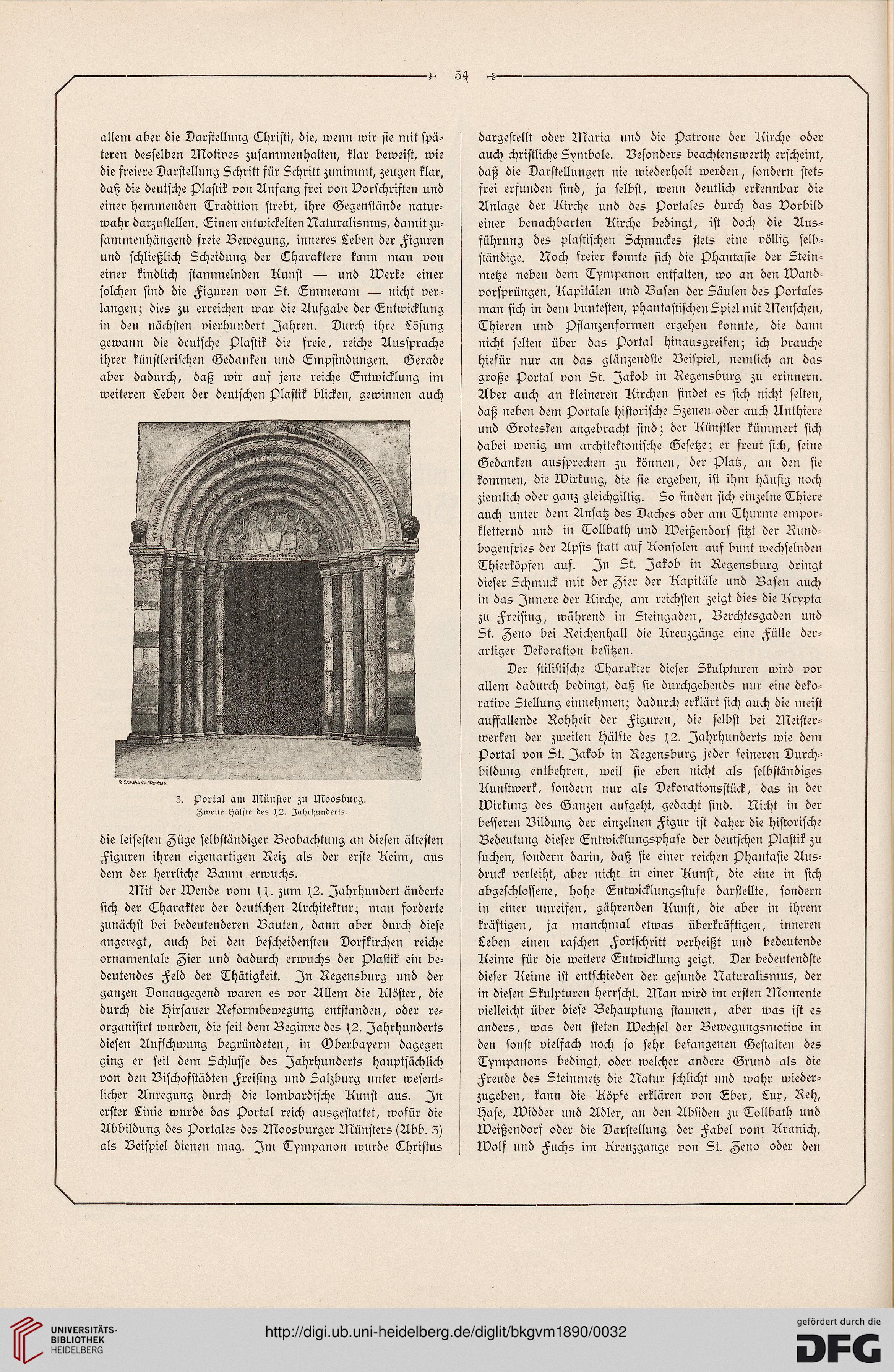allem aber die Darstellung Christi, die, wenn wir sie mit spä-
teren desselben Motives Zusammenhalten, klar beweist, wie
die freiere Darstellung Schritt für Schritt zunimmt, zeugen klar,
daß die deutsche Elastik von Anfang frei von Vorschriften und
einer hemmenden Tradition strebt, ihre Gegenstände natur-
wahr darzustellen. Tinen entwickelten Naturalismus, dannt zu-
sammenhängend freie Bewegung, inneres Leben der Figuren
und schließlich Scheidung der Charaktere kann inan von
einer kindlich stammelnden Kunst — und Werke einer
solchen sind die Figuren von St. Emmeram — nicht ver-
langen; dies zu erreichen war die Aufgabe der Entwicklung
in den nächsten vierhundert Jahren. Durch ihre Lösung
gewann die deutsche Plastik die freie, reiche Aussprache
ihrer künstlerischen Gedanken und Empfindungen. Gerade
aber dadurch, daß wir auf jene reiche Entwicklung im
weiteren Leben der deutschen Plastik blicken, gewinnen auch
3. portal am Münster zu Moosburg.
Zweite Hälfte des \2. Jahrhunderts.
die leisesten Züge selbständiger Beobachtung an diesen ältesten
Figuren ihren eigenartigen Reiz als der erste Keim, aus
dem der herrliche Baum erwuchs.
Mit der Wende vom ff. zum \2. Jahrhundert änderte
sich der Charakter der deutschen Architektur; man forderte
zunächst bei bedeutenderen Bauten, dann aber durch diese
angeregt, auch bei den bescheidensten Dorfkirchen reiche
ornamentale Zier und dadurch erwuchs der Plastik ein be-
deutendes Feld der Thätigkeit. Zn Regensburg und der
gatizen Donaugegend waren es vor Allem die Klöster, die
durch die pirsauer Reformbewegung entstanden, oder re-
organisirt wurden, die seit dem Beginne des {2. Jahrhunderts
diesen Aufschwung begründeten, in Vberbayern dagegen
ging er seit dem Schlüsse des Jahrhunderts hauptsächlich
von den Bischofstädten Freising und Salzburg unter wesent-
licher Anregung durch die lombardische Kunst aus. Zn
erster Linie wurde das Portal reich ausgestaltet, wofür die
Abbildung des Portales des Moosburger Münsters (Abb. 5)
als Beispiel dienen mag. Zm Tympanon wurde Christus
dargeftellt oder Maria und die Patrone der Kirche oder
auch christliche Symbole. Besonders beachtenswerth erscheint,
daß die Darstellungen nie wiederholt werden, sondern stets
frei erfunden sind, ja selbst, wenn deutlich erkennbar die
Anlage der Kirche und des portales durch das Vorbild
einer benachbarten Kirche bedingt, ist doch die Aus-
führung des plastischen Schmuckes stets eine völlig selb-
ständige. Noch freier konnte sich die Phantasie der Stein-
metze nebeti dem Tynipanon entfalten, wo an den Wand-
vorsprüngen, Kapitälen und Basen der Säulen des portales
man sich in den: buntesten, phantastischen Spiel ntit Menschen,
Thieren und Pflanzenformen ergehen konnte, die dann
nicht selten über das Portal hinausgreifen; ich brauche
hiefür nur an das glänzendste Beispiel, nemlich an das
große Portal von St. Zakob in Regensburg zu erinnern.
Aber auch an kleineren Kirchen findet es sich nicht selten,
daß neben dem Portale historische Szenen oder auch Knthiere
und Grotesken angebracht sind; der Künstler küntmert sich
dabei wenig um architektonische Gesetze; er freut sich, seine
Gedanken aussprechen zu können, der Platz, an den sie
kommen, die Wirkung, die sie ergeben, ist ihm häufig tioch
ziemlich oder ganz gleichgiltig. So finden sich einzelne Thiere
auch unter dem Ansatz des Daches oder am Thurme empor-
kletternd und in Tollbath und Weißendorf sitzt der Rund
bogenfries der Apsis statt auf Konsolen auf bunt wechselnden
Thierköpfen auf. Zit St. Zakob in Regensburg dringt
dieser Schmuck ntit der Zier der Kapitäle und Basen auch
in das Znnere der Kirche, an: reichsten zeigt dies die Krypta
zu Freising, während in Steingaden, Berchtesgaden und
St. Zeno bei Reichenhall die Kreuzgänge eine Fülle der-
artiger Dekoration besitzen.
Der stilistische Charakter dieser Skulpturen wird vor
allem dadurch bedingt, daß sie durchgehends nur eine deko-
rative Stellung einnehmen; dadurch erklärt sich auch die meist
auffallende Rohheit der Figuren, die selbst bei Meister-
werken der zweiten pälfte des \2. Zahrhunderts wie dem
Portal von St. Zakob in Regensburg jeder feineren Durch-
bildung entbehren, weil sie eben nicht als selbständiges
Kunstwerk, sondern nur als Dekorationsstück, das in der
Wirkung des Ganzen aufgeht, gedacht sind. Nicht in der
besseren Bildung der einzelnen Figur ist daher die historische
Bedeutung dieser Entwicklungsphase der deutschen Plastik zu
suchen, sondern dariit, daß sie einer reichen Phantasie Aus-
druck verleiht, aber nicht in einer Kunst, die eilte in sich
abgeschlossene, hohe Entwicklungsstufe darstellte, sondern
in einer unreifen, gährenden Kunst, die aber in ihrent
kräftigen, ja manchmal etwas überkräftigen, inneren
Leben einen raschen Fortschritt verheißt und bedeutende
Keime für die weitere Entwicklung zeigt. Der bedeutendste
dieser Keime ist entschieden der gesunde Naturalisntus, der
in diesen Skulpturen herrscht. Man wird int ersten Momente
vielleicht über diese Behauptung staunen, aber was ist es
anders, was den steten Wechsel der Bewegungsmotive in
den sonst vielfach noch so sehr befangenen Gestalten des
Tympanons bedingt, oder welcher andere Grund als die
Freude des Steinmetz die Natur schlicht und wahr wieder-
zugeben, kann die Köpfe erklären von Eber, Lux, Reh,
Pass, Widder und Adler, an den Absiden zu Tollbath und
Weißendorf oder die Darstellung der Fabel vont Kranich,
Wolf und Fuchs int Kreuzgange von St. Zeno oder den
teren desselben Motives Zusammenhalten, klar beweist, wie
die freiere Darstellung Schritt für Schritt zunimmt, zeugen klar,
daß die deutsche Elastik von Anfang frei von Vorschriften und
einer hemmenden Tradition strebt, ihre Gegenstände natur-
wahr darzustellen. Tinen entwickelten Naturalismus, dannt zu-
sammenhängend freie Bewegung, inneres Leben der Figuren
und schließlich Scheidung der Charaktere kann inan von
einer kindlich stammelnden Kunst — und Werke einer
solchen sind die Figuren von St. Emmeram — nicht ver-
langen; dies zu erreichen war die Aufgabe der Entwicklung
in den nächsten vierhundert Jahren. Durch ihre Lösung
gewann die deutsche Plastik die freie, reiche Aussprache
ihrer künstlerischen Gedanken und Empfindungen. Gerade
aber dadurch, daß wir auf jene reiche Entwicklung im
weiteren Leben der deutschen Plastik blicken, gewinnen auch
3. portal am Münster zu Moosburg.
Zweite Hälfte des \2. Jahrhunderts.
die leisesten Züge selbständiger Beobachtung an diesen ältesten
Figuren ihren eigenartigen Reiz als der erste Keim, aus
dem der herrliche Baum erwuchs.
Mit der Wende vom ff. zum \2. Jahrhundert änderte
sich der Charakter der deutschen Architektur; man forderte
zunächst bei bedeutenderen Bauten, dann aber durch diese
angeregt, auch bei den bescheidensten Dorfkirchen reiche
ornamentale Zier und dadurch erwuchs der Plastik ein be-
deutendes Feld der Thätigkeit. Zn Regensburg und der
gatizen Donaugegend waren es vor Allem die Klöster, die
durch die pirsauer Reformbewegung entstanden, oder re-
organisirt wurden, die seit dem Beginne des {2. Jahrhunderts
diesen Aufschwung begründeten, in Vberbayern dagegen
ging er seit dem Schlüsse des Jahrhunderts hauptsächlich
von den Bischofstädten Freising und Salzburg unter wesent-
licher Anregung durch die lombardische Kunst aus. Zn
erster Linie wurde das Portal reich ausgestaltet, wofür die
Abbildung des Portales des Moosburger Münsters (Abb. 5)
als Beispiel dienen mag. Zm Tympanon wurde Christus
dargeftellt oder Maria und die Patrone der Kirche oder
auch christliche Symbole. Besonders beachtenswerth erscheint,
daß die Darstellungen nie wiederholt werden, sondern stets
frei erfunden sind, ja selbst, wenn deutlich erkennbar die
Anlage der Kirche und des portales durch das Vorbild
einer benachbarten Kirche bedingt, ist doch die Aus-
führung des plastischen Schmuckes stets eine völlig selb-
ständige. Noch freier konnte sich die Phantasie der Stein-
metze nebeti dem Tynipanon entfalten, wo an den Wand-
vorsprüngen, Kapitälen und Basen der Säulen des portales
man sich in den: buntesten, phantastischen Spiel ntit Menschen,
Thieren und Pflanzenformen ergehen konnte, die dann
nicht selten über das Portal hinausgreifen; ich brauche
hiefür nur an das glänzendste Beispiel, nemlich an das
große Portal von St. Zakob in Regensburg zu erinnern.
Aber auch an kleineren Kirchen findet es sich nicht selten,
daß neben dem Portale historische Szenen oder auch Knthiere
und Grotesken angebracht sind; der Künstler küntmert sich
dabei wenig um architektonische Gesetze; er freut sich, seine
Gedanken aussprechen zu können, der Platz, an den sie
kommen, die Wirkung, die sie ergeben, ist ihm häufig tioch
ziemlich oder ganz gleichgiltig. So finden sich einzelne Thiere
auch unter dem Ansatz des Daches oder am Thurme empor-
kletternd und in Tollbath und Weißendorf sitzt der Rund
bogenfries der Apsis statt auf Konsolen auf bunt wechselnden
Thierköpfen auf. Zit St. Zakob in Regensburg dringt
dieser Schmuck ntit der Zier der Kapitäle und Basen auch
in das Znnere der Kirche, an: reichsten zeigt dies die Krypta
zu Freising, während in Steingaden, Berchtesgaden und
St. Zeno bei Reichenhall die Kreuzgänge eine Fülle der-
artiger Dekoration besitzen.
Der stilistische Charakter dieser Skulpturen wird vor
allem dadurch bedingt, daß sie durchgehends nur eine deko-
rative Stellung einnehmen; dadurch erklärt sich auch die meist
auffallende Rohheit der Figuren, die selbst bei Meister-
werken der zweiten pälfte des \2. Zahrhunderts wie dem
Portal von St. Zakob in Regensburg jeder feineren Durch-
bildung entbehren, weil sie eben nicht als selbständiges
Kunstwerk, sondern nur als Dekorationsstück, das in der
Wirkung des Ganzen aufgeht, gedacht sind. Nicht in der
besseren Bildung der einzelnen Figur ist daher die historische
Bedeutung dieser Entwicklungsphase der deutschen Plastik zu
suchen, sondern dariit, daß sie einer reichen Phantasie Aus-
druck verleiht, aber nicht in einer Kunst, die eilte in sich
abgeschlossene, hohe Entwicklungsstufe darstellte, sondern
in einer unreifen, gährenden Kunst, die aber in ihrent
kräftigen, ja manchmal etwas überkräftigen, inneren
Leben einen raschen Fortschritt verheißt und bedeutende
Keime für die weitere Entwicklung zeigt. Der bedeutendste
dieser Keime ist entschieden der gesunde Naturalisntus, der
in diesen Skulpturen herrscht. Man wird int ersten Momente
vielleicht über diese Behauptung staunen, aber was ist es
anders, was den steten Wechsel der Bewegungsmotive in
den sonst vielfach noch so sehr befangenen Gestalten des
Tympanons bedingt, oder welcher andere Grund als die
Freude des Steinmetz die Natur schlicht und wahr wieder-
zugeben, kann die Köpfe erklären von Eber, Lux, Reh,
Pass, Widder und Adler, an den Absiden zu Tollbath und
Weißendorf oder die Darstellung der Fabel vont Kranich,
Wolf und Fuchs int Kreuzgange von St. Zeno oder den