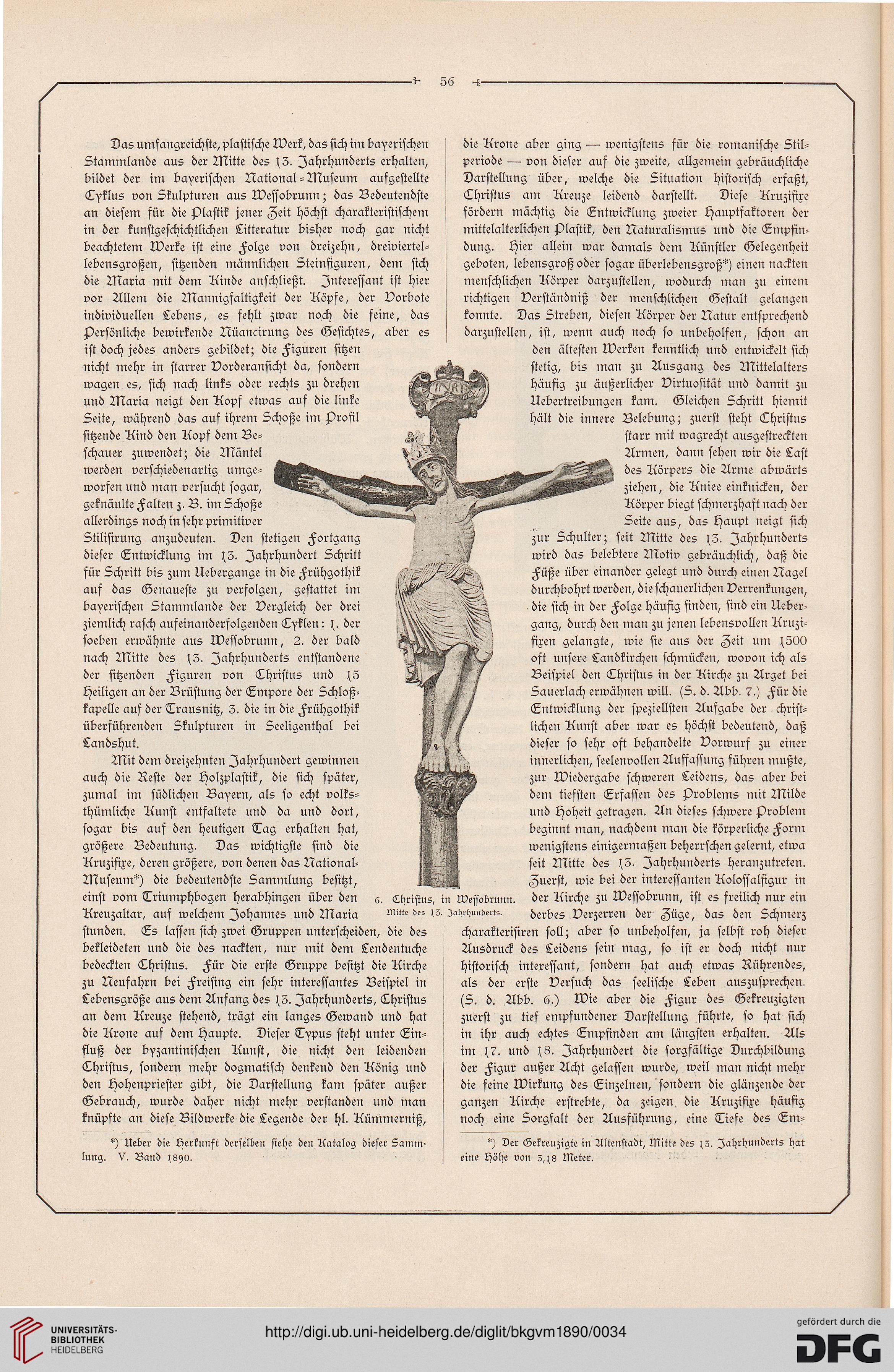-t'
■*- 56
Das umfangreichste, plastische Werk, das sich im bayerischen
Stammlande aus der Mitte des f3. Jahrhunderts erhalten,
bildet der in: bayerischen National - Museum aufgestellte
Lyklus von Skulpturen aus Wessobrunn; das Bedeutendste
an diesen: für die Plastik jener Zeit höchst charakteristischen:
in der kunstgeschichtlichen Litteratur bisher noch gar nicht
beachtetem Werke ist eine Folge von dreizehn, dreiviertel-
lebensgroßen, sitzenden männlichen Steinfiguren, den: sich
die Maria :nit den: Rinde anschließt. Interessant ist hier-
vor Allen: die Mannigfaltigkeit der Röpfe, der Borbote
individuellen Lebens, es fehlt zwar noch die feine, das
persönliche bewirkende Nüancirung des Gesichtes, aber es
ist doch jedes anders gebildet; die Figuren sitzen
nicht mehr in starrer Vorderansicht da, sondern
wagen es, sich nach links oder rechts zu drehen
und Maria neigt den Ropf etwas auf die linke
Seite, während das auf ihrem Schoße iin Profil
sitzende Rind den Ropf den: Be-
schauer zuwendet; die Mäntel
werden verschiedenartig umge-
worfen und man versucht sogar,
geknäulte Falten z. B. im Schoße
allerdings noch in sehr priinitiver
Stilisirung anzudeuten. Den stetigen Fortgang
dieser Entwicklung im 13. Jahrhundert Schritt
für Schritt bis zun: Rebergange in die Frühgothik
auf das Genaueste zu verfolgen, gestattet in:
bayerischen Stammlande der Vergleich der drei
ziemlich rasch auseinanderfolgenden Lyklen: der
soeben erwähnte aus Wessobrunn, 2. der bald
nach Mitte des 15. Jahrhunderts entstandene
der sitzenden Figuren von Lhristus und 15
Heiligen an der Brüstung der Empore der Schloß-
kapelle auf der Trausnitz, 3. die in die Frühgothik
überführenden Skulpturen in Seeligenthal bei
Landshut.
Mit de::: dreizehnten Jahrhundert gewinnen
auch die Reste der Holzplastik, die sich später,
zumal im südlichen Bayern, als so echt volks-
thüniliche Runst entfaltete und da und dort,
sogar bis auf den heutigen Tag erhalten hat,
größere Bedeutung. Das wichtigste sind die
Rruzifixe, deren größere, von denen das National-
Museum*) die bedeutendste Sammlung besitzt,
einst von: Trirnnphbogen herabhingen über den
Rreuzaltar, auf welchen: Johannes und Maria
stunden. Es lassen sich zwei Gruppen unterscheiden, die des
bekleideten und die des nackten, nur :::it den: Lendentuche
bedeckten Lhristus. Für die erste Gruppe besitzt die Rirche
zu Neufahrn bei Freising ein sehr interessantes Beispiel in
Lebensgröße aus den: Anfang des 15. Jahrhunderts, Lhristus
an den: Rreuze stehend, trägt ein langes Gewand und hat
die Rrone auf dem Haupte. Dieser Typus steht unter Ein-
siuß der byzantinischen Runst, die nicht den leidenden
Lhristus, sondern mehr dognmtisch denkend den Ränig und
den Hohenpriester gibt, die Darstellung kan: später außer
Gebrauch, wurde daher nicht mehr verstanden und man
knüpfte an diese Bildwerke die Legende der hl. Rümmerniß,
*) lieber die Herkunft derselben siehe den Katalog dieser Saturn«
lung. V. Band 1890.
die Rrone aber ging — wenigstens für die ronmnifche Stil-
periode — von dieser auf die zweite, allgemein gebräuchliche
Darstellung über, welche die Situation historisch erfaßt,
Lhristus an: Rreuze leidend darstellt. Diese Rruzifixe
fördern :::ächtig die Entwicklung zweier Hauptsaktoren der
mittelalterlichen Plastik, den Naturalismus und die Empfin-
dung. Hier allein war damals dem Rünstler Gelegenheit
geboten, lebensgroß oder sogar überlebensgroß*) einen nackten
menschlichen Rörper darzustellen, wodurch man zu einem
richtigen verständniß der :::enschlichen Gestalt gelangen
konnte. Das Streben, diesen Rörper der Natur entsprechend
darzustellen, ist, wenn auch noch so unbeholfen, schon an
den ältesten Werken kenntlich und entwickelt sich
stetig, bis man zu Ausgang des Mittelalters
häufig zu äußerlicher Virtuosität und damit zu
Rebertreibungen kam. Gleichen Schritt hiemit
hält die innere Belebung; zuerst steht Lhristus
starr :::it wagrecht ausgestreckten
Armen, dann sehen wir die Last
des Rörpers die Arme abwärts
ziehen, die Rniee einknicken, der
Rörper biegt schmerzhaft nach der
Seite aus, das Haupt neigt sich
zur Schulter; feit Mitte des j3. Jahrhunderts
wird das belebtere Motiv gebräuchlich, daß die
Füße über einander gelegt und durch einen Nagel
durchbohrt werden, die schauerlichen Verrenkungen,
die sich in der Folge häufig finden, sind ein Neber-
gang, durch den :::an zu jenen lebensvollen Rruzi-
fixen gelangte, wie sie aus der Zeit um f500
oft unsere Landkirchen schmücken, wovon ich als
Beispiel den Lhristus in der Rirche zu Arget bei
Saucrlach erwähnen will. (S. d. Abb. 7.) Für die
Entwicklung der speziellsten Aufgabe der christ-
lichen Runst aber war es höchst bedeutend, daß
dieser so sehr oft behandelte Vorwurf zu einer-
innerlichen, seelenvollen Auffassung führen :::ußte,
zur Wiedergabe schweren Leidens, das aber bei
den: tiefsten Erfassen des Probleins :::it Milde
und Hoheit getragen. An dieses schwere Problem
beginnt :::an, nachden: man die körperliche Forn:
wenigstens einigermaßen beherrschen gelernt, etwa
seit Mitte des 15. Jahrhunderts heranzutreten.
Zuerst, wie bei der interessanten Rolossalfigur in
der Rirche zu Wessobrunn, ist es freilich nur ein
derbes Verzerren der Züge, das den Sch:::erz
charakterisiren foll; aber fo unbeholfen, ja selbst roh dieser
Ausdruck des Leidens fein mag, so ist er doch nicht nur
historisch interessant, sondern hat auch etwas Rührendes,
als der erste Versuch das seelische Leben auszusprechen.
(S. d. Abb. 6.) Wie aber die Figur des Gekreuzigten
zuerst zu tief e:::pfundener Darstellung führte, so hat sich
in ihr auch echtes Empfinden an: längsten erhalten. Als
in: \7. und 1,8. Jahrhundert die sorgfältige Durchbildung
der Figur außer Acht gelassen wurde, weil rnan nicht mehr
die feine Wirkung des Einzelnen/sondern die glänzende der
ganzen Rirche erstrebte, da zeigen die Rruzifixe häufig
noch eine Sorgfalt der Ausführung, eine Tiefe des Em-
*) Der Gekreuzigte in Altenstadt, lllitte des ;z. Jahrhunderts hat
eine Höhe von z,;8 Meter.
6. Lhristus, in Wessobrunn.
Mitte des Jahrhunderts.
■*- 56
Das umfangreichste, plastische Werk, das sich im bayerischen
Stammlande aus der Mitte des f3. Jahrhunderts erhalten,
bildet der in: bayerischen National - Museum aufgestellte
Lyklus von Skulpturen aus Wessobrunn; das Bedeutendste
an diesen: für die Plastik jener Zeit höchst charakteristischen:
in der kunstgeschichtlichen Litteratur bisher noch gar nicht
beachtetem Werke ist eine Folge von dreizehn, dreiviertel-
lebensgroßen, sitzenden männlichen Steinfiguren, den: sich
die Maria :nit den: Rinde anschließt. Interessant ist hier-
vor Allen: die Mannigfaltigkeit der Röpfe, der Borbote
individuellen Lebens, es fehlt zwar noch die feine, das
persönliche bewirkende Nüancirung des Gesichtes, aber es
ist doch jedes anders gebildet; die Figuren sitzen
nicht mehr in starrer Vorderansicht da, sondern
wagen es, sich nach links oder rechts zu drehen
und Maria neigt den Ropf etwas auf die linke
Seite, während das auf ihrem Schoße iin Profil
sitzende Rind den Ropf den: Be-
schauer zuwendet; die Mäntel
werden verschiedenartig umge-
worfen und man versucht sogar,
geknäulte Falten z. B. im Schoße
allerdings noch in sehr priinitiver
Stilisirung anzudeuten. Den stetigen Fortgang
dieser Entwicklung im 13. Jahrhundert Schritt
für Schritt bis zun: Rebergange in die Frühgothik
auf das Genaueste zu verfolgen, gestattet in:
bayerischen Stammlande der Vergleich der drei
ziemlich rasch auseinanderfolgenden Lyklen: der
soeben erwähnte aus Wessobrunn, 2. der bald
nach Mitte des 15. Jahrhunderts entstandene
der sitzenden Figuren von Lhristus und 15
Heiligen an der Brüstung der Empore der Schloß-
kapelle auf der Trausnitz, 3. die in die Frühgothik
überführenden Skulpturen in Seeligenthal bei
Landshut.
Mit de::: dreizehnten Jahrhundert gewinnen
auch die Reste der Holzplastik, die sich später,
zumal im südlichen Bayern, als so echt volks-
thüniliche Runst entfaltete und da und dort,
sogar bis auf den heutigen Tag erhalten hat,
größere Bedeutung. Das wichtigste sind die
Rruzifixe, deren größere, von denen das National-
Museum*) die bedeutendste Sammlung besitzt,
einst von: Trirnnphbogen herabhingen über den
Rreuzaltar, auf welchen: Johannes und Maria
stunden. Es lassen sich zwei Gruppen unterscheiden, die des
bekleideten und die des nackten, nur :::it den: Lendentuche
bedeckten Lhristus. Für die erste Gruppe besitzt die Rirche
zu Neufahrn bei Freising ein sehr interessantes Beispiel in
Lebensgröße aus den: Anfang des 15. Jahrhunderts, Lhristus
an den: Rreuze stehend, trägt ein langes Gewand und hat
die Rrone auf dem Haupte. Dieser Typus steht unter Ein-
siuß der byzantinischen Runst, die nicht den leidenden
Lhristus, sondern mehr dognmtisch denkend den Ränig und
den Hohenpriester gibt, die Darstellung kan: später außer
Gebrauch, wurde daher nicht mehr verstanden und man
knüpfte an diese Bildwerke die Legende der hl. Rümmerniß,
*) lieber die Herkunft derselben siehe den Katalog dieser Saturn«
lung. V. Band 1890.
die Rrone aber ging — wenigstens für die ronmnifche Stil-
periode — von dieser auf die zweite, allgemein gebräuchliche
Darstellung über, welche die Situation historisch erfaßt,
Lhristus an: Rreuze leidend darstellt. Diese Rruzifixe
fördern :::ächtig die Entwicklung zweier Hauptsaktoren der
mittelalterlichen Plastik, den Naturalismus und die Empfin-
dung. Hier allein war damals dem Rünstler Gelegenheit
geboten, lebensgroß oder sogar überlebensgroß*) einen nackten
menschlichen Rörper darzustellen, wodurch man zu einem
richtigen verständniß der :::enschlichen Gestalt gelangen
konnte. Das Streben, diesen Rörper der Natur entsprechend
darzustellen, ist, wenn auch noch so unbeholfen, schon an
den ältesten Werken kenntlich und entwickelt sich
stetig, bis man zu Ausgang des Mittelalters
häufig zu äußerlicher Virtuosität und damit zu
Rebertreibungen kam. Gleichen Schritt hiemit
hält die innere Belebung; zuerst steht Lhristus
starr :::it wagrecht ausgestreckten
Armen, dann sehen wir die Last
des Rörpers die Arme abwärts
ziehen, die Rniee einknicken, der
Rörper biegt schmerzhaft nach der
Seite aus, das Haupt neigt sich
zur Schulter; feit Mitte des j3. Jahrhunderts
wird das belebtere Motiv gebräuchlich, daß die
Füße über einander gelegt und durch einen Nagel
durchbohrt werden, die schauerlichen Verrenkungen,
die sich in der Folge häufig finden, sind ein Neber-
gang, durch den :::an zu jenen lebensvollen Rruzi-
fixen gelangte, wie sie aus der Zeit um f500
oft unsere Landkirchen schmücken, wovon ich als
Beispiel den Lhristus in der Rirche zu Arget bei
Saucrlach erwähnen will. (S. d. Abb. 7.) Für die
Entwicklung der speziellsten Aufgabe der christ-
lichen Runst aber war es höchst bedeutend, daß
dieser so sehr oft behandelte Vorwurf zu einer-
innerlichen, seelenvollen Auffassung führen :::ußte,
zur Wiedergabe schweren Leidens, das aber bei
den: tiefsten Erfassen des Probleins :::it Milde
und Hoheit getragen. An dieses schwere Problem
beginnt :::an, nachden: man die körperliche Forn:
wenigstens einigermaßen beherrschen gelernt, etwa
seit Mitte des 15. Jahrhunderts heranzutreten.
Zuerst, wie bei der interessanten Rolossalfigur in
der Rirche zu Wessobrunn, ist es freilich nur ein
derbes Verzerren der Züge, das den Sch:::erz
charakterisiren foll; aber fo unbeholfen, ja selbst roh dieser
Ausdruck des Leidens fein mag, so ist er doch nicht nur
historisch interessant, sondern hat auch etwas Rührendes,
als der erste Versuch das seelische Leben auszusprechen.
(S. d. Abb. 6.) Wie aber die Figur des Gekreuzigten
zuerst zu tief e:::pfundener Darstellung führte, so hat sich
in ihr auch echtes Empfinden an: längsten erhalten. Als
in: \7. und 1,8. Jahrhundert die sorgfältige Durchbildung
der Figur außer Acht gelassen wurde, weil rnan nicht mehr
die feine Wirkung des Einzelnen/sondern die glänzende der
ganzen Rirche erstrebte, da zeigen die Rruzifixe häufig
noch eine Sorgfalt der Ausführung, eine Tiefe des Em-
*) Der Gekreuzigte in Altenstadt, lllitte des ;z. Jahrhunderts hat
eine Höhe von z,;8 Meter.
6. Lhristus, in Wessobrunn.
Mitte des Jahrhunderts.