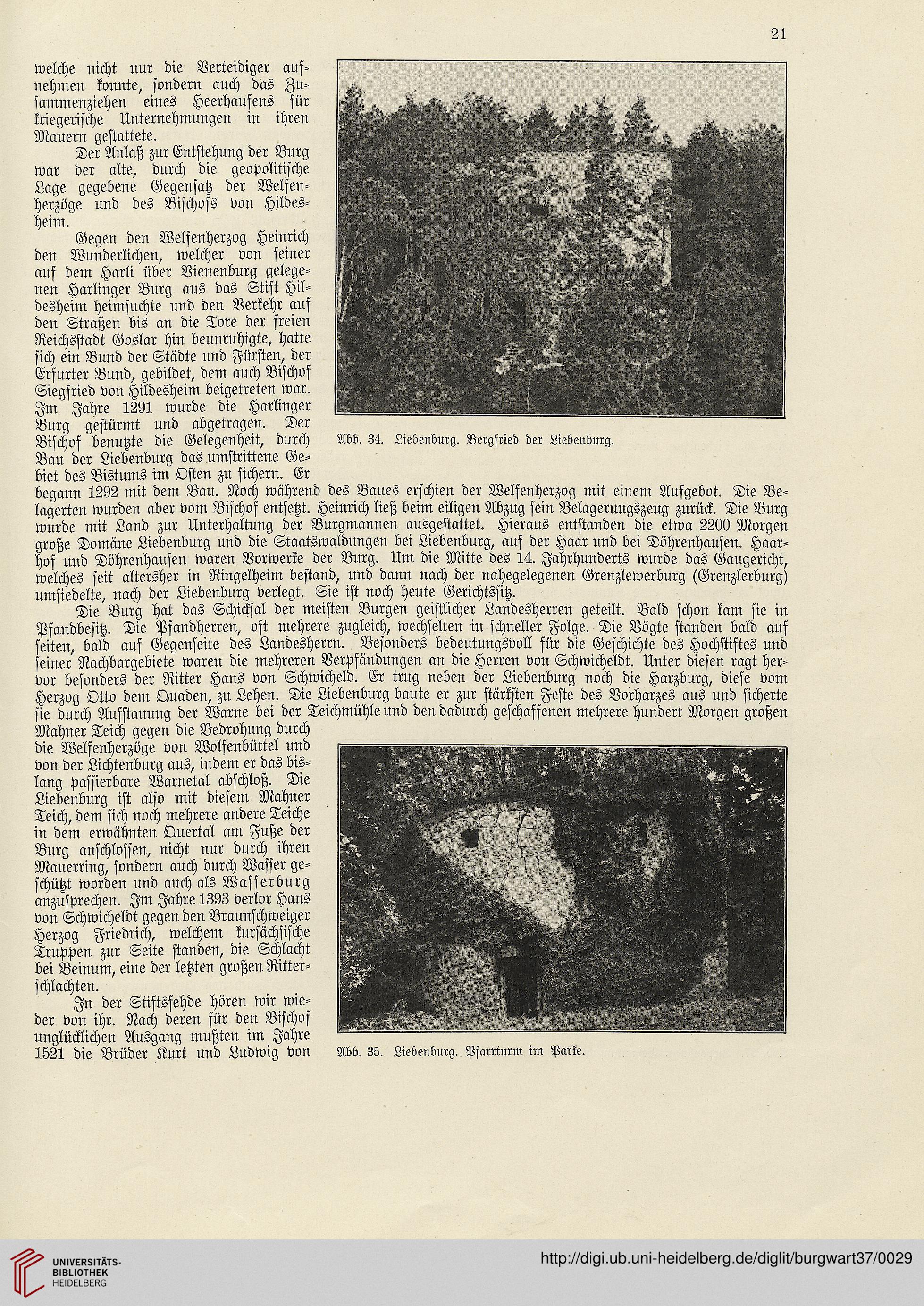21
Abb. 34. Liebenburg. Bergfried der Liebenburg.
welche nicht nur die Verteidiger auf-
nehmen konnte, sondern auch das Zu-
sammenziehen eines Heerhaufens für
kriegerische Unternehmungen in ihren
Mauern gestattete.
Der Anlaß zur Entstehung der Burg
war der alte, durch die geopolitische
Lage gegebene Gegensatz der Welfen-
herzöge und des Bischofs von Hildes-
heim.
Gegen den Welfenherzog Heinrich
den Wunderlichen, welcher von seiner
auf dem Harli über Vienenburg gelege-
nen Harlinger Burg aus das Stift Hil-
desheim heimsuchte und den Verkehr auf
den Straßen bis an die Tore der freien
Reichsstadt Goslar hin beunruhigte, hatte
sich ein Bund der Städte und Fürsten, der
Erfurter Bund, gebildet, dem auch Bischof
Siegfried von Hildesheim beigetreten war.
Im Jahre 1291 wurde die Harlinger
Burg gestürmt und abgetragen. Der
Bischof benutzte die Gelegenheit, durch
Bau der Liebenburg das umstrittene Ge-
biet des Bistums im Osten zu sichern. Er
begann 1292 mit dem Bau. Noch während des Baues erschien der Welfenherzog mit einem Aufgebot Die Be-
lagerten wurden aber vom Bischof entsetzt. Heinrich ließ beim eiligen Abzug sein Belagerungszeug zurück Die Burg
wurde mit Land zur Unterhaltung der Burgmannen ausgestattet. Hieraus entstanden die etwa 2200 Morgen
große Domäne Liebenburg und die Staatswaldungen bei Liebenburg, auf der Haar und bei Döhrenhausen L>aar-
hof und Döhrenhausen waren Vorwerke der Burg. Um die Mitte des 14. Jahrhunderts wurde das Gauqericht
welches seit altersher m Ringelheim bestand, und dann nach der nahegelegenen Grenzlewerburg (Grenzlerburq)
umsiedelte, nach der Liebenbnrg verlegt. Sie ist noch heute Gerichtssitz.
Die Burg hat das Schicksal der meisten Burgen geistlicher Landesherren geteilt. Bald schon kam sie in
Pfandbesitz. Die Pfandherren, oft mehrere zugleich, wechselten in schneller Folge. Die Vögte standen bald auf
seiten, bald auf Gegenseite des Landesherrn. Besonders bedeutungsvoll für die Geschichte des Hochstiftes und
seiner Nachbargebiete waren die mehreren Verpfändungen an die Herren von Schwicheldt. Unter diese,! ragt her-
vor besonders der Ritter Hans von Schwicheld. Er trug neben der Liebenburg noch die Harzburg diese vom
Herzog Otto dem Quaden, zu Lehen. Die Liebenburg baute er zur stärksten Feste des Borharzes aus und sicherte
sie durch Aufstauung der Warne bei der Teichmühle und den dadurch geschaffenen mehrere hundert Morgen großen
Mahner Teich gegen die Bedrohung durch
die Welfenherzöge von Wolfenbüttel und
von der Lichtenburg aus, indem er das bis-
lang passierbare Warnetal abschloß. Die
Liebenburg ist also mit diesem Mahner
Teich, dem sich noch mehrere andere Teiche
in dem erwähnten Quertal am Fuße der
Burg anschlossen, nicht nur durch ihren
Mauerring, sondern auch durch Wasser ge-
schützt worden und auch als Wasserburg
anzusprechen. Im Jahre 1393 verlor Hans
von Schwicheldt gegen den Braunschweiger
Herzog Friedrich, welchem kursächsische
Truppen zur Seite standen, die Schlacht
bei Beinum, eine der letzten großen Ritter-
schlachten.
In der Stiftsfehde hören wir wie-
der von ihr. Nach deren für den Bischof
unglücklichen Ausgang mußten im Jahre
1521 die Brüder Kurt und Ludwig von Abb. 35. Liebenburg. Pfarrturm im Parke.
Abb. 34. Liebenburg. Bergfried der Liebenburg.
welche nicht nur die Verteidiger auf-
nehmen konnte, sondern auch das Zu-
sammenziehen eines Heerhaufens für
kriegerische Unternehmungen in ihren
Mauern gestattete.
Der Anlaß zur Entstehung der Burg
war der alte, durch die geopolitische
Lage gegebene Gegensatz der Welfen-
herzöge und des Bischofs von Hildes-
heim.
Gegen den Welfenherzog Heinrich
den Wunderlichen, welcher von seiner
auf dem Harli über Vienenburg gelege-
nen Harlinger Burg aus das Stift Hil-
desheim heimsuchte und den Verkehr auf
den Straßen bis an die Tore der freien
Reichsstadt Goslar hin beunruhigte, hatte
sich ein Bund der Städte und Fürsten, der
Erfurter Bund, gebildet, dem auch Bischof
Siegfried von Hildesheim beigetreten war.
Im Jahre 1291 wurde die Harlinger
Burg gestürmt und abgetragen. Der
Bischof benutzte die Gelegenheit, durch
Bau der Liebenburg das umstrittene Ge-
biet des Bistums im Osten zu sichern. Er
begann 1292 mit dem Bau. Noch während des Baues erschien der Welfenherzog mit einem Aufgebot Die Be-
lagerten wurden aber vom Bischof entsetzt. Heinrich ließ beim eiligen Abzug sein Belagerungszeug zurück Die Burg
wurde mit Land zur Unterhaltung der Burgmannen ausgestattet. Hieraus entstanden die etwa 2200 Morgen
große Domäne Liebenburg und die Staatswaldungen bei Liebenburg, auf der Haar und bei Döhrenhausen L>aar-
hof und Döhrenhausen waren Vorwerke der Burg. Um die Mitte des 14. Jahrhunderts wurde das Gauqericht
welches seit altersher m Ringelheim bestand, und dann nach der nahegelegenen Grenzlewerburg (Grenzlerburq)
umsiedelte, nach der Liebenbnrg verlegt. Sie ist noch heute Gerichtssitz.
Die Burg hat das Schicksal der meisten Burgen geistlicher Landesherren geteilt. Bald schon kam sie in
Pfandbesitz. Die Pfandherren, oft mehrere zugleich, wechselten in schneller Folge. Die Vögte standen bald auf
seiten, bald auf Gegenseite des Landesherrn. Besonders bedeutungsvoll für die Geschichte des Hochstiftes und
seiner Nachbargebiete waren die mehreren Verpfändungen an die Herren von Schwicheldt. Unter diese,! ragt her-
vor besonders der Ritter Hans von Schwicheld. Er trug neben der Liebenburg noch die Harzburg diese vom
Herzog Otto dem Quaden, zu Lehen. Die Liebenburg baute er zur stärksten Feste des Borharzes aus und sicherte
sie durch Aufstauung der Warne bei der Teichmühle und den dadurch geschaffenen mehrere hundert Morgen großen
Mahner Teich gegen die Bedrohung durch
die Welfenherzöge von Wolfenbüttel und
von der Lichtenburg aus, indem er das bis-
lang passierbare Warnetal abschloß. Die
Liebenburg ist also mit diesem Mahner
Teich, dem sich noch mehrere andere Teiche
in dem erwähnten Quertal am Fuße der
Burg anschlossen, nicht nur durch ihren
Mauerring, sondern auch durch Wasser ge-
schützt worden und auch als Wasserburg
anzusprechen. Im Jahre 1393 verlor Hans
von Schwicheldt gegen den Braunschweiger
Herzog Friedrich, welchem kursächsische
Truppen zur Seite standen, die Schlacht
bei Beinum, eine der letzten großen Ritter-
schlachten.
In der Stiftsfehde hören wir wie-
der von ihr. Nach deren für den Bischof
unglücklichen Ausgang mußten im Jahre
1521 die Brüder Kurt und Ludwig von Abb. 35. Liebenburg. Pfarrturm im Parke.