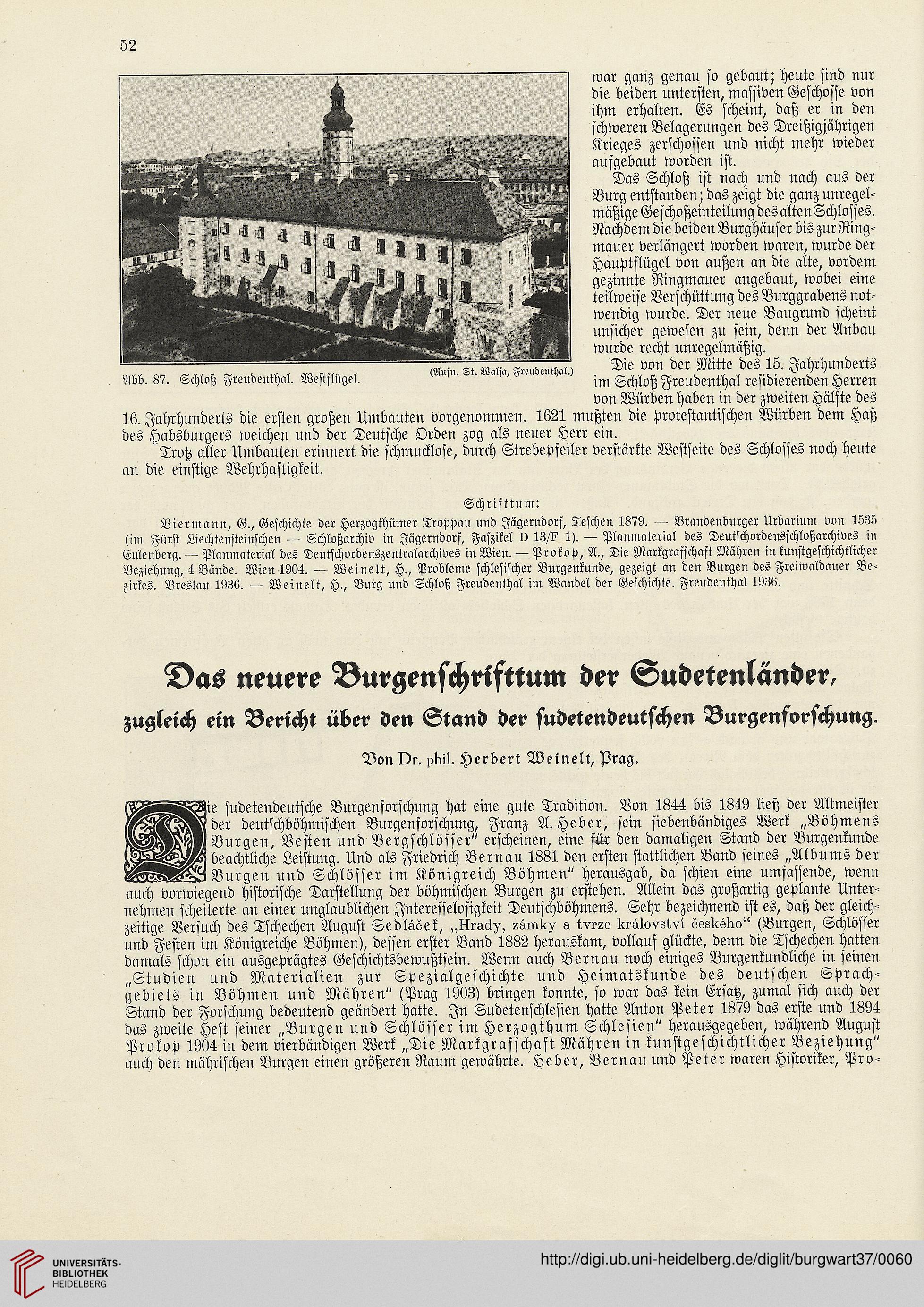war ganz genau so gebaut; heute sind nur
die beiden untersten, massiven Geschosse von
ihm erhalten. Es scheint, daß er in den
schweren Belagerungen des Dreißigjährigen
Krieges zerschossen und nicht mehr wieder
aufgebaut worden ist.
Das Schloß ist nach und nach aus der
Burg entstanden; das zeigt die ganz unregel-
mäßige Geschoßeinteilung des alten Schlosses.
Nachdem die beiden Burghäuser bis zur Ring-
mauer verlängert worden waren, wurde der
Hauptflügel von außen an die alte, vordem
gezinnte Ringmauer angebaut, wobei eine
teilweise Verschüttung des Burggrabens not-
wendig wurde. Der neue Baugrund scheint
unsicher gewesen zu sein, denn der Änbau
wurde recht unregelmäßig.
Die von der Mitte des 15. Jahrhunderts
im Schloß Freudenthal residierenden Herren
von Würben haben in der zweiten Hälfte des
16. Jahrhunderts die ersten großen Umbauten vorgenommen. 1621 mußten die protestantischen Würben dem Haß
des Habsburgers weichen und der Deutsche Orden zog als neuer Herr ein.
Trotz aller Umbauten erinnert die schmucklose, durch Strebepfeiler verstärkte Westseite des Schlosses noch heute
an die einstige Wehrhaftigkeit.
Abb. 87. Schloß Freudenthal. Westflügel.
(Aufm St. Walsa, Freudenthal.)
Schrifttum:
Biermanu, G., Geschichte der Herzogthümer Troppau und Jägerndorf, Teschen 1879. — Brandenburger Urbarium von 1535
lim Fürst Liechteusteinschen — Schloßarchiv in Jägerndorf, Faszikel v 13/1? 1). — Planmaterinl des Deutschordensschloßarchives in
Eülenberg. — Planmaterial des Deutschordenszeutralarchives in Wien. — Prokop, A., Die Markgrafschaft Mähren in kunstgeschichtlicher
Beziehung, 1 Bände. Wien 1901. — Weinelt, H., Probleme schlesischer Burgenkunde, gezeigt an den Burgen des Freiwaldaner Be-
zirkes. Breslau 1936. — Weinelt, H., Burg und Schloß Freudenthal im Wandel der Geschichte. Freudenthal 1936.
Das neuere Burgenschrifttum der Sudetenländer,
zugleich ein Bericht über den Stand der sudetendeutschen Burgenforschung.
Von Or. phil. Herbert Wernelt, Prag.
Hie sudetendeutsche Burgenforschung hat eine gute Tradition. Von 1844 bis 1849 ließ der Altmeister
's der deutschböhmischen Burgenforschung, Franz A. Heber, sein siebenbändiges Werk „Böhmens
l Burgen, Besten und Bergschlösser" erscheinen, eine für den damaligen Stand der Burgenkunde
! beachtliche Leistung. Und als Friedrich Bernau 1881 den ersten stattlichen Band seines „Albums der
l Burgen und Schlösser im Königreich Böhmen" herausgab, da schien eine umfassende, wenn
auch vorwiegend historische Darstellung der böhmischen Burgen zu erstehen. Allein das großartig geplante Unter-
nehmen scheiterte an einer unglaublichen Interesselosigkeit Deutschböhmens. Sehr bezeichnend ist es, daß der gleich-
zeitige Versuch des Tschechen August Sedläöek, „llrackv, xämüv a 1vr/e ürälovstvi öesüsüo" (Burgen, Schlösser
und Festen im Königreiche Böhmen), dessen erster Band 1882 herauskam, vollauf glückte, denn die Tschechen hatten
damals schon ein ausgeprägtes Geschichtsbewußtsein. Wenn auch Bernau noch einiges Burgenkundliche in seinen
„Studien und Materialien zur Spezialgeschichte und Heimatskunde des deutschen Sprach-
gebiets in Böhmen und Mähren" (Prag 1903) bringen konnte, so war das kein Ersatz, zumal sich auch der
Stand der Forschung bedeutend geändert hatte. In Sudetenschlesien hatte Anton Peter 1879 das erste und 1894
das zweite Heft seiner „Burgen und Schlösser im Herzogthum Schlesien" herausgegeben, während August
Prokop 1904 in dem vierbändigen Werk „Die Markgrafschaft Mähren in kunstgeschichtlicher Beziehung"
auch den mährischen Burgen einen größeren Raum gewährte. Heber, Bernau und Peter waren Historiker, Pro-