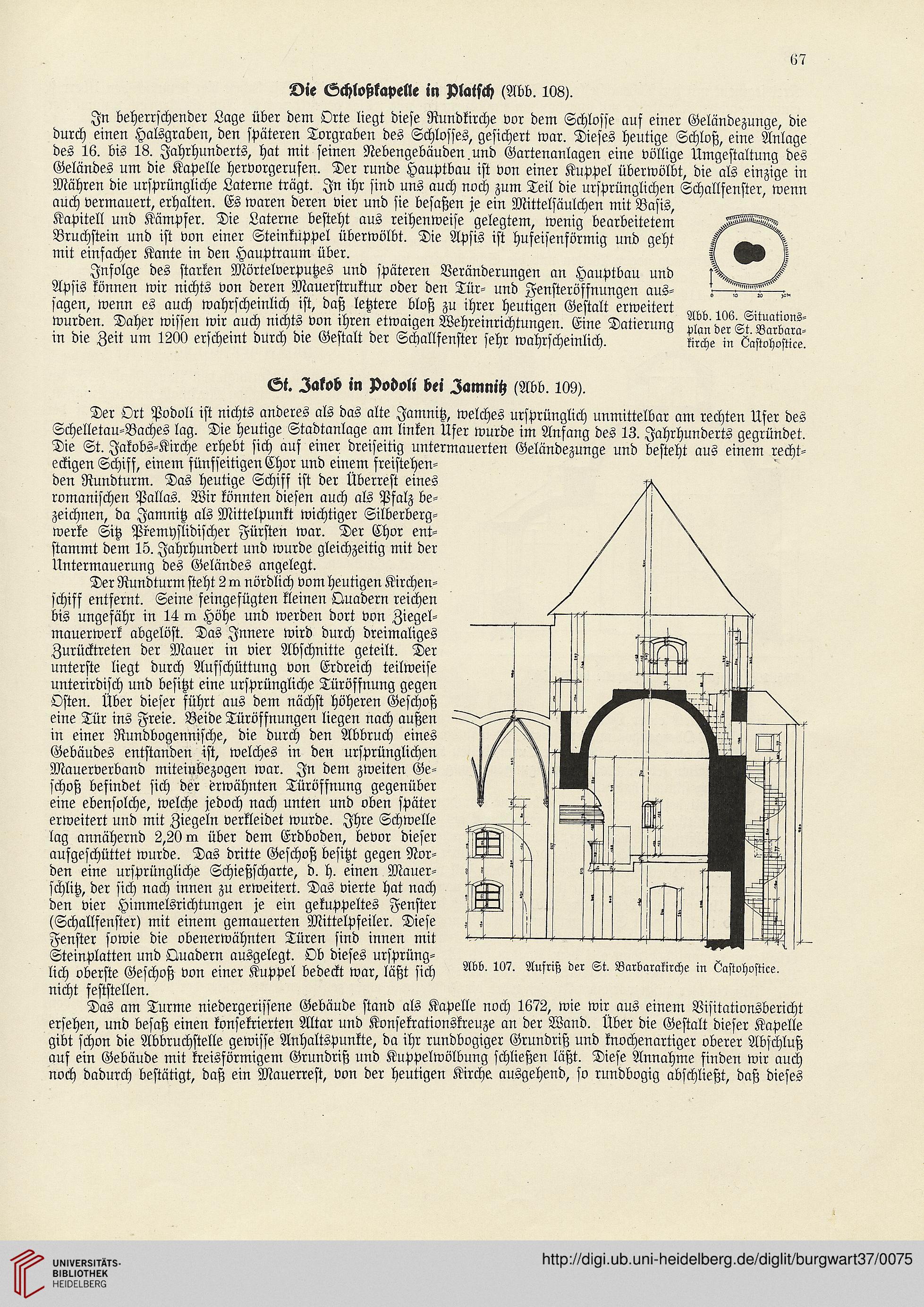67
Die Schloßkapelle in platsch (Wb. 108).
In beherrschender Lage über dem Orte liegt diese Rundkirche vor dem Schlosse auf einer Geländezunge, die
durch einen Halsgraben, den späteren Torgraben des Schlosses, gesichert war. Dieses heutige Schloß, eine Anlage
des 16. bis 18. Jahrhunderts, hat mit seinen Nebengebäuden, und Gartenanlagen eine völlige Umgestaltung des
Geländes um die Kapelle hervorgerusen. Der runde Hauptbau ist von einer Kuppel überwölbt, die als einzige in
Mähren die ursprüngliche Laterne trägt. In ihr sind uns auch noch zum Teil die ursprünglichen Schallfenster, wenn
auch vermauert, erhalten. Es waren deren vier und sie besaßen je ein Mittelsäulchen mit Basis,
Kapitell und Kämpfer. Die Laterne besteht aus reihenweise gelegtem, wenig bearbeitetem
Bruchstein und ist von einer Steinkuppel überwölbt. Die Apsis ist hufeisenförmig und geht
mit einfacher Kante in den Hauptraum über.
Infolge des starken Mörtelverputzes und späteren Veränderungen an Hauptbau und
Apsis können wir nichts von deren Mauerstruktur oder den Tür- und Fensteröffnungen aus-
sagen, wenn es auch wahrscheinlich ist, daß letztere bloß zu ihrer heutigen Gestalt erweitert „ „ » .
wurden. Daher wissen wir auch nichts von ihren etwaigen Wehreinrichtungen. Eine Datierung plan der St Barbara-
in die Zeit um 1200 erscheint durch die Gestalt der Schallfenster sehr wahrscheinlich. ' kirche in 6astohostice.
St. Jakob in podoli bei Iamnih (Abb. 109)
Der Ort Podoli ist nichts anderes als das alte Jamnitz, welches ursprünglich unmittelbar am rechten Ufer des
Schelletau-Baches lag. Die heutige Stadtanlage am linken Ufer wurde im Anfang des 13. Jahrhunderts gegründet.
Die St. Jakobs-Kirche erhebt sich auf einer dreiseitig untermauerten Geländezunge und besteht aus einem recht-
eckigen Schiff, einem fünfseitigen Chor und einem freistehen-
den Rundturm. Das heutige Schiff ist der Überrest eines zz.
romanischen Pallas. Wir könnten diesen auch als Pfalz be-
zeichnen/da Jamnitz als Mittelpunkt wichtiger Silberberg-
werke Sitz Premyslidischer Fürsten war. Der Chor ent-
stammt dem 15. Jahrhundert und wurde gleichzeitig mit der
Untermauerung des Geländes angelegt.
Der Rundturm steht 2 m nördlich vom heutigen Kirchen-
schiff entfernt. Seine feingefügten kleinen Quadern reichen
bis ungefähr in 14 in Höhe und werden dort von Ziegel-
mauerwerk abgelöst. Das Innere wird durch dreimaliges
Zurücktreten der Mauer in vier Abschnitte geteilt. Der
unterste liegt durch Aufschüttung von Erdreich teilweise
unterirdisch und besitzt eine ursprüngliche Türöffnung gegen
Osten. Über dieser führt aus dem nächst höheren Geschoß
eine Tür ins Freie. Beide Türöffnungen liegen nach außen
in einer Rundbogennische, die durch den Abbruch eines
Gebäudes entstanden ist, welches in den ursprünglichen
Mauerverband miteinbezogen war. In dem zweiten Ge-
schoß befindet sich der erwähnten Türöffnung gegenüber
eine ebensolche, welche jedoch nach unten und oben später
erweitert und mit Ziegeln verkleidet wurde. Ihre Schwelle
lag annähernd 2,20 m über dem Erdboden, bevor dieser
aufgeschüttet wurde. Das dritte Geschoß besitzt gegen Nor-
den eine ursprüngliche Schießscharte, d. h. einen Mauer-
schlitz, der sich nach innen zu erweitert. Das vierte hat nach
den vier Himmelsrichtungen je ein gekuppeltes Fenster
(Schallfenster) mit einem gemauerten Mittelpfeiler. Diese
Fenster sowie die obenerwähnten Türen sind innen mit
Steinplatten und Quadern ausgelegt. Ob dieses ursprüng-
lich oberste Geschoß von einer Kuppel bedeckt war, läßt sich
Abb. 107. Aufriß der St. Barbarakirche in öastohostice.
nicht feststellen.
Das am Turme niedergerissene Gebäude stand als Kapelle noch 1672, wie wir aus einem Bisitationsbericht
ersehen, und besaß einen konsekrierten Altar und Konsekrationskreuze an der Wand. Uber die Gestalt dieser Kapelle
gibt schon die Abbruchstelle gewisse Anhaltspunkte, da ihr rundbogiger Grundriß und knochenartiger oberer Abschluß
auf ein Gebäude mit kreisförmigem Grundriß und Kuppelwölbung schließen läßt. Diese Annahme finden wir auch
noch dadurch bestätigt, daß ein 'Mauerrest, von der heutigen Kirche ausgehend, so rundbogig abschließt, daß dieses
Die Schloßkapelle in platsch (Wb. 108).
In beherrschender Lage über dem Orte liegt diese Rundkirche vor dem Schlosse auf einer Geländezunge, die
durch einen Halsgraben, den späteren Torgraben des Schlosses, gesichert war. Dieses heutige Schloß, eine Anlage
des 16. bis 18. Jahrhunderts, hat mit seinen Nebengebäuden, und Gartenanlagen eine völlige Umgestaltung des
Geländes um die Kapelle hervorgerusen. Der runde Hauptbau ist von einer Kuppel überwölbt, die als einzige in
Mähren die ursprüngliche Laterne trägt. In ihr sind uns auch noch zum Teil die ursprünglichen Schallfenster, wenn
auch vermauert, erhalten. Es waren deren vier und sie besaßen je ein Mittelsäulchen mit Basis,
Kapitell und Kämpfer. Die Laterne besteht aus reihenweise gelegtem, wenig bearbeitetem
Bruchstein und ist von einer Steinkuppel überwölbt. Die Apsis ist hufeisenförmig und geht
mit einfacher Kante in den Hauptraum über.
Infolge des starken Mörtelverputzes und späteren Veränderungen an Hauptbau und
Apsis können wir nichts von deren Mauerstruktur oder den Tür- und Fensteröffnungen aus-
sagen, wenn es auch wahrscheinlich ist, daß letztere bloß zu ihrer heutigen Gestalt erweitert „ „ » .
wurden. Daher wissen wir auch nichts von ihren etwaigen Wehreinrichtungen. Eine Datierung plan der St Barbara-
in die Zeit um 1200 erscheint durch die Gestalt der Schallfenster sehr wahrscheinlich. ' kirche in 6astohostice.
St. Jakob in podoli bei Iamnih (Abb. 109)
Der Ort Podoli ist nichts anderes als das alte Jamnitz, welches ursprünglich unmittelbar am rechten Ufer des
Schelletau-Baches lag. Die heutige Stadtanlage am linken Ufer wurde im Anfang des 13. Jahrhunderts gegründet.
Die St. Jakobs-Kirche erhebt sich auf einer dreiseitig untermauerten Geländezunge und besteht aus einem recht-
eckigen Schiff, einem fünfseitigen Chor und einem freistehen-
den Rundturm. Das heutige Schiff ist der Überrest eines zz.
romanischen Pallas. Wir könnten diesen auch als Pfalz be-
zeichnen/da Jamnitz als Mittelpunkt wichtiger Silberberg-
werke Sitz Premyslidischer Fürsten war. Der Chor ent-
stammt dem 15. Jahrhundert und wurde gleichzeitig mit der
Untermauerung des Geländes angelegt.
Der Rundturm steht 2 m nördlich vom heutigen Kirchen-
schiff entfernt. Seine feingefügten kleinen Quadern reichen
bis ungefähr in 14 in Höhe und werden dort von Ziegel-
mauerwerk abgelöst. Das Innere wird durch dreimaliges
Zurücktreten der Mauer in vier Abschnitte geteilt. Der
unterste liegt durch Aufschüttung von Erdreich teilweise
unterirdisch und besitzt eine ursprüngliche Türöffnung gegen
Osten. Über dieser führt aus dem nächst höheren Geschoß
eine Tür ins Freie. Beide Türöffnungen liegen nach außen
in einer Rundbogennische, die durch den Abbruch eines
Gebäudes entstanden ist, welches in den ursprünglichen
Mauerverband miteinbezogen war. In dem zweiten Ge-
schoß befindet sich der erwähnten Türöffnung gegenüber
eine ebensolche, welche jedoch nach unten und oben später
erweitert und mit Ziegeln verkleidet wurde. Ihre Schwelle
lag annähernd 2,20 m über dem Erdboden, bevor dieser
aufgeschüttet wurde. Das dritte Geschoß besitzt gegen Nor-
den eine ursprüngliche Schießscharte, d. h. einen Mauer-
schlitz, der sich nach innen zu erweitert. Das vierte hat nach
den vier Himmelsrichtungen je ein gekuppeltes Fenster
(Schallfenster) mit einem gemauerten Mittelpfeiler. Diese
Fenster sowie die obenerwähnten Türen sind innen mit
Steinplatten und Quadern ausgelegt. Ob dieses ursprüng-
lich oberste Geschoß von einer Kuppel bedeckt war, läßt sich
Abb. 107. Aufriß der St. Barbarakirche in öastohostice.
nicht feststellen.
Das am Turme niedergerissene Gebäude stand als Kapelle noch 1672, wie wir aus einem Bisitationsbericht
ersehen, und besaß einen konsekrierten Altar und Konsekrationskreuze an der Wand. Uber die Gestalt dieser Kapelle
gibt schon die Abbruchstelle gewisse Anhaltspunkte, da ihr rundbogiger Grundriß und knochenartiger oberer Abschluß
auf ein Gebäude mit kreisförmigem Grundriß und Kuppelwölbung schließen läßt. Diese Annahme finden wir auch
noch dadurch bestätigt, daß ein 'Mauerrest, von der heutigen Kirche ausgehend, so rundbogig abschließt, daß dieses