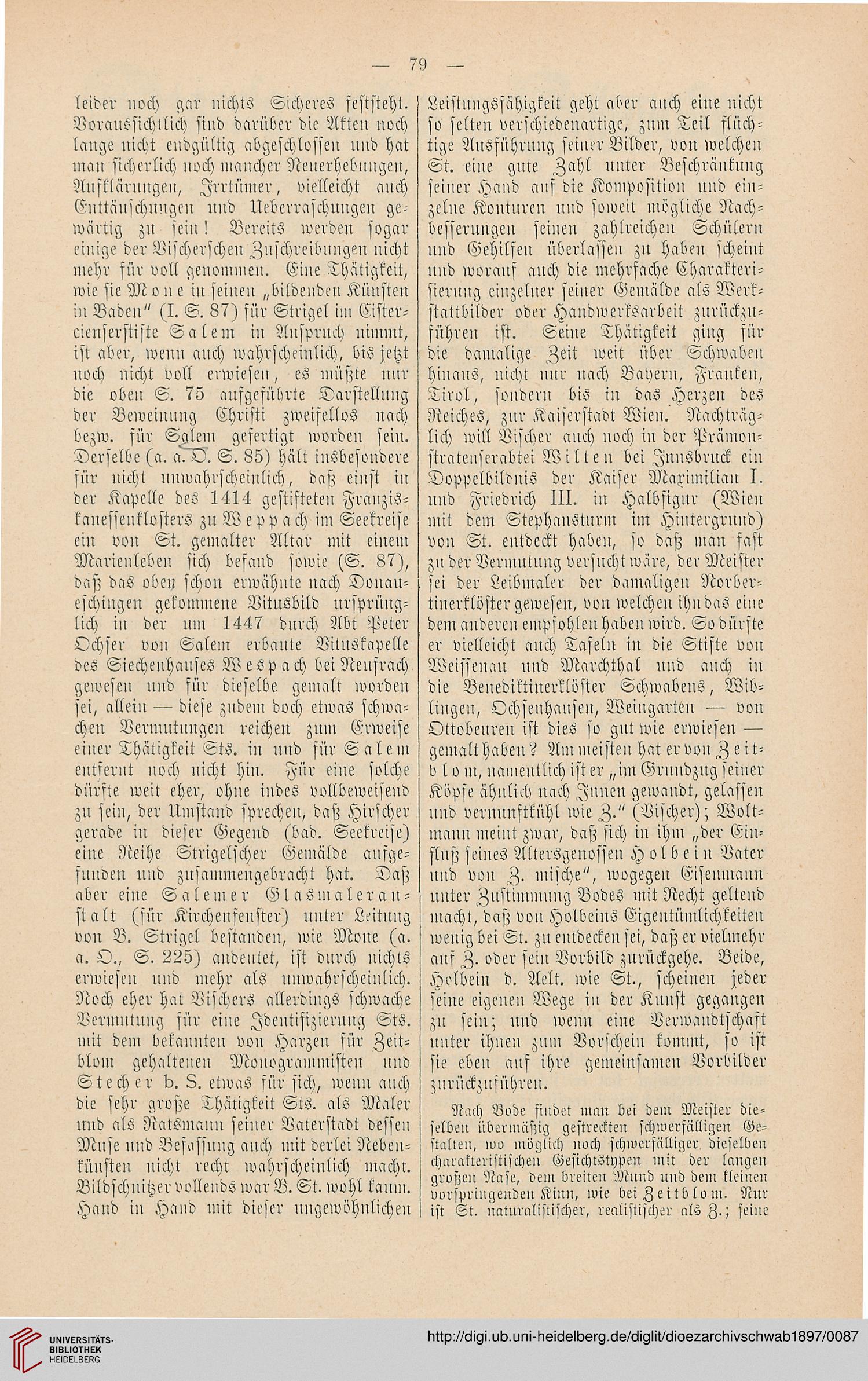79
leider noch gar nichts Sicheres feststeht.
Voraussichtlich sind darüber die Akten noch
lange nicht endgültig abgeschlossen und hat
man sicherlich noch mancher Nenerhebnngen,
Aufklärungen, Jrrtümer, vielleicht auch
Enttäuschungen und Ueberraschungen ge-
wärtig zu sein! Bereits werden sogar
einige der Vischerschen Zuschreibungen nicht
mehr für voll genommen. Eine Thätigkeit,
wie sie Mone in seinen „bildenden Künsten
in Baden" (I. S. 87) für Strigel im Cister-
cienserstifte Salem in Anspruch nimmt,
ist aber, wenn auch wahrscheinlich, bis jetzt
noch nicht voll erwiesen, es müßte nur
die oben S. 75 aufgefübrte Darstellung
der Beweinung Christi zweifellos nach
bezw. für Salem gefertigt worden sein.
Derselbe (a. a7O. S. 85) hält insbesondere
für nicht unwahrscheinlich, daß einst in
der Kapelle deS 1414 gestifteten Franzis-
kanessenklosters zuWeppa ch im Seekreise
ein von St. gemalter Altar mit einem
Marienleben sich befand sowie HS. 87),
daß das oben schon erwähnte nach Donan-
eschingen gekommene Vitusbild ursprüng-
lich in der um 1447 durch Abt Peter
Ochser von Salem erbaute Vitnskapelle
des SiechenhanseS Wespach bei Neufrach
gewesen und für dieselbe gemalt worden
sei, allein — diese zudem doch etwas schwa-
chen Vermutungen reichen zum Erweise
einer Thätigkeit Stö. in und für Salem
entfernt noch nicht hin. Für eine solche
dürfte weit eher, ohne indes vollbewcisend
zu sein, der Umstand sprechen, daß Hirscher
gerade in dieser Gegend (bad. Seekreise)
eine Reihe Strigelscher Gemälde anfge-
fnnden und zusammengebracht hat. Daß
aber eine Salem er Glasmaleran-
sialt (für Kirchenfenster) unter Leitung
von B. Strigel bestanden, wie Mone (a.
a. O., S. 225) andentet, ist durch nichts
erwiesen und mehr als unwahrscheinlich.
Noch eher hat Vischcrs allerdings schwache
Vermutung für eine Identifizierung Sts.
mit dem bekannten von Harzen für Zeit-
blom gehaltenen Monogrammisten und
Stecher d. 5. etwas für sich, wenn auch
die sehr große Thätigkeit StS. als Maler
und als Ratsmann seiner Vaterstadt dessen
Muse und Befassung auch mit derlei Neben-
künsten nicht recht wahrscheinlich macht.
Bildschnitzer vollends war B. St. wohl kaum.
Hand in Hand mit dieser ungewöhnlichen
Leistungsfähigkeit geht aber auch eine nicht
so selten verschiedenartige, zum Teil flüch-
tige Ausführung seiner Bilder, von welchen
St. eine gute Zahl unter Beschränkung
seiner Hand ans die Komposition und ein-
zelne Konturen und soweit mögliche Nach-
besserungen seinen zahlreichen Schülern
und Gehilfen überlassen zu haben scheint
und worauf auch die mehrfache Charakteri-
sierung einzelner seiner Gemälde als Werk-
stattbilder oder Handwerksarbeit zurückzu-
führen ist. Seine Thätigkeit ging für
die damalige Zeit weit über Schwaben
hinaus, nicht nur nach Bayern, Franken,
Tirol, sondern bis in das Herzen des
Reiches, zur Kaiserstadt Wien. Nachträg-
lich will Bischer auch noch in der Prämon-
stratenserabtei W i l t e n bei ZnnSbruck ein
Doppelbildnis der Kaiser Maximilian I.
und Friedrich III. in Halbsignr (Wien
mit dem Stephanstnrm im Hintergrund)
von St. entdeckt habe», so daß man fast
zu der Vermutung versucht wäre, der Meister
sei der Leibmaler der damaligen Norber-
tinerklöster gewesen, von welchen ihndaS eine
dem anderen empfohlen haben wird. So dürfte
er vielleicht auch Tafeln in die Stifte von
Weissenan und Marchthal und auch in
die Benediktinerklöster Schwabens, Wib-
lingen, Ochsenhansen, Weingarten — von
Ottobenren ist dies so gut wie erwiesen —
gemalt haben? Am meisten hat er von Zeit-
b l o m, namentlich ist er „im Grnndzug seiner
Köpfe ähnlich nach Innen gewandt, gelassen
und vernnnftkühl wie Z." (Bischer); Welt-
mann meint zwar, daß sich in ihm „der Ein-
fluß seines Altersgenossen Holbein Vater
und von Z. mische", wogegen Eisenmann
unter Zustimmung Bodes mit Recht geltend
macht, daß von Hvlbeins Eigentümlichkeiten
wenig bei St. zu entdecken sei, daß er vielmehr
auf Z. oder sein Vorbild zurückgehe. Beide,
Holbcin d. Aelt. wie St., scheinen jeder
seine eigene» Wege in der Kunst gegangen
zu sein; und wenn eine Verwandtschaft
unter ihnen zum Vorschein kommt, so ist
sie eben auf ihre gemeinsamen Vorbilder
znrückznführen.
Nach Bode findet man bei dem Meister die-
selben übermäßig gestreckten schwerfälligen Ge-
stalten, wo möglich noch schwerfälliger, dieselben
charakteristischen Gesichtstypen mit der langen
großen Nase, dein breiten Mnnd und dem kleinen
vorspringenden Kinn, wie bei Zeitblom. Nur
ist St, naturalistischer, realistischer als Z.; seine
leider noch gar nichts Sicheres feststeht.
Voraussichtlich sind darüber die Akten noch
lange nicht endgültig abgeschlossen und hat
man sicherlich noch mancher Nenerhebnngen,
Aufklärungen, Jrrtümer, vielleicht auch
Enttäuschungen und Ueberraschungen ge-
wärtig zu sein! Bereits werden sogar
einige der Vischerschen Zuschreibungen nicht
mehr für voll genommen. Eine Thätigkeit,
wie sie Mone in seinen „bildenden Künsten
in Baden" (I. S. 87) für Strigel im Cister-
cienserstifte Salem in Anspruch nimmt,
ist aber, wenn auch wahrscheinlich, bis jetzt
noch nicht voll erwiesen, es müßte nur
die oben S. 75 aufgefübrte Darstellung
der Beweinung Christi zweifellos nach
bezw. für Salem gefertigt worden sein.
Derselbe (a. a7O. S. 85) hält insbesondere
für nicht unwahrscheinlich, daß einst in
der Kapelle deS 1414 gestifteten Franzis-
kanessenklosters zuWeppa ch im Seekreise
ein von St. gemalter Altar mit einem
Marienleben sich befand sowie HS. 87),
daß das oben schon erwähnte nach Donan-
eschingen gekommene Vitusbild ursprüng-
lich in der um 1447 durch Abt Peter
Ochser von Salem erbaute Vitnskapelle
des SiechenhanseS Wespach bei Neufrach
gewesen und für dieselbe gemalt worden
sei, allein — diese zudem doch etwas schwa-
chen Vermutungen reichen zum Erweise
einer Thätigkeit Stö. in und für Salem
entfernt noch nicht hin. Für eine solche
dürfte weit eher, ohne indes vollbewcisend
zu sein, der Umstand sprechen, daß Hirscher
gerade in dieser Gegend (bad. Seekreise)
eine Reihe Strigelscher Gemälde anfge-
fnnden und zusammengebracht hat. Daß
aber eine Salem er Glasmaleran-
sialt (für Kirchenfenster) unter Leitung
von B. Strigel bestanden, wie Mone (a.
a. O., S. 225) andentet, ist durch nichts
erwiesen und mehr als unwahrscheinlich.
Noch eher hat Vischcrs allerdings schwache
Vermutung für eine Identifizierung Sts.
mit dem bekannten von Harzen für Zeit-
blom gehaltenen Monogrammisten und
Stecher d. 5. etwas für sich, wenn auch
die sehr große Thätigkeit StS. als Maler
und als Ratsmann seiner Vaterstadt dessen
Muse und Befassung auch mit derlei Neben-
künsten nicht recht wahrscheinlich macht.
Bildschnitzer vollends war B. St. wohl kaum.
Hand in Hand mit dieser ungewöhnlichen
Leistungsfähigkeit geht aber auch eine nicht
so selten verschiedenartige, zum Teil flüch-
tige Ausführung seiner Bilder, von welchen
St. eine gute Zahl unter Beschränkung
seiner Hand ans die Komposition und ein-
zelne Konturen und soweit mögliche Nach-
besserungen seinen zahlreichen Schülern
und Gehilfen überlassen zu haben scheint
und worauf auch die mehrfache Charakteri-
sierung einzelner seiner Gemälde als Werk-
stattbilder oder Handwerksarbeit zurückzu-
führen ist. Seine Thätigkeit ging für
die damalige Zeit weit über Schwaben
hinaus, nicht nur nach Bayern, Franken,
Tirol, sondern bis in das Herzen des
Reiches, zur Kaiserstadt Wien. Nachträg-
lich will Bischer auch noch in der Prämon-
stratenserabtei W i l t e n bei ZnnSbruck ein
Doppelbildnis der Kaiser Maximilian I.
und Friedrich III. in Halbsignr (Wien
mit dem Stephanstnrm im Hintergrund)
von St. entdeckt habe», so daß man fast
zu der Vermutung versucht wäre, der Meister
sei der Leibmaler der damaligen Norber-
tinerklöster gewesen, von welchen ihndaS eine
dem anderen empfohlen haben wird. So dürfte
er vielleicht auch Tafeln in die Stifte von
Weissenan und Marchthal und auch in
die Benediktinerklöster Schwabens, Wib-
lingen, Ochsenhansen, Weingarten — von
Ottobenren ist dies so gut wie erwiesen —
gemalt haben? Am meisten hat er von Zeit-
b l o m, namentlich ist er „im Grnndzug seiner
Köpfe ähnlich nach Innen gewandt, gelassen
und vernnnftkühl wie Z." (Bischer); Welt-
mann meint zwar, daß sich in ihm „der Ein-
fluß seines Altersgenossen Holbein Vater
und von Z. mische", wogegen Eisenmann
unter Zustimmung Bodes mit Recht geltend
macht, daß von Hvlbeins Eigentümlichkeiten
wenig bei St. zu entdecken sei, daß er vielmehr
auf Z. oder sein Vorbild zurückgehe. Beide,
Holbcin d. Aelt. wie St., scheinen jeder
seine eigene» Wege in der Kunst gegangen
zu sein; und wenn eine Verwandtschaft
unter ihnen zum Vorschein kommt, so ist
sie eben auf ihre gemeinsamen Vorbilder
znrückznführen.
Nach Bode findet man bei dem Meister die-
selben übermäßig gestreckten schwerfälligen Ge-
stalten, wo möglich noch schwerfälliger, dieselben
charakteristischen Gesichtstypen mit der langen
großen Nase, dein breiten Mnnd und dem kleinen
vorspringenden Kinn, wie bei Zeitblom. Nur
ist St, naturalistischer, realistischer als Z.; seine