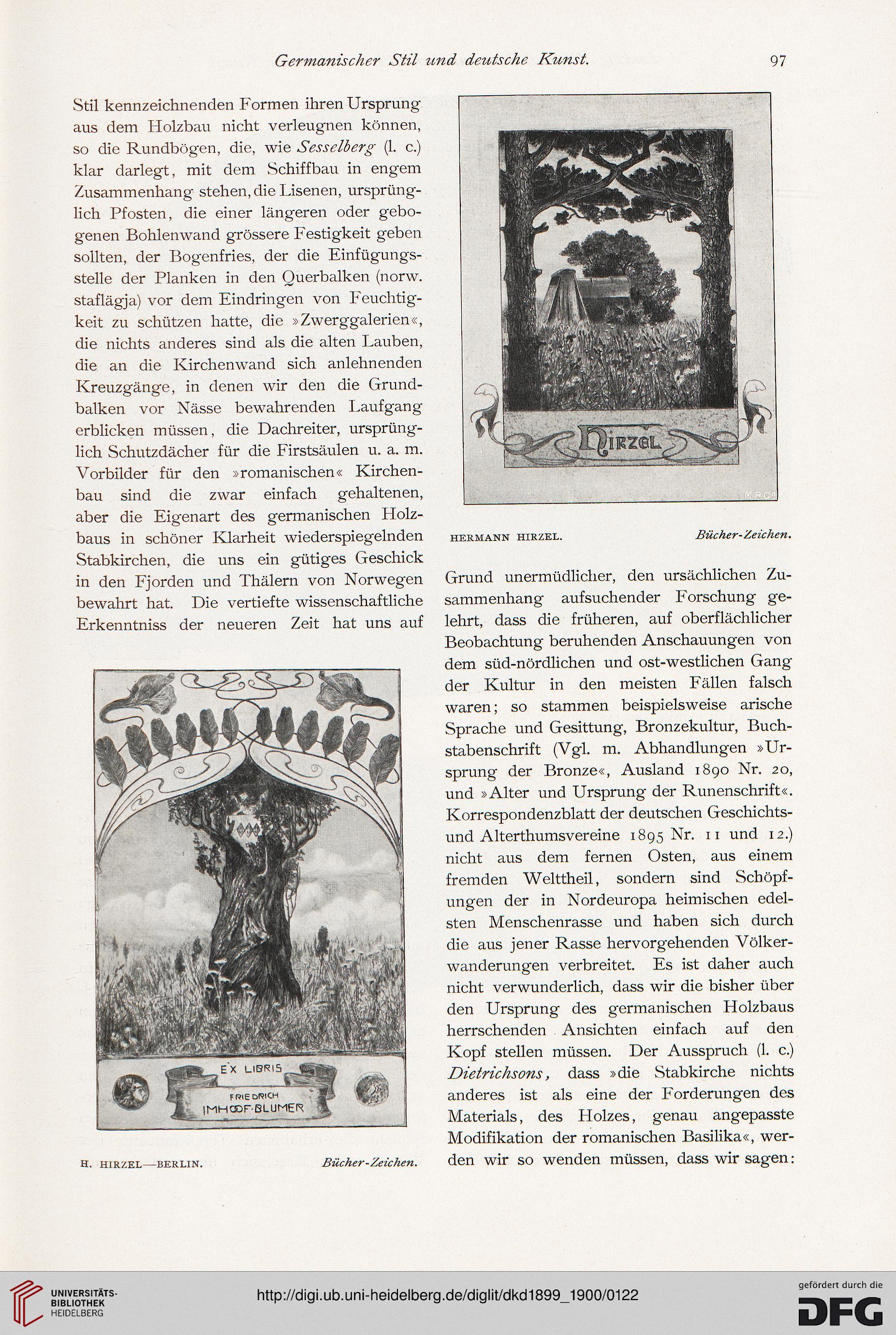Germanischer Stil und deutsche Kunst.
97
Stil kennzeichnenden Formen ihren Ursprung
aus dem Holzbau nicht verleugnen können,
so die Rundbögen, die, wie Sesselberg (1. c.)
klar darlegt, mit dem Schiffbau in engem
Zusammenhang stehen, die Lisenen, ursprüng-
lich Pfosten, die einer längeren oder gebo-
genen Bohlenwand grössere Festigkeit geben
sollten, der Bogenfries, der die Einfügungs-
stelle der Planken in den Querbalken (norw.
staflägja) vor dem Eindringen von Feuchtig-
keit zu schützen hatte, die »Zwerggalerien«,
die nichts anderes sind als die alten Lauben,
die an die Kirchenwand sich anlehnenden
Kreuzgänge, in denen wir den die Grund-
balken vor Nässe bewahrenden Faufgang
erblicken müssen, die Dachreiter, ursprüng-
lich Schutzdächer für die Firstsäulen u. a. m.
Vorbilder für den »romanischen« Kirchen-
bau sind die zwar einfach gehaltenen,
aber die Eigenart des germanischen Holz-
baus in schöner Klarheit wiederspiegelnden
Stabkirchen, die uns ein gütiges Geschick
in den Fjorden und Thälern von Norwegen
bewahrt hat. Die vertiefte wissenschaftliche
Erkenntniss der neueren Zeit hat uns auf
H. HIRZEL—BERLIN. Bücher ■ Zeichen.
HERMANN HIRZEL. Bücher-Zeichen.
Grund unermüdlicher, den ursächlichen Zu-
sammenhang aufsuchender Forschung ge-
lehrt, dass die früheren, auf oberflächlicher
Beobachtung beruhenden Anschauungen von
dem süd-nördlichen und ost-westlichen Gang
der Kultur in den meisten Fällen falsch
waren; so stammen beispielsweise arische
Sprache und Gesittung, Bronzekultur, Buch-
stabenschrift (Vgl. m. Abhandlungen »Ur-
sprung der Bronze«, Ausland 1890 Nr. 20,
und »Alter und Ursprung der Runenschrift«.
Korrespondenzblatt der deutschen Geschichts-
und Alterthumsvereine 1895 Nr. 11 und 12.)
nicht aus dem fernen Osten, aus einem
fremden Welttheil, sondern sind Schöpf-
ungen der in Nordeuropa heimischen edel-
sten Menschenrasse und haben sich durch
die aus jener Rasse hervorgehenden Völker-
wanderungen verbreitet. Es ist daher auch
nicht verwunderlich, dass wir die bisher über
den Ursprung des germanischen Holzbaus
herrschenden Ansichten einfach auf den
Kopf stellen müssen. Der Ausspruch (1. c.)
Dietrichsons, dass »die Stabkirche nichts
anderes ist als eine der Forderungen des
Materials, des Holzes, genau angepasste
Modifikation der romanischen Basilika«, wer-
den wir so wenden müssen, dass wir sagen:
97
Stil kennzeichnenden Formen ihren Ursprung
aus dem Holzbau nicht verleugnen können,
so die Rundbögen, die, wie Sesselberg (1. c.)
klar darlegt, mit dem Schiffbau in engem
Zusammenhang stehen, die Lisenen, ursprüng-
lich Pfosten, die einer längeren oder gebo-
genen Bohlenwand grössere Festigkeit geben
sollten, der Bogenfries, der die Einfügungs-
stelle der Planken in den Querbalken (norw.
staflägja) vor dem Eindringen von Feuchtig-
keit zu schützen hatte, die »Zwerggalerien«,
die nichts anderes sind als die alten Lauben,
die an die Kirchenwand sich anlehnenden
Kreuzgänge, in denen wir den die Grund-
balken vor Nässe bewahrenden Faufgang
erblicken müssen, die Dachreiter, ursprüng-
lich Schutzdächer für die Firstsäulen u. a. m.
Vorbilder für den »romanischen« Kirchen-
bau sind die zwar einfach gehaltenen,
aber die Eigenart des germanischen Holz-
baus in schöner Klarheit wiederspiegelnden
Stabkirchen, die uns ein gütiges Geschick
in den Fjorden und Thälern von Norwegen
bewahrt hat. Die vertiefte wissenschaftliche
Erkenntniss der neueren Zeit hat uns auf
H. HIRZEL—BERLIN. Bücher ■ Zeichen.
HERMANN HIRZEL. Bücher-Zeichen.
Grund unermüdlicher, den ursächlichen Zu-
sammenhang aufsuchender Forschung ge-
lehrt, dass die früheren, auf oberflächlicher
Beobachtung beruhenden Anschauungen von
dem süd-nördlichen und ost-westlichen Gang
der Kultur in den meisten Fällen falsch
waren; so stammen beispielsweise arische
Sprache und Gesittung, Bronzekultur, Buch-
stabenschrift (Vgl. m. Abhandlungen »Ur-
sprung der Bronze«, Ausland 1890 Nr. 20,
und »Alter und Ursprung der Runenschrift«.
Korrespondenzblatt der deutschen Geschichts-
und Alterthumsvereine 1895 Nr. 11 und 12.)
nicht aus dem fernen Osten, aus einem
fremden Welttheil, sondern sind Schöpf-
ungen der in Nordeuropa heimischen edel-
sten Menschenrasse und haben sich durch
die aus jener Rasse hervorgehenden Völker-
wanderungen verbreitet. Es ist daher auch
nicht verwunderlich, dass wir die bisher über
den Ursprung des germanischen Holzbaus
herrschenden Ansichten einfach auf den
Kopf stellen müssen. Der Ausspruch (1. c.)
Dietrichsons, dass »die Stabkirche nichts
anderes ist als eine der Forderungen des
Materials, des Holzes, genau angepasste
Modifikation der romanischen Basilika«, wer-
den wir so wenden müssen, dass wir sagen: