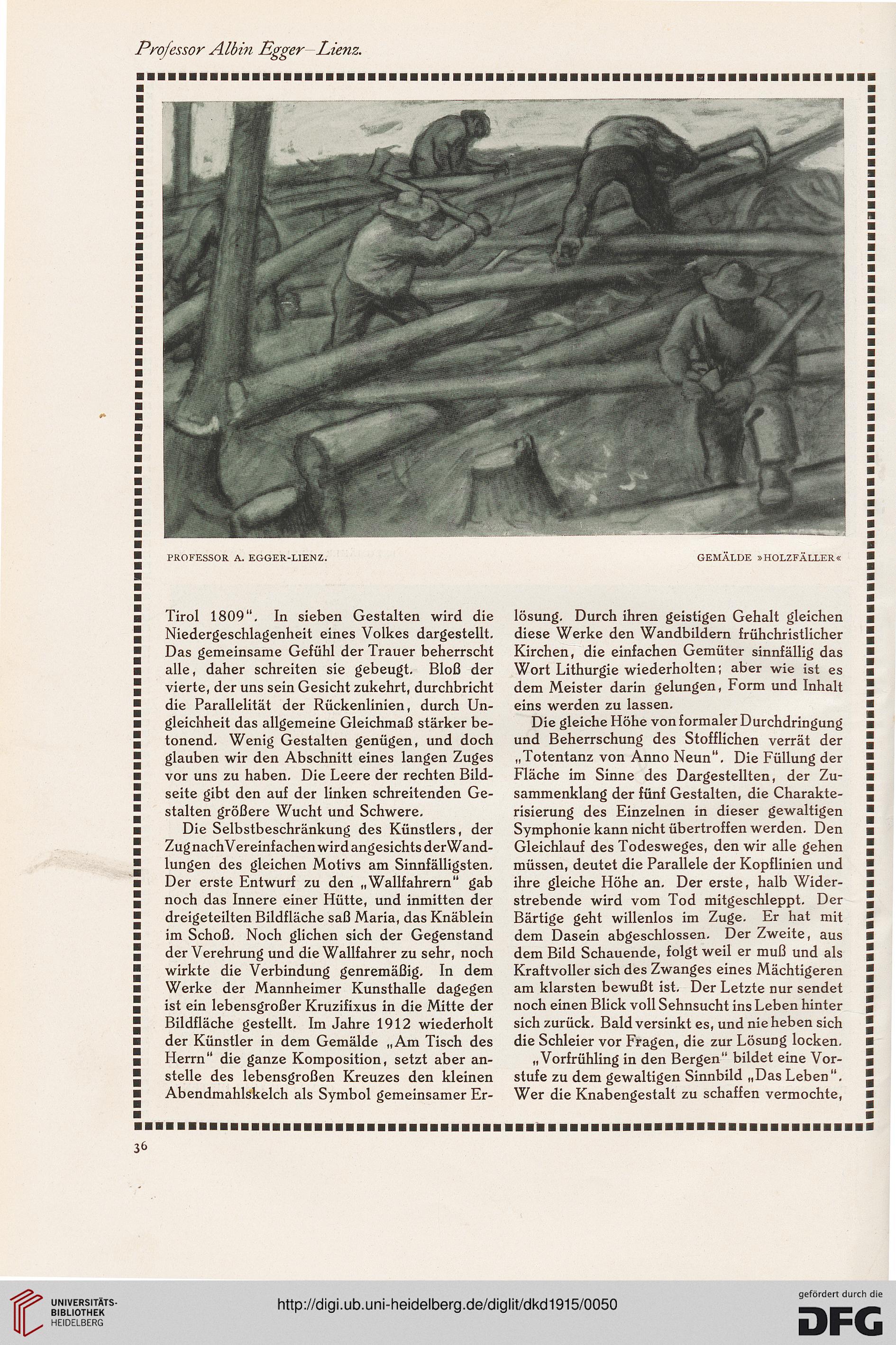Professor Albin Egger Lienz.
PROFESSOR A. EGGER-LIENZ.
GEMÄLDE »HOLZFÄLLER«
Tirol 1809". In sieben Gestalten wird die
Niedergeschlagenheit eines Volkes dargestellt.
Das gemeinsame Gefühl der Trauer beherrscht
alle, daher schreiten sie gebeugt. Bloß der
vierte, der uns sein Gesicht zukehrt, durchbricht
die Parallelität der Rückenlinien, durch Un-
gleichheit das allgemeine Gleichmaß stärker be-
tonend. Wenig Gestalten genügen, und doch
glauben wir den Abschnitt eines langen Zuges
vor uns zu haben. Die Leere der rechten Bild-
seite gibt den auf der linken schreitenden Ge-
stalten größere Wucht und Schwere.
Die Selbstbeschränkung des Künstlers, der
Zug nach Vereinfachen wird angesichts derWand-
lungen des gleichen Motivs am Sinnfälligsten.
Der erste Entwurf zu den „Wallfahrern" gab
noch das Innere einer Hütte, und inmitten der
dreigeteilten Bildfläche saß Maria, das Knäblein
im Schoß. Noch glichen sich der Gegenstand
der Verehrung und die Wallfahrer zu sehr, noch
wirkte die Verbindung genremäßig. In dem
Werke der Mannheimer Kunsthalle dagegen
ist ein lebensgroßer Kruzifixus in die Mitte der
Bildfläche gestellt. Im Jahre 1912 wiederholt
der Künstler in dem Gemälde „Am Tisch des
Herrn" die ganze Komposition, setzt aber an-
stelle des lebensgroßen Kreuzes den kleinen
Abendmahlskelch als Symbol gemeinsamer Er-
lösung. Durch ihren geistigen Gehalt gleichen
diese Werke den Wandbildern frühchristlicher
Kirchen, die einfachen Gemüter sinnfällig das
Wort Lithurgie wiederholten; aber wie ist es
dem Meister darin gelungen, Form und Inhalt
eins werden zu lassen.
Die gleiche Höhe von formaler Durchdringung
und Beherrschung des Stofflichen verrät der
„Totentanz von Anno Neun". Die Füllung der
Fläche im Sinne des Dargestellten, der Zu-
sammenklang der fünf Gestalten, die Charakte-
risierung des Einzelnen in dieser gewaltigen
Symphonie kann nicht übertroffen werden. Den
Gleichlauf des Todesweges, den wir alle gehen
müssen, deutet die Parallele der Kopflinien und
ihre gleiche Höhe an. Der erste, halb Wider-
strebende wird vom Tod mitgeschleppt. Der
Bärtige geht willenlos im Zuge. Er hat mit
dem Dasein abgeschlossen. Der Zweite, aus
dem Bild Schauende, folgt weil er muß und als
Kraftvoller sich des Zwanges eines Mächtigeren
am klarsten bewußt ist. Der Letzte nur sendet
noch einen Blick voll Sehnsucht ins Leben hinter
sich zurück. Bald versinkt es, und nie heben sich
die Schleier vor Fragen, die zur Lösung locken.
„Vorfrühling in den Bergen" bildet eine Vor-
stufe zu dem gewaltigen Sinnbild „Das Leben".
Wer die Knabengestalt zu schaffen vermochte,
36
PROFESSOR A. EGGER-LIENZ.
GEMÄLDE »HOLZFÄLLER«
Tirol 1809". In sieben Gestalten wird die
Niedergeschlagenheit eines Volkes dargestellt.
Das gemeinsame Gefühl der Trauer beherrscht
alle, daher schreiten sie gebeugt. Bloß der
vierte, der uns sein Gesicht zukehrt, durchbricht
die Parallelität der Rückenlinien, durch Un-
gleichheit das allgemeine Gleichmaß stärker be-
tonend. Wenig Gestalten genügen, und doch
glauben wir den Abschnitt eines langen Zuges
vor uns zu haben. Die Leere der rechten Bild-
seite gibt den auf der linken schreitenden Ge-
stalten größere Wucht und Schwere.
Die Selbstbeschränkung des Künstlers, der
Zug nach Vereinfachen wird angesichts derWand-
lungen des gleichen Motivs am Sinnfälligsten.
Der erste Entwurf zu den „Wallfahrern" gab
noch das Innere einer Hütte, und inmitten der
dreigeteilten Bildfläche saß Maria, das Knäblein
im Schoß. Noch glichen sich der Gegenstand
der Verehrung und die Wallfahrer zu sehr, noch
wirkte die Verbindung genremäßig. In dem
Werke der Mannheimer Kunsthalle dagegen
ist ein lebensgroßer Kruzifixus in die Mitte der
Bildfläche gestellt. Im Jahre 1912 wiederholt
der Künstler in dem Gemälde „Am Tisch des
Herrn" die ganze Komposition, setzt aber an-
stelle des lebensgroßen Kreuzes den kleinen
Abendmahlskelch als Symbol gemeinsamer Er-
lösung. Durch ihren geistigen Gehalt gleichen
diese Werke den Wandbildern frühchristlicher
Kirchen, die einfachen Gemüter sinnfällig das
Wort Lithurgie wiederholten; aber wie ist es
dem Meister darin gelungen, Form und Inhalt
eins werden zu lassen.
Die gleiche Höhe von formaler Durchdringung
und Beherrschung des Stofflichen verrät der
„Totentanz von Anno Neun". Die Füllung der
Fläche im Sinne des Dargestellten, der Zu-
sammenklang der fünf Gestalten, die Charakte-
risierung des Einzelnen in dieser gewaltigen
Symphonie kann nicht übertroffen werden. Den
Gleichlauf des Todesweges, den wir alle gehen
müssen, deutet die Parallele der Kopflinien und
ihre gleiche Höhe an. Der erste, halb Wider-
strebende wird vom Tod mitgeschleppt. Der
Bärtige geht willenlos im Zuge. Er hat mit
dem Dasein abgeschlossen. Der Zweite, aus
dem Bild Schauende, folgt weil er muß und als
Kraftvoller sich des Zwanges eines Mächtigeren
am klarsten bewußt ist. Der Letzte nur sendet
noch einen Blick voll Sehnsucht ins Leben hinter
sich zurück. Bald versinkt es, und nie heben sich
die Schleier vor Fragen, die zur Lösung locken.
„Vorfrühling in den Bergen" bildet eine Vor-
stufe zu dem gewaltigen Sinnbild „Das Leben".
Wer die Knabengestalt zu schaffen vermochte,
36