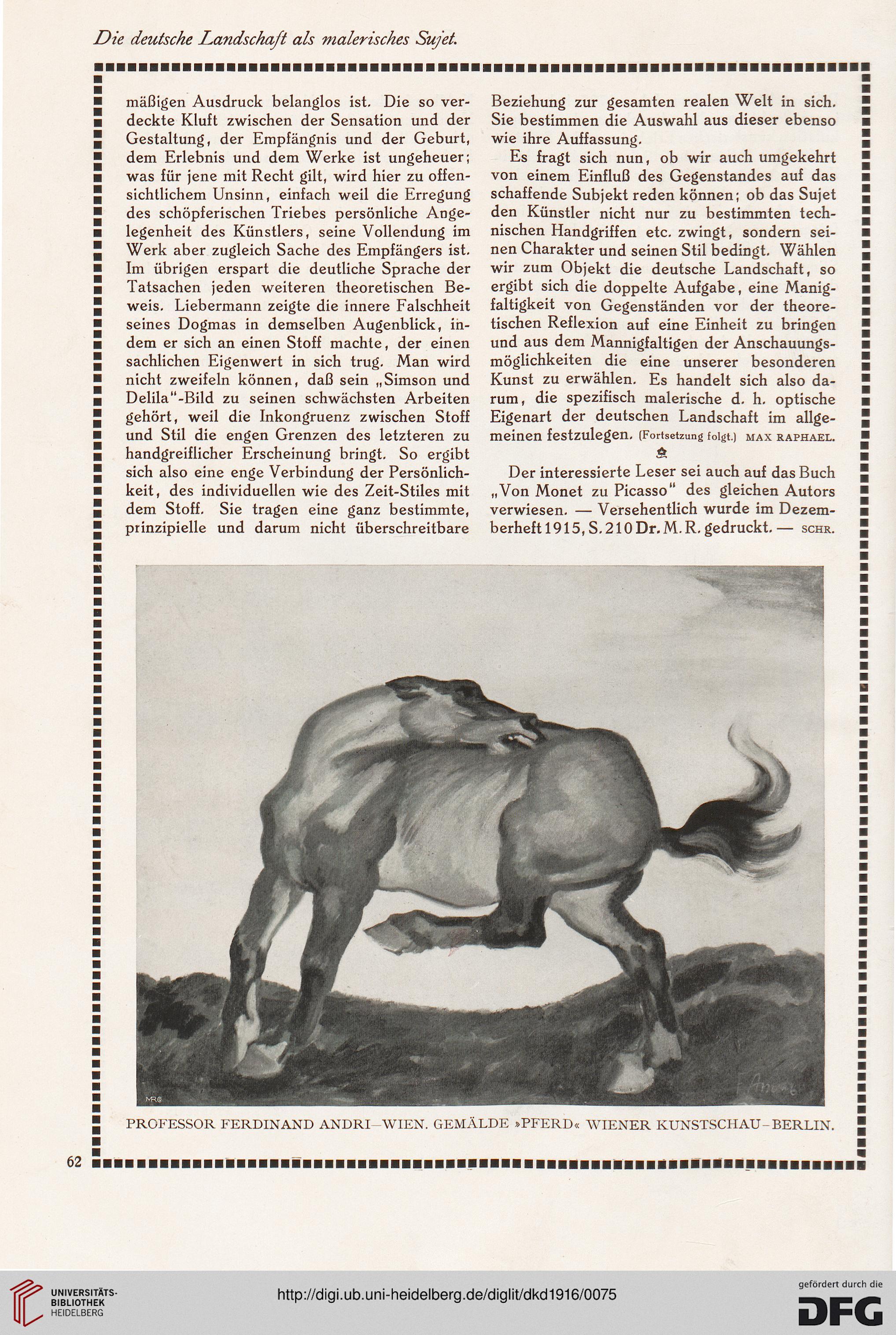Die deutsche Landschaft als malerisches Sujet.
mäßigen Ausdruck belanglos ist. Die so ver-
deckte Kluft zwischen der Sensation und der
Gestaltung, der Empfängnis und der Geburt,
dem Erlebnis und dem Werke ist ungeheuer;
was für jene mit Recht gilt, wird hier zu offen-
sichtlichem Unsinn, einfach weil die Erregung
des schöpferischen Triebes persönliche Ange-
legenheit des Künstlers, seine Vollendung im
Werk aber zugleich Sache des Empfängers ist.
Im übrigen erspart die deutliche Sprache der
Tatsachen jeden weiteren theoretischen Be-
weis. Liebermann zeigte die innere Falschheit
seines Dogmas in demselben Augenblick, in-
dem er sich an einen Stoff machte, der einen
sachlichen Eigenwert in sich trug. Man wird
nicht zweifeln können, daß sein „Simson und
Delila"-Bild zu seinen schwächsten Arbeiten
gehört, weil die Inkongruenz zwischen Stoff
und Stil die engen Grenzen des letzteren zu
handgreiflicher Erscheinung bringt. So ergibt
sich also eine enge Verbindung der Persönlich-
keit, des individuellen wie des Zeit-Stiles mit
dem Stoff. Sie tragen eine ganz bestimmte,
prinzipielle und darum nicht überschreitbare
Beziehung zur gesamten realen Welt in sich.
Sie bestimmen die Auswahl aus dieser ebenso
wie ihre Auffassung.
Es fragt sich nun, ob wir auch umgekehrt
von einem Einfluß des Gegenstandes auf das
schaffende Subjekt reden können; ob das Sujet
den Künstler nicht nur zu bestimmten tech-
nischen Handgriffen etc. zwingt, sondern sei-
nen Charakter und seinen Stil bedingt. Wählen
wir zum Objekt die deutsche Landschaft, so
ergibt sich die doppelte Aufgabe, eine Manig-
faltigkeit von Gegenständen vor der theore-
tischen Reflexion auf eine Einheit zu bringen
und aus dem Mannigfaltigen der Anschauungs-
möglichkeiten die eine unserer besonderen
Kunst zu erwählen. Es handelt sich also da-
rum, die spezifisch malerische d. h. optische
Eigenart der deutschen Landschaft im allge-
meinen festzulegen. (Fortsetzung folgt.) max raphael.
Ä
Der interessierte Leser sei auch auf das Buch
„Von Monet zu Picasso" des gleichen Autors
verwiesen. — Versehentlich wurde im Dezem-
berheft 1915, S. 210 Dr. M. R. gedruckt. — schr.
PROFESSOR FERDINAND ANDRI- WIEN. GEMÄLDE »PFERD« "WIENER KUNSTSCIIAU BERLIN.
mäßigen Ausdruck belanglos ist. Die so ver-
deckte Kluft zwischen der Sensation und der
Gestaltung, der Empfängnis und der Geburt,
dem Erlebnis und dem Werke ist ungeheuer;
was für jene mit Recht gilt, wird hier zu offen-
sichtlichem Unsinn, einfach weil die Erregung
des schöpferischen Triebes persönliche Ange-
legenheit des Künstlers, seine Vollendung im
Werk aber zugleich Sache des Empfängers ist.
Im übrigen erspart die deutliche Sprache der
Tatsachen jeden weiteren theoretischen Be-
weis. Liebermann zeigte die innere Falschheit
seines Dogmas in demselben Augenblick, in-
dem er sich an einen Stoff machte, der einen
sachlichen Eigenwert in sich trug. Man wird
nicht zweifeln können, daß sein „Simson und
Delila"-Bild zu seinen schwächsten Arbeiten
gehört, weil die Inkongruenz zwischen Stoff
und Stil die engen Grenzen des letzteren zu
handgreiflicher Erscheinung bringt. So ergibt
sich also eine enge Verbindung der Persönlich-
keit, des individuellen wie des Zeit-Stiles mit
dem Stoff. Sie tragen eine ganz bestimmte,
prinzipielle und darum nicht überschreitbare
Beziehung zur gesamten realen Welt in sich.
Sie bestimmen die Auswahl aus dieser ebenso
wie ihre Auffassung.
Es fragt sich nun, ob wir auch umgekehrt
von einem Einfluß des Gegenstandes auf das
schaffende Subjekt reden können; ob das Sujet
den Künstler nicht nur zu bestimmten tech-
nischen Handgriffen etc. zwingt, sondern sei-
nen Charakter und seinen Stil bedingt. Wählen
wir zum Objekt die deutsche Landschaft, so
ergibt sich die doppelte Aufgabe, eine Manig-
faltigkeit von Gegenständen vor der theore-
tischen Reflexion auf eine Einheit zu bringen
und aus dem Mannigfaltigen der Anschauungs-
möglichkeiten die eine unserer besonderen
Kunst zu erwählen. Es handelt sich also da-
rum, die spezifisch malerische d. h. optische
Eigenart der deutschen Landschaft im allge-
meinen festzulegen. (Fortsetzung folgt.) max raphael.
Ä
Der interessierte Leser sei auch auf das Buch
„Von Monet zu Picasso" des gleichen Autors
verwiesen. — Versehentlich wurde im Dezem-
berheft 1915, S. 210 Dr. M. R. gedruckt. — schr.
PROFESSOR FERDINAND ANDRI- WIEN. GEMÄLDE »PFERD« "WIENER KUNSTSCIIAU BERLIN.