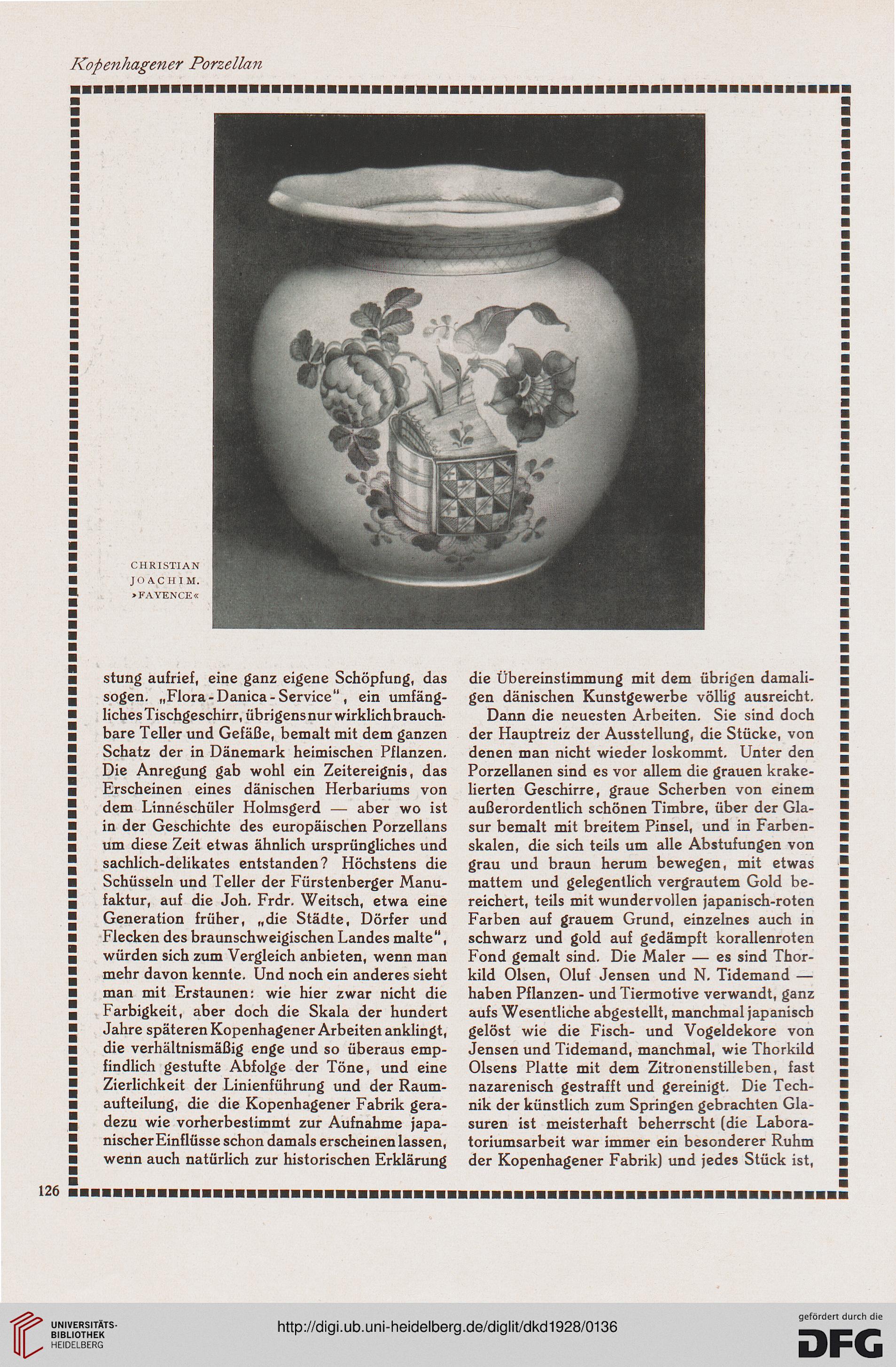Kopenhagener Porzellan
126
CHRISTIAN
JOACHIM.
»FAYENCE«
stung aufrief, eine ganz eigene Schöpfung, das
sogen. „Flora - Danica - Service " , ein umfäng-
liches Tischgeschirr, übrigens nur wirklich brauch-
bare Teller und Gefäße, bemalt mit dem ganzen
Schatz der in Dänemark heimischen Pflanzen.
Die Anregung gab wohl ein Zeitereignis, das
Erscheinen eines dänischen Herbariums von
dem Linneschüler Holmsgerd — aber wo ist
in der Geschichte des europäischen Porzellans
um diese Zeit etwas ähnlich ursprüngliches und
sachlich-delikates entstanden? Höchstens die
Schüsseln und Teller der Fürstenberger Manu-
faktur, auf die Joh. Frdr. Weitsch, etwa eine
Generation früher, „die Städte, Dörfer und
Flecken des braunschweigischen Landes malte",
würden sich zum Vergleich anbieten, wenn man
mehr davon kennte. Und noch ein anderes sieht
man mit Erstaunen: wie hier zwar nicht die
Farbigkeit, aber doch die Skala der hundert
Jahre späteren Kopenhagener Arbeiten anklingt,
die verhältnismäßig enge und so überaus emp-
findlich gestufte Abfolge der Töne, und eine
Zierlichkeit der Linienführung und der Raum-
aufteilung, die die Kopenhagener Fabrik gera-
dezu wie vorherbestimmt zur Aufnahme japa-
nischer Einflüsse schon damals erscheinen lassen,
wenn auch natürlich zur historischen Erklärung
die Übereinstimmung mit dem übrigen damali-
gen dänischen Kunstgewerbe völlig ausreicht.
Dann die neuesten Arbeiten. Sie sind doch
der Hauptreiz der Ausstellung, die Stücke, von
denen man nicht wieder loskommt. Unter den
Porzellanen sind es vor allem die grauen krake-
lierten Geschirre, graue Scherben von einem
außerordentlich schönen Timbre, über der Gla-
sur bemalt mit breitem Pinsel, und in Farben-
skalen, die sich teils um alle Abstufungen von
grau und braun herum bewegen, mit etwas
mattem und gelegentlich vergrautem Gold be-
reichert, teils mit wundervollen japanisch-roten
Farben auf grauem Grund, einzelnes auch in
schwarz und gold auf gedämpft korallenroten
Fond gemalt sind. Die Maler — es sind Thor-
kild Olsen, Oluf Jensen und N. Tidemand —
haben Pflanzen- und Tiermotive verwandt, ganz
aufs Wesentliche abgestellt, manchmal japanisch
gelöst wie die Fisch- und Vogeldekore von
Jensen und Tidemand, manchmal, wie Thorkild
Olsens Platte mit dem Zitronenstilleben, fast
nazarenisch gestrafft und gereinigt. Die Tech-
nik der künstlich zum Springen gebrachten Gla-
suren ist meisterhaft beherrscht (die Labora-
toriumsarbeit war immer ein besonderer Ruhm
der Kopenhagener Fabrik) und jedes Stück ist,
126
CHRISTIAN
JOACHIM.
»FAYENCE«
stung aufrief, eine ganz eigene Schöpfung, das
sogen. „Flora - Danica - Service " , ein umfäng-
liches Tischgeschirr, übrigens nur wirklich brauch-
bare Teller und Gefäße, bemalt mit dem ganzen
Schatz der in Dänemark heimischen Pflanzen.
Die Anregung gab wohl ein Zeitereignis, das
Erscheinen eines dänischen Herbariums von
dem Linneschüler Holmsgerd — aber wo ist
in der Geschichte des europäischen Porzellans
um diese Zeit etwas ähnlich ursprüngliches und
sachlich-delikates entstanden? Höchstens die
Schüsseln und Teller der Fürstenberger Manu-
faktur, auf die Joh. Frdr. Weitsch, etwa eine
Generation früher, „die Städte, Dörfer und
Flecken des braunschweigischen Landes malte",
würden sich zum Vergleich anbieten, wenn man
mehr davon kennte. Und noch ein anderes sieht
man mit Erstaunen: wie hier zwar nicht die
Farbigkeit, aber doch die Skala der hundert
Jahre späteren Kopenhagener Arbeiten anklingt,
die verhältnismäßig enge und so überaus emp-
findlich gestufte Abfolge der Töne, und eine
Zierlichkeit der Linienführung und der Raum-
aufteilung, die die Kopenhagener Fabrik gera-
dezu wie vorherbestimmt zur Aufnahme japa-
nischer Einflüsse schon damals erscheinen lassen,
wenn auch natürlich zur historischen Erklärung
die Übereinstimmung mit dem übrigen damali-
gen dänischen Kunstgewerbe völlig ausreicht.
Dann die neuesten Arbeiten. Sie sind doch
der Hauptreiz der Ausstellung, die Stücke, von
denen man nicht wieder loskommt. Unter den
Porzellanen sind es vor allem die grauen krake-
lierten Geschirre, graue Scherben von einem
außerordentlich schönen Timbre, über der Gla-
sur bemalt mit breitem Pinsel, und in Farben-
skalen, die sich teils um alle Abstufungen von
grau und braun herum bewegen, mit etwas
mattem und gelegentlich vergrautem Gold be-
reichert, teils mit wundervollen japanisch-roten
Farben auf grauem Grund, einzelnes auch in
schwarz und gold auf gedämpft korallenroten
Fond gemalt sind. Die Maler — es sind Thor-
kild Olsen, Oluf Jensen und N. Tidemand —
haben Pflanzen- und Tiermotive verwandt, ganz
aufs Wesentliche abgestellt, manchmal japanisch
gelöst wie die Fisch- und Vogeldekore von
Jensen und Tidemand, manchmal, wie Thorkild
Olsens Platte mit dem Zitronenstilleben, fast
nazarenisch gestrafft und gereinigt. Die Tech-
nik der künstlich zum Springen gebrachten Gla-
suren ist meisterhaft beherrscht (die Labora-
toriumsarbeit war immer ein besonderer Ruhm
der Kopenhagener Fabrik) und jedes Stück ist,