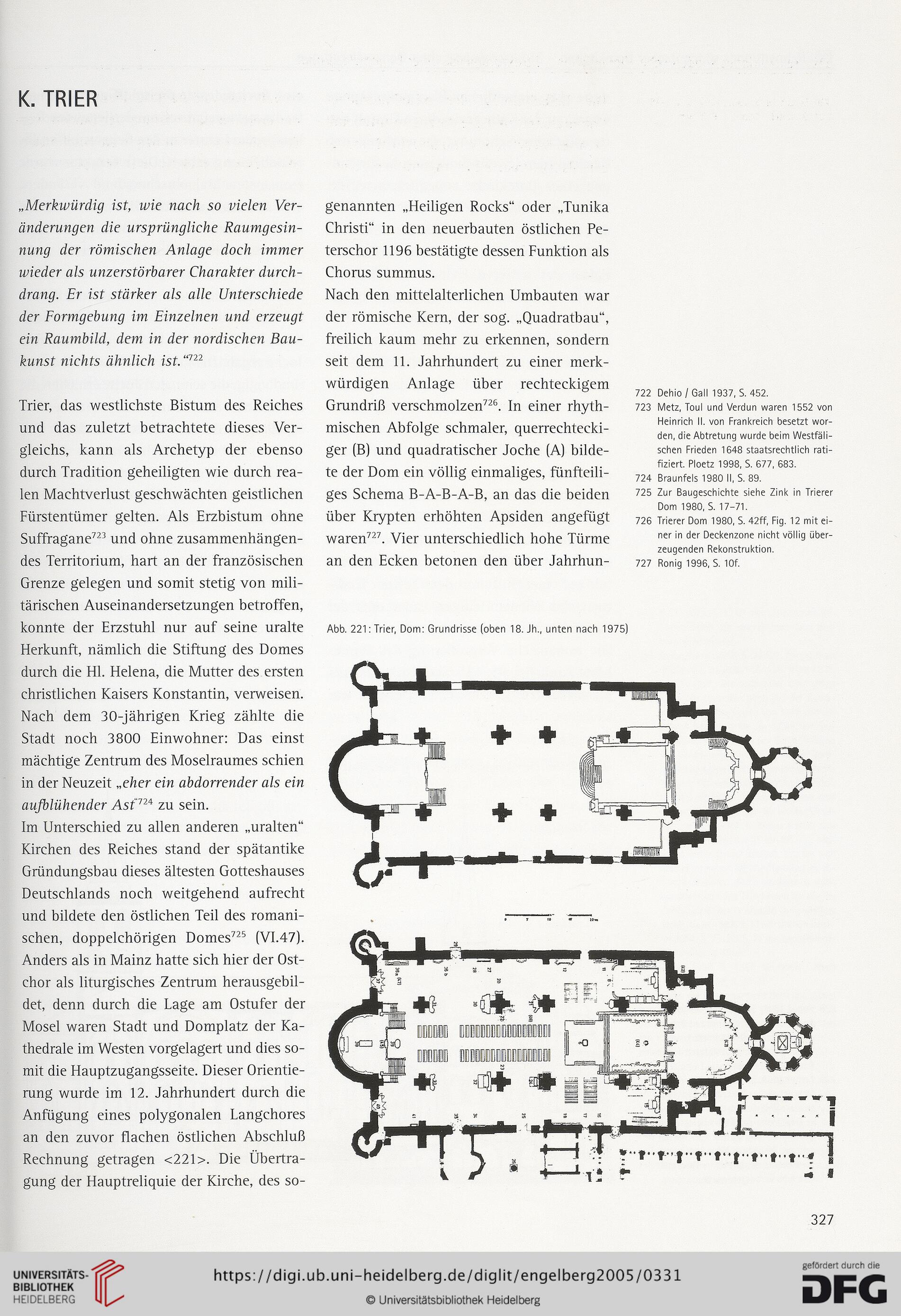K. TRIER
„Merkwürdig ist, wie nach so vielen Ver-
änderungen die ursprüngliche Raumgesin-
nung der römischen Anlage doch immer
wieder als unzerstörbarer Charakter durch-
drang. Er ist stärker als alle Unterschiede
der Formgebung im Einzelnen und erzeugt
ein Raumbild, dem in der nordischen Bau-
kunst nichts ähnlich ist.“722
Trier, das westlichste Bistum des Reiches
und das zuletzt betrachtete dieses Ver-
gleichs, kann als Archetyp der ebenso
durch Tradition geheiligten wie durch rea-
len Machtverlust geschwächten geistlichen
Fürstentümer gelten. Als Erzbistum ohne
Suffragane723 und ohne zusammenhängen-
des Territorium, hart an der französischen
Grenze gelegen und somit stetig von mili-
tärischen Auseinandersetzungen betroffen,
konnte der Erzstuhl nur auf seine uralte
Herkunft, nämlich die Stiftung des Domes
durch die Hl. Helena, die Mutter des ersten
christlichen Kaisers Konstantin, verweisen.
Nach dem 30-jährigen Krieg zählte die
Stadt noch 3800 Einwohner: Das einst
mächtige Zentrum des Moselraumes schien
in der Neuzeit „eher ein abdorrender als ein
aufblühender Ast724 zu sein.
Im Unterschied zu allen anderen „uralten“
Kirchen des Reiches stand der spätantike
Gründungsbau dieses ältesten Gotteshauses
Deutschlands noch weitgehend aufrecht
und bildete den östlichen Teil des romani-
schen, doppelchörigen Domes725 (VI.47).
Anders als in Mainz hatte sich hier der Ost-
chor als liturgisches Zentrum herausgebil-
det, denn durch die Lage am Ostufer der
Mosel waren Stadt und Domplatz der Ka-
thedrale im Westen vorgelagert und dies so-
mit die Hauptzugangsseite. Dieser Orientie-
rung wurde im 12. Jahrhundert durch die
Anfügung eines polygonalen Langchores
an den zuvor flachen östlichen Abschluß
Rechnung getragen <221>. Die Übertra-
gung der Hauptreliquie der Kirche, des so-
genannten „Heiligen Rocks“ oder „Tunika
Christi“ in den neuerbauten östlichen Pe-
terschor 1196 bestätigte dessen Funktion als
Chorus summus.
Nach den mittelalterlichen Umbauten war
der römische Kern, der sog. „Quadratbau“,
freilich kaum mehr zu erkennen, sondern
seit dem 11. Jahrhundert zu einer merk-
würdigen Anlage über rechteckigem
Grundriß verschmolzen726. In einer rhyth-
mischen Abfolge schmaler, querrechtecki-
ger (B) und quadratischer Joche (A) bilde-
te der Dom ein völlig einmaliges, fünfteili-
ges Schema B-A-B-A-B, an das die beiden
über Krypten erhöhten Apsiden angefügt
waren727. Vier unterschiedlich hohe Türme
an den Ecken betonen den über Jahrhun-
722 Dehio / Gall 1937, S. 452.
723 Metz, Toul und Verdun waren 1552 von
Heinrich II. von Frankreich besetzt wor-
den, die Abtretung wurde beim Westfäli-
schen Frieden 1648 staatsrechtlich rati-
fiziert. Ploetz 1998, S. 677, 683.
724 Braunfels 1980 II, S. 89.
725 Zur Baugeschichte siehe Zink in Trierer
Dom 1980, S. 17-71.
726 Trierer Dom 1980, S. 42ff, Fig. 12 mit ei-
ner in der Deckenzone nicht völlig über-
zeugenden Rekonstruktion.
727 Ronig 1996, S. 10f.
Abb. 221: Trier, Dom: Grundrisse (oben 18. Jh., unten nach 1975)
327
„Merkwürdig ist, wie nach so vielen Ver-
änderungen die ursprüngliche Raumgesin-
nung der römischen Anlage doch immer
wieder als unzerstörbarer Charakter durch-
drang. Er ist stärker als alle Unterschiede
der Formgebung im Einzelnen und erzeugt
ein Raumbild, dem in der nordischen Bau-
kunst nichts ähnlich ist.“722
Trier, das westlichste Bistum des Reiches
und das zuletzt betrachtete dieses Ver-
gleichs, kann als Archetyp der ebenso
durch Tradition geheiligten wie durch rea-
len Machtverlust geschwächten geistlichen
Fürstentümer gelten. Als Erzbistum ohne
Suffragane723 und ohne zusammenhängen-
des Territorium, hart an der französischen
Grenze gelegen und somit stetig von mili-
tärischen Auseinandersetzungen betroffen,
konnte der Erzstuhl nur auf seine uralte
Herkunft, nämlich die Stiftung des Domes
durch die Hl. Helena, die Mutter des ersten
christlichen Kaisers Konstantin, verweisen.
Nach dem 30-jährigen Krieg zählte die
Stadt noch 3800 Einwohner: Das einst
mächtige Zentrum des Moselraumes schien
in der Neuzeit „eher ein abdorrender als ein
aufblühender Ast724 zu sein.
Im Unterschied zu allen anderen „uralten“
Kirchen des Reiches stand der spätantike
Gründungsbau dieses ältesten Gotteshauses
Deutschlands noch weitgehend aufrecht
und bildete den östlichen Teil des romani-
schen, doppelchörigen Domes725 (VI.47).
Anders als in Mainz hatte sich hier der Ost-
chor als liturgisches Zentrum herausgebil-
det, denn durch die Lage am Ostufer der
Mosel waren Stadt und Domplatz der Ka-
thedrale im Westen vorgelagert und dies so-
mit die Hauptzugangsseite. Dieser Orientie-
rung wurde im 12. Jahrhundert durch die
Anfügung eines polygonalen Langchores
an den zuvor flachen östlichen Abschluß
Rechnung getragen <221>. Die Übertra-
gung der Hauptreliquie der Kirche, des so-
genannten „Heiligen Rocks“ oder „Tunika
Christi“ in den neuerbauten östlichen Pe-
terschor 1196 bestätigte dessen Funktion als
Chorus summus.
Nach den mittelalterlichen Umbauten war
der römische Kern, der sog. „Quadratbau“,
freilich kaum mehr zu erkennen, sondern
seit dem 11. Jahrhundert zu einer merk-
würdigen Anlage über rechteckigem
Grundriß verschmolzen726. In einer rhyth-
mischen Abfolge schmaler, querrechtecki-
ger (B) und quadratischer Joche (A) bilde-
te der Dom ein völlig einmaliges, fünfteili-
ges Schema B-A-B-A-B, an das die beiden
über Krypten erhöhten Apsiden angefügt
waren727. Vier unterschiedlich hohe Türme
an den Ecken betonen den über Jahrhun-
722 Dehio / Gall 1937, S. 452.
723 Metz, Toul und Verdun waren 1552 von
Heinrich II. von Frankreich besetzt wor-
den, die Abtretung wurde beim Westfäli-
schen Frieden 1648 staatsrechtlich rati-
fiziert. Ploetz 1998, S. 677, 683.
724 Braunfels 1980 II, S. 89.
725 Zur Baugeschichte siehe Zink in Trierer
Dom 1980, S. 17-71.
726 Trierer Dom 1980, S. 42ff, Fig. 12 mit ei-
ner in der Deckenzone nicht völlig über-
zeugenden Rekonstruktion.
727 Ronig 1996, S. 10f.
Abb. 221: Trier, Dom: Grundrisse (oben 18. Jh., unten nach 1975)
327